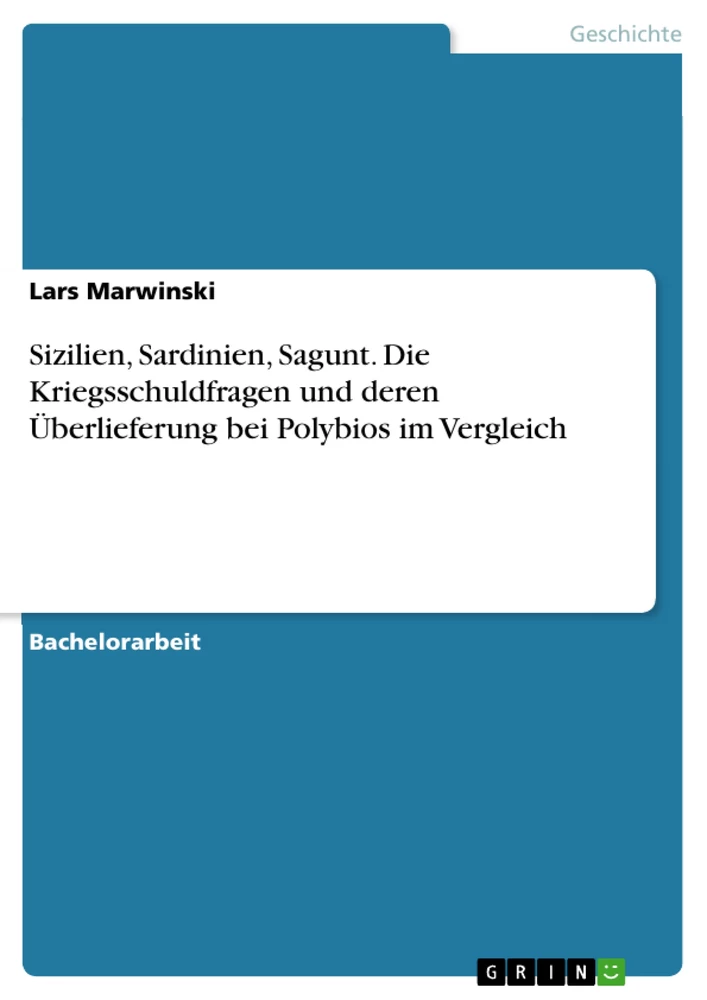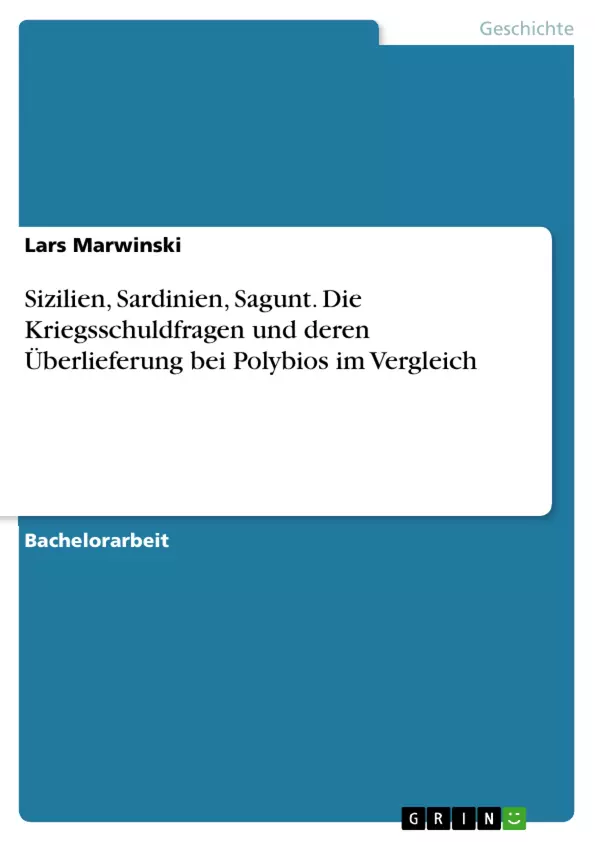Aus heutiger Sicht ist das Verhältnis der beiden antiken Staaten Karthago und Rom vor allem durch deren kriegerische Auseinandersetzungen geprägt, die als die drei Punischen Kriege in die Geschichte eingingen. Berühmt sind dabei die Vorstellungen der Überquerung der Alpen und des Sieges bei Cannae im Zweiten Punischen Krieg, mit „Hannibal als respektable[m] Feldherren“ (Zimmermann 2010). Insgesamt ereigneten sich die Konflikte innerhalb von etwas mehr als einhundert Jahren. Aber wie konnte es in einem so kurzen Zeitraum zu drei Kriegen zwischen den beiden Parteien kommen?
Diese Frage impliziert zugleich die Suche nach einem Schuldigen, welche vor allem durch die Kontroversen über die Kriegsschuld an den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts n. Chr. einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte. Der Wirtschaftsexperte Possony postuliert sogar, dass die Kriegsschuldfrage „von größter politischer Bedeutung“ sei, da sie sowohl das innen- als auch außenpolitische Handeln beeinflussen sowie den Nationalismus in positiver wie negativer Form begünstigen könne (Possony 1968).
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Kriegsschuld bzw. die Rollen Roms und Karthagos in den jeweiligen Situationen zu bestimmen und sie miteinander zu vergleichen, was allerdings nur auf Grundlage der polybianischen Überlieferung möglich ist. Polybios‘ Werk gilt als maßgebliche Quelle für die damaligen Gegebenheiten.
Folgender Ablauf bietet sich also an: Nach der Präsentation von Polybios‘ Werk und Schaffen werden die drei Krisensituationen kurz vorgestellt, um im nächsten Schritt die Sichtweise des griechischen Historiographen im Hinblick auf die Situationen und die jeweilige Kriegsschuld herauszuarbeiten. Im nächsten Abschnitt sollen diese Sichtweisen hinterfragt werden, sodass mithilfe der Ergebnisse selbst beantwortet werden kann, wer die jeweiligen Akteure waren bzw. wer größere Schuld an den Kriegen trägt. Im letzen Teil kommt es zum Vergleich der drei Situationen unter der Berücksichtigung der jeweiligen Kriegsschuld und ihrer Überlieferung bei Polybios. Am Ende soll offengelegt werden, wer die juristische Hauptverantwortlichkeit für die Kriegsausbrüche trägt. Dennoch wird auch der moralische Aspekt nicht komplett außer Acht gelassen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Polybios von Megalopolis
- Präsentation der Krisensituationen
- Sizilien
- Sardinien
- Sagunt
- Die Kriegsschuld nach Polybios
- Sizilien
- Sardinien
- Sagunt
- Erörterung der Kriegsschuld
- Die Kriegsschuld des Ersten Punischen Krieges
- Die Kriegsschuld der Sardinienkrise
- Die Kriegsschuld des Zweiten Punischen Krieges
- Vergleich der drei Vorkriegssituationen und deren Überlieferung bei Polybios
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage der Kriegsschuld in den drei Punischen Kriegen zwischen Rom und Karthago. Sie untersucht die Überlieferung dieser Konflikte durch den griechischen Historiker Polybios und analysiert seine Sichtweise auf die jeweiligen Kriegsschuldfragen. Durch einen Vergleich der drei Krisensituationen auf Sizilien, Sardinien und Sagunt soll untersucht werden, wer die Hauptverantwortung für den Ausbruch der Kriege trägt.
- Analyse der Kriegsschuldfrage in den drei Punischen Kriegen
- Untersuchung der Überlieferung dieser Konflikte durch Polybios
- Vergleich der Krisensituationen auf Sizilien, Sardinien und Sagunt
- Bestimmung der Hauptverantwortung für den Ausbruch der Kriege
- Analyse der Rolle Roms und Karthagos in den jeweiligen Krisensituationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Verhältnis zwischen Rom und Karthago ist geprägt durch die drei Punischen Kriege. Die Arbeit befasst sich mit der Frage der Kriegsschuld und analysiert die Sichtweise des griechischen Historikers Polybios. Es werden drei Krisensituationen auf Sizilien, Sardinien und Sagunt vorgestellt, die zum Ausbruch der Kriege führten.
- Forschungsstand: Die Beziehung von Rom und Karthago wurde in der historischen Forschung bereits seit dem Nationalsozialismus untersucht. Im Fokus stehen die drei Punischen Kriege und die Frage nach den Kriegsschuldigen. Neben der Geschichte Roms wurde auch die Geschichte Karthagos eingehend analysiert, wobei die Frage nach der Kriegsschuld in der Regel getrennt voneinander behandelt wurde.
- Polybios von Megalopolis: Polybios war ein griechischer Historiker, dessen Werk eine maßgebliche Quelle für die Geschichte der Punischen Kriege ist. Seine Sichtweise auf die Kriegsschuldfrage wird in der Arbeit detailliert analysiert.
- Präsentation der Krisensituationen: Die Arbeit stellt die Situationen auf Sizilien, Sardinien und Sagunt kurz vor, die zum Ausbruch der Punischen Kriege führten.
- Die Kriegsschuld nach Polybios: Die Arbeit untersucht Polybios' Sichtweise auf die Kriegsschuld in den drei Krisensituationen.
- Erörterung der Kriegsschuld: Die Arbeit hinterfragt Polybios' Sichtweise und analysiert die Rolle Roms und Karthagos in den einzelnen Krisensituationen.
- Vergleich der drei Vorkriegssituationen und deren Überlieferung bei Polybios: Die Arbeit vergleicht die drei Krisensituationen und untersucht, wer die Hauptverantwortung für den Ausbruch der Kriege trägt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Kriegsschuld, Punische Kriege, Rom, Karthago, Polybios, Sizilien, Sardinien, Sagunt, Imperialismus, Historiografie, Antike, Kriegserklärung, Friedensvertrag.
Häufig gestellte Fragen
Wer trug laut Polybios die Schuld am Ersten Punischen Krieg?
Die Arbeit untersucht die Situation auf Sizilien und analysiert, inwiefern Rom durch sein Eingreifen in Messana die rechtliche und moralische Verantwortung für den Konflikt übernahm.
Was war die Sardinienkrise?
Nach dem Ersten Punischen Krieg nutzte Rom eine Schwäche Karthagos aus, um Sardinien zu annektieren. Polybios betrachtet dies als einen klaren Rechtsbruch Roms und als Hauptursache für den karthagischen Zorn.
Welche Rolle spielte Sagunt beim Ausbruch des Zweiten Punischen Krieges?
Die Belagerung Sagunts durch Hannibal war der formale Kriegsgrund. Die Arbeit hinterfragt jedoch, ob die tiefere Schuld bei der karthagischen Racheabsicht oder der römischen Expansionspolitik lag.
Ist Polybios eine objektive Quelle für die Kriegsschuldfrage?
Obwohl Polybios als maßgebliche Quelle gilt, wird in der Arbeit diskutiert, inwiefern seine Nähe zu römischen Kreisen seine Darstellung der Ereignisse beeinflusst haben könnte.
Was ist der Unterschied zwischen juristischer und moralischer Kriegsschuld?
Die juristische Schuld bezieht sich auf den Bruch von Verträgen, während die moralische Schuld die tieferliegenden Motive und Provokationen beider Mächte betrachtet.
- Citation du texte
- Lars Marwinski (Auteur), 2016, Sizilien, Sardinien, Sagunt. Die Kriegsschuldfragen und deren Überlieferung bei Polybios im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345672