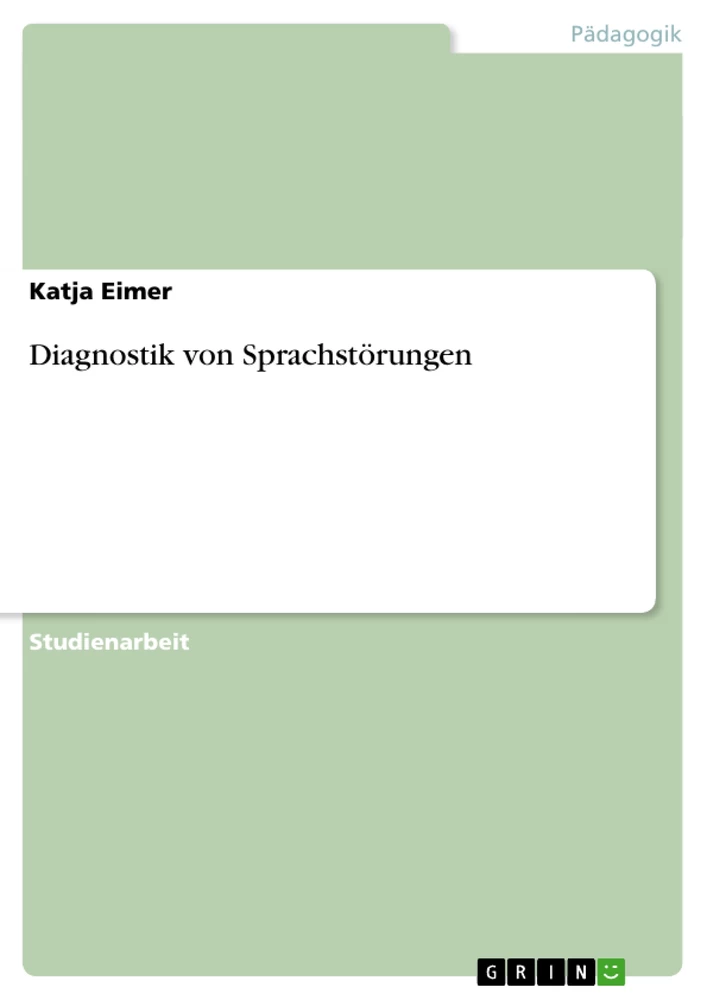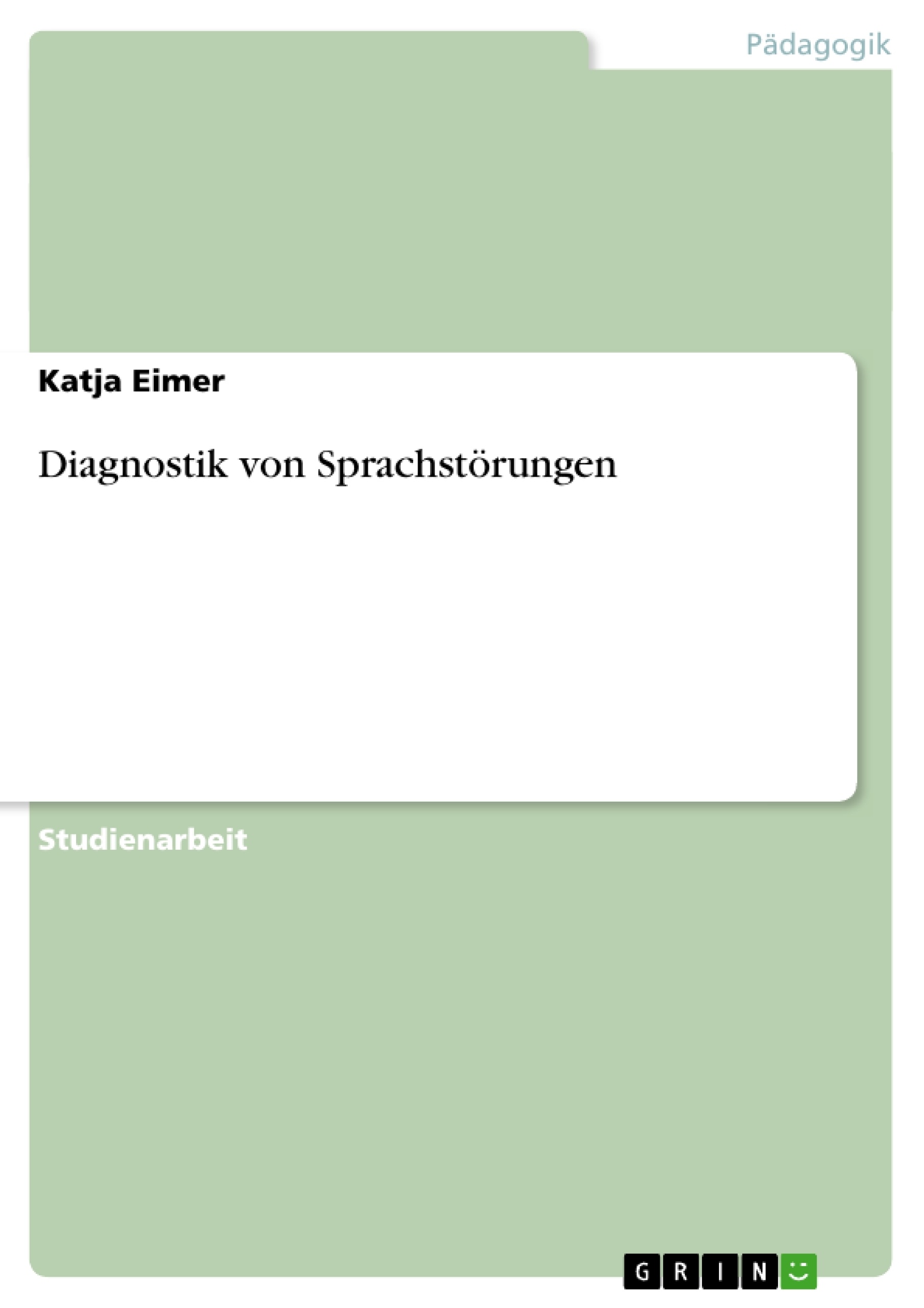Befasst man sich mit der Diagnostik von Sprachbehinderungen so ist es sinnvoll, sich zunächst etwas genauer mit dem Begriff der Diagnostik an sich zu beschäftigen. Das Wort Diagnostik kommt ursprünglich aus dem griechischen (Diagnosis) und meint soviel wie unterscheiden, auseinandersetzen. Die Menschen haben seit jeher das Bedürfnis, die Vielfalt und Komplexität des Lebens einzuschätzen und zu beurteilen, um so eine gewisse Orientierung und Rechtfertigung zu ermöglichen. Schlägt man den Begriff im Lexikon nach (Brockhaus), so findet man dort, dass es sich bei Diagnostik um die methodische Erfassung eines Gegenstandes oder einer Person handelt. Im Sinne von sonderpädagogischer Diagnostik spricht man von der Erkenntnis der Beschaffenheit eines psychischen oder physischen Zustandes. Diagnoseverfahren kommen ursprünglich aus der Medizin, haben also pädagogikfremde Wurzeln. Diagnostik bedient sich immer verschiedener Methoden, auf die im folgenden kurz eingegangen werden soll. Zunächst befasst sich der Diagnostiker immer mit der Vorgeschichte der Krankheit (Anamnese), wobei sowohl medizinische Aspekte der Krankheitsgeschichte berücksichtigt werden, als auch psychologische, wie z.B. die Erhellung des Lebenslaufs. Zudem werden objektive Daten über die Entwicklung (z.B. Geburt, Schule...) beleuchtet. Im nächsten Schritt handelt es sich um die sogenannte Exploration, wobei es hauptsächlich darum geht, die bei der Anamnese schon herausgefunden Erkenntnisse genauer zu erforschen bzw. zu hinterfragen. Meist geschieht dies in Form von Interviews und Gesprächen, wobei nicht nur der Kranke selbst, sondern auch häufig Angehörige bzw. Personen, die viel Kontakt mit dem Kranken haben, befragt werden. Daran schließt sich meist eine Verhaltensbeobachtung an, bei der es zum einen um die reine Beobachtung des Kranken geht, zum anderen aber auch Tests durchgeführt werden, um bestimmte Verhaltensweisen gezielt beobachten zu können. Da es sehr schwierig ist aufgrund subjektiver Schilderungen des Betroffenen eine objektive Diagnose zu erstellen, bedient sich die Diagnostik immer häufiger standardisierter Tests.
Inhaltsverzeichnis
- I. Diagnostik
- II. Sonderpädagogische Diagnostik
- III. Förderdiagnostik
- 1. Förderdiagnostik ist keine Platzierungsdiagnostik.
- 2. Förderdiagnostik ist Situationsdiagnostik.
- 3. Förderdiagnostik ist Lernprozessdiagnostik
- 4. Förderdiagnostik ist kompetenz- und defektorientiert
- IV. Testverfahren
- V. Diagnostik von Sprachbehinderungen
- VI. Sprachstörungen
- 1. Spracherwerbsstörungen
- 2. Sprechablaufstörungen
- 3. Aussprachestörungen
- VII. Ursachen von Sprachstörungen
- 1. sensorische Störungen
- 2. frühkindliche Hirnschädigungen
- 3. milieubedingte Einflüsse
- VIII. Heidelberger Sprachentwicklungs-Test (HSET)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Diagnostik von Sprachstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Dabei liegt der Fokus auf dem Vergleich verschiedener Ansätze, insbesondere der klassischen medizinischen Diagnostik und der neueren Förderdiagnostik.
- Definition und Abgrenzung von Diagnostik und Sonderpädagogischer Diagnostik
- Das Konzept der Förderdiagnostik und ihre Bedeutung für die Sprachförderung
- Ursachen und Arten von Sprachstörungen
- Bedeutung von standardisierten Tests in der Sprachdiagnostik
- Der Heidelberger Sprachentwicklungs-Test (HSET) als Beispiel für ein bewährtes Diagnostik-Instrument
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Dieser Abschnitt erläutert den Begriff der Diagnostik im Allgemeinen und beleuchtet ihre methodischen Ansätze. Dazu zählen Anamnese, Exploration, Verhaltensbeobachtung und standardisierte Tests.
- Kapitel II: Das Kapitel behandelt die sonderpädagogische Diagnostik im Vergleich zur klassischen medizinischen Diagnostik. Der Fokus liegt auf der Prognose von Verhaltensweisen und der Erkennung von Beeinträchtigungen, die die Entwicklung des Kindes beeinflussen können.
- Kapitel III: Dieses Kapitel stellt die Förderdiagnostik als Alternative zur Selektionsdiagnostik vor. Es werden die zentralen Prinzipien und Vorteile der Förderdiagnostik anhand von Beispielen erläutert.
- Kapitel IV: Dieser Abschnitt bietet einen Einblick in verschiedene Testverfahren, die in der Diagnostik von Sprachstörungen eingesetzt werden.
- Kapitel V: Der Text geht auf die Diagnostik von Sprachbehinderungen ein und erklärt die Bedeutung der frühzeitigen Erkennung und Förderung.
- Kapitel VI: In diesem Kapitel werden verschiedene Arten von Sprachstörungen detailliert beschrieben, darunter Spracherwerbsstörungen, Sprechablaufstörungen und Aussprachestörungen.
- Kapitel VII: Das Kapitel beleuchtet verschiedene Ursachen von Sprachstörungen, wie sensorische Störungen, frühkindliche Hirnschädigungen und milieubedingte Einflüsse.
Schlüsselwörter
Diagnostik, Sprachstörungen, Sonderpädagogische Diagnostik, Förderdiagnostik, Spracherwerbsstörungen, Sprechablaufstörungen, Aussprachestörungen, Heidelberger Sprachentwicklungs-Test (HSET), standardisierte Tests, Anamnese, Exploration, Verhaltensbeobachtung, Kindliche Entwicklung, Sprachförderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen klassischer und Förderdiagnostik?
Die klassische Diagnostik dient oft der Platzierung (Selektion), während die Förderdiagnostik den Lernprozess begleitet und gezielt Stärken und Defizite ermittelt, um individuelle Hilfe zu planen.
Welche Arten von Sprachstörungen gibt es?
Man unterscheidet primär zwischen Spracherwerbsstörungen, Sprechablaufstörungen (z.B. Stottern) und Aussprachestörungen.
Was sind die Ursachen für Sprachstörungen bei Kindern?
Ursachen können sensorische Störungen (z.B. Hörprobleme), frühkindliche Hirnschädigungen oder milieubedingte Einflüsse (mangelnde sprachliche Anregung) sein.
Was ist der Heidelberger Sprachentwicklungs-Test (HSET)?
Der HSET ist ein standardisiertes Testverfahren zur umfassenden Diagnostik des Sprachstandes bei Kindern, um gezielte Fördermaßnahmen abzuleiten.
Welche Methoden nutzt die Sprachdiagnostik?
Dazu gehören die Anamnese (Vorgeschichte), Exploration (Gespräche mit Angehörigen), Verhaltensbeobachtung und standardisierte Tests.
- Arbeit zitieren
- Katja Eimer (Autor:in), 2003, Diagnostik von Sprachstörungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34618