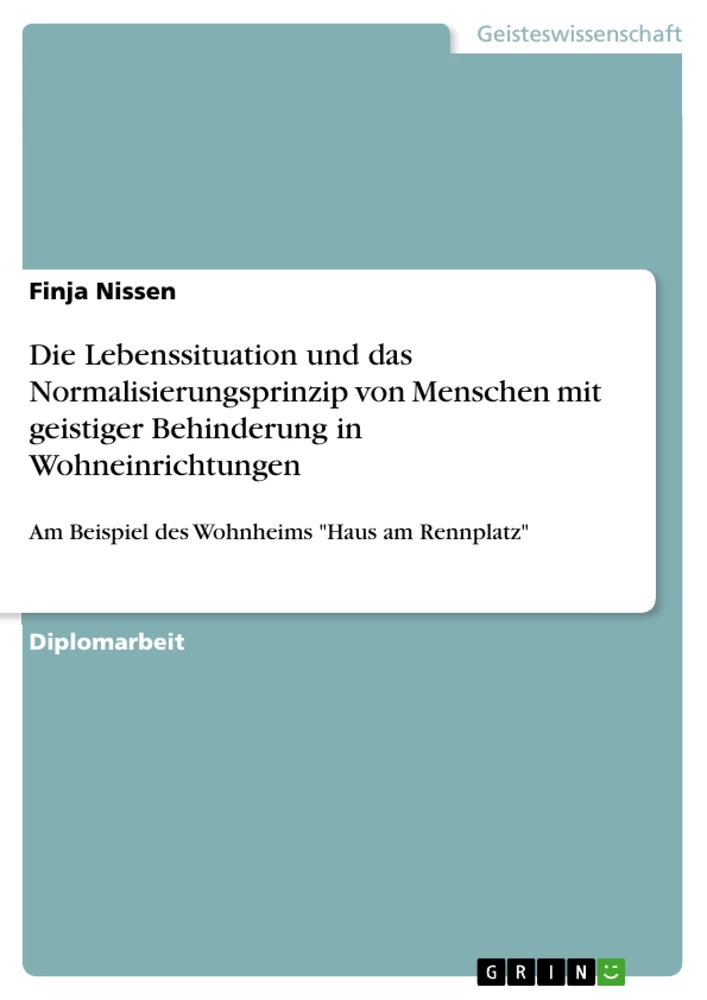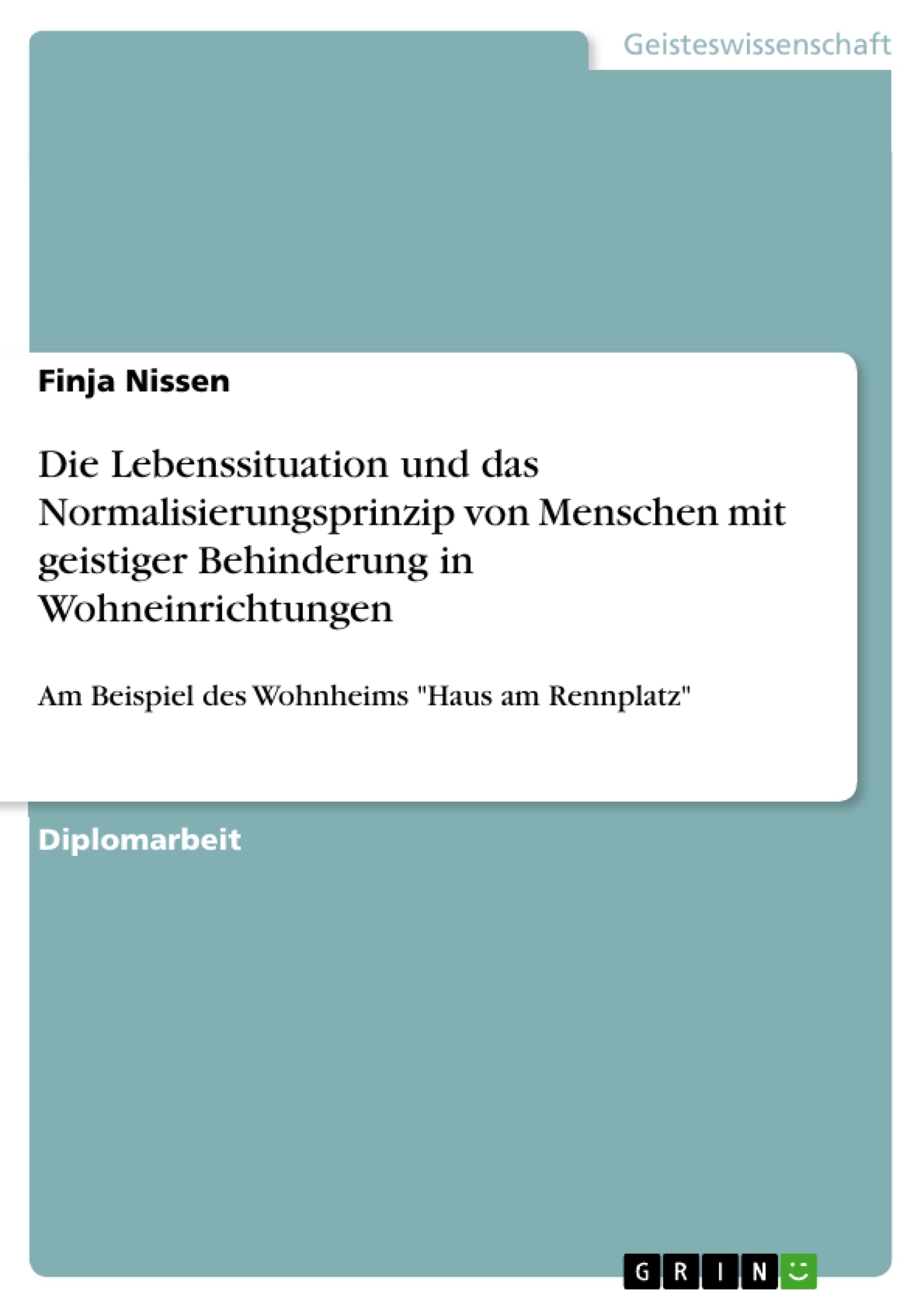Etwa 3,8 Prozent aller Menschen mit Behinderung sind geistig behindert. Des Weiteren hatte ich in meinem Studium erfahren, dass die Mehrheit geistig behinderter Menschen in Wohnheimen lebt. Diese Tatsache ließ mich darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen geistig behinderte Menschen heute in Wohneinrichtungen leben. Ferner war mein Vertiefungsgebiet „Nichtaussonderung von Menschen mit Behinderung (Inclusion)“ Grund für die Themenwahl. Oft habe ich in Vorlesungen und Seminaren Erschreckendes über die Zustände in Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung gehört. Gibt es diese Zustände heute noch? Wie leben Menschen mit geistiger Behinderung Anfang des 21. Jahrhunderts in Wohnheimen?
In diesem Zusammenhang stieß ich auf das Normalisierungsprinzip, welches sich mit der Gestaltung der Lebensbedingungen von (geistig) behinderten Menschen auseinandersetzt. Dieses Prinzip wurde vor etwas 40 Jahren entwickelt. Diese Zeitspanne war ein weiterer Grund dieses Thema zu wählen, da ich wissen wollte, welche Anwendung das Normalisierungsprinzip heute noch findet und wie sich die Anwendung auf die Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung auswirkt. Auch die Diskussionen, die rund um das Normalisierungsprinzip geführt wurden und werden, weckten mein Interesse. Und nicht zuletzt die Möglichkeit eine „praktische“ Untersuchung zum Thema zu machen, veranlasste mich das nun hier vorliegende Thema für meine Diplomarbeit zu wählen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Teil I: Theoretische Grundlagen
- Geistige Behinderung - Begriffserklärung und Personenkreis
- Medizinischer Ansatz
- Psychologischer Ansatz
- Juristischer Ansatz
- Pädagogischer Ansatz
- Internationale Klassifikation nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
- Definition der Amerikanischen Vereinigung für Menschen mit geistiger Behinderung ("American Association of Mental Retardation - AAMR")
- Behinderung als Isolation und Abhängigkeit von Hilfe
- Zusammenfassung
- Daten und Fakten zur Lebens- und Wohnsituation geistig behinderter Menschen
- Übersicht
- Gründe für eine Heimaufnahme
- Größen der Wohneinrichtungen
- Größen der Wohngruppen
- Zusammenfassung
- Normalität
- Veränderung der Normalität und des Normalitätsempfindens
- Das Normalisierungsprinzip
- Normalisierung
- Entstehung des Normalisierungsprinzips
- Bestandteile des Normalisierungsprinzips
- Aufnahme des Normalisierungsprinzips in Deutschland
- Kritische Betrachtung des Normalisierungsprinzips
- Wolfensberger
- Erweiterung des Normalisierungsprinzip durch Wolfensberger
- Kritische Betrachtung der Weiterentwicklung des Normalisierungsprinzips durch Wolfensberger
- Zusammenfassung Teil I
- Geistige Behinderung - Begriffserklärung und Personenkreis
- Teil II: Bestandsaufnahme der Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohnheimen unter der Berücksichtigung des Normalisierungsprinzips
- Erläuterung der Planung und Vorbereitung der Bestandsaufnahme
- Beschreibung der Wohneinrichtung „Haus am Rennplatz“
- Konzeption der Wohneinrichtung „Haus am Rennplatz“
- Auswertung des Fragebogens zur Umsetzung des Normalisierungsprinzips
- Auswertung der MitarbeiterInnenbefragung
- Auswertung der BewohnerInnenbefragung
- Eigene Beobachtungen im Wohnheim „Haus am Rennplatz“
- Zusammenfassung der Ergebnisse und persönliche Einschätzung
- Teil III: Resümee und Reflexion der Diplomarbeit
- Resümee und Reflexion der Auseinandersetzung mit dem Thema
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen unter Berücksichtigung des Normalisierungsprinzips. Ziel ist es, die praktische Umsetzung des Prinzips im konkreten Beispiel des Wohnheimes „Haus am Rennplatz“ zu analysieren und zu bewerten.
- Begriff und Definition geistiger Behinderung
- Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen
- Das Normalisierungsprinzip und seine Anwendung
- Kritische Betrachtung des Normalisierungsprinzips
- Auswertung der Befragungsergebnisse im Wohnheim "Haus am Rennplatz"
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit der Lebenssituation geistig behinderter Menschen in Wohneinrichtungen auseinanderzusetzen, insbesondere im Kontext des Normalisierungsprinzips. Die Erfahrungen im Studium und die häufig gehörte Kritik an den Zuständen in solchen Einrichtungen bilden den Ausgangspunkt der Arbeit. Das Alter des Normalisierungsprinzips (ca. 40 Jahre) sowie die damit verbundenen Diskussionen stellen weitere Gründe für die Themenwahl dar.
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Gliederung der Diplomarbeit, die in drei Teile geteilt ist: theoretische Grundlagen, Bestandsaufnahme im „Haus am Rennplatz“ und Resümee. Sie gibt einen knappen Überblick über die einzelnen Kapitel und deren Inhalte. Es wird angekündigt, dass der Begriff der geistigen Behinderung erklärt, Daten zur Wohnsituation präsentiert und das Normalisierungsprinzip detailliert erläutert und kritisch betrachtet werden soll.
Teil I: Theoretische Grundlagen: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Er definiert den Begriff der geistigen Behinderung aus verschiedenen Perspektiven (medizinisch, psychologisch, juristisch, pädagogisch) und stellt die internationale Klassifikation der WHO sowie die Definition der AAMR vor. Weiterhin werden Daten und Fakten zur Lebens- und Wohnsituation geistig behinderter Menschen präsentiert, der Begriff "Normalität" diskutiert und das Normalisierungsprinzip detailliert erläutert, inklusive seiner Entstehung, Bestandteile, Aufnahme in Deutschland und kritischer Betrachtung. Schließlich wird die Erweiterung des Prinzips durch Wolfensberger und eine kritische Auseinandersetzung damit behandelt.
Teil II: Bestandsaufnahme der Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohnheimen unter der Berücksichtigung des Normalisierungsprinzips: Dieser Teil der Arbeit präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung im Wohnheim „Haus am Rennplatz“. Es wird die Planung und Durchführung der Untersuchung (einschließlich der verwendeten Methoden wie Fragebögen und Beobachtungen) beschrieben. Die Ergebnisse der Befragungen von Bewohnern und Mitarbeitern sowie eigene Beobachtungen werden ausgewertet und im Hinblick auf die Umsetzung des Normalisierungsprinzips analysiert.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Normalisierungsprinzip, Wohneinrichtung, Inklusion, Lebensqualität, Partizipation, Befragung, empirische Untersuchung, „Haus am Rennplatz“, Wolfensberger.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Lebenssituation geistig behinderter Menschen in Wohneinrichtungen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Normalisierungsprinzips. Der Fokus liegt auf der Analyse und Bewertung der praktischen Anwendung dieses Prinzips in einem konkreten Wohnheim, dem "Haus am Rennplatz".
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte: die Definition von geistiger Behinderung aus medizinischer, psychologischer, juristischer und pädagogischer Sicht, die Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen, das Normalisierungsprinzip und seine kritische Betrachtung, sowie die Auswertung von Befragungen und Beobachtungen im "Haus am Rennplatz".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Diplomarbeit ist in drei Teile gegliedert: Teil I behandelt die theoretischen Grundlagen, einschließlich der Definition von geistiger Behinderung und einer detaillierten Erläuterung des Normalisierungsprinzips. Teil II präsentiert die empirische Untersuchung im "Haus am Rennplatz", einschließlich der Methoden, der Auswertung von Fragebögen und Beobachtungen und der Analyse der Ergebnisse im Kontext des Normalisierungsprinzips. Teil III beinhaltet ein Resümee und eine Reflexion der gesamten Arbeit.
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung angewendet?
Die empirische Untersuchung im "Haus am Rennplatz" umfasste Fragebögen für Bewohner und Mitarbeiter sowie eigene Beobachtungen der Autorin. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Methoden wurden ausgewertet und analysiert.
Welche Ergebnisse wurden im "Haus am Rennplatz" erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der Befragungen und Beobachtungen im "Haus am Rennplatz" werden im zweiten Teil der Arbeit detailliert dargestellt und im Hinblick auf die Umsetzung des Normalisierungsprinzips analysiert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und eine persönliche Einschätzung der Autorin werden ebenfalls präsentiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Geistige Behinderung, Normalisierungsprinzip, Wohneinrichtung, Inklusion, Lebensqualität, Partizipation, Befragung, empirische Untersuchung, "Haus am Rennplatz", Wolfensberger.
Was ist das Normalisierungsprinzip und wie wird es in der Arbeit betrachtet?
Das Normalisierungsprinzip wird in der Arbeit ausführlich erläutert, einschließlich seiner Entstehung, Bestandteile und seiner kritischen Betrachtung. Die Arbeit untersucht auch die Erweiterung des Prinzips durch Wolfensberger und analysiert, wie das Prinzip im "Haus am Rennplatz" praktisch umgesetzt wird.
Welche Definition von geistiger Behinderung wird verwendet?
Die Arbeit betrachtet die geistige Behinderung aus verschiedenen Perspektiven (medizinisch, psychologisch, juristisch, pädagogisch) und bezieht sich auf die internationale Klassifikation der WHO sowie die Definition der AAMR.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist die Analyse und Bewertung der praktischen Umsetzung des Normalisierungsprinzips im Wohnheim "Haus am Rennplatz". Es soll untersucht werden, inwieweit die Lebensbedingungen der Bewohner den Prinzipien der Normalisierung entsprechen.
- Quote paper
- Finja Nissen (Author), 2004, Die Lebenssituation und das Normalisierungsprinzip von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34624