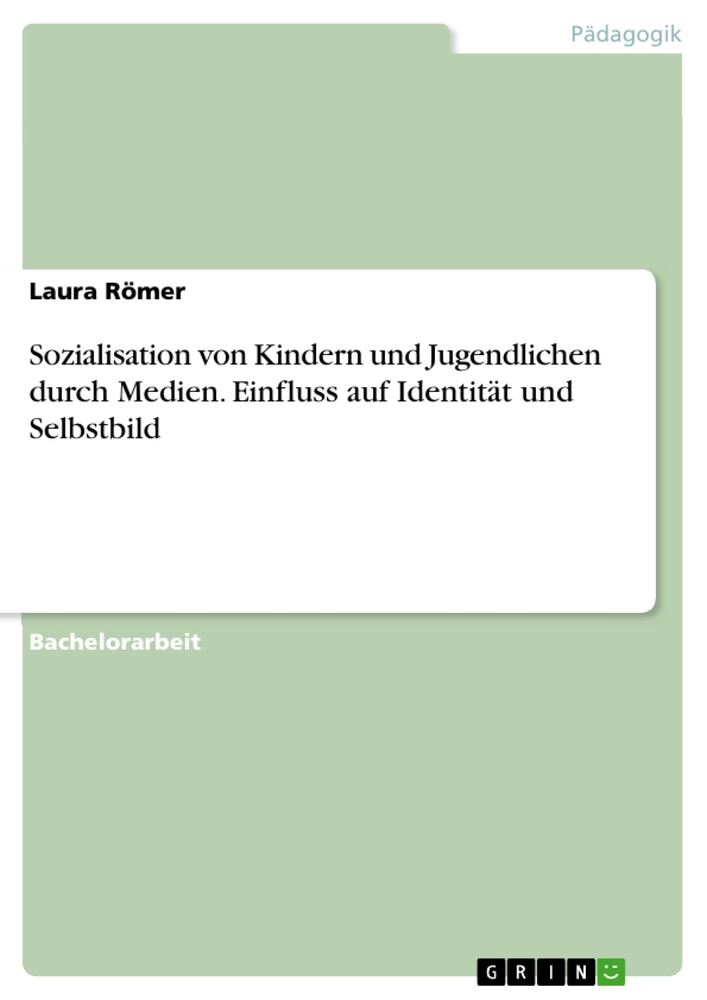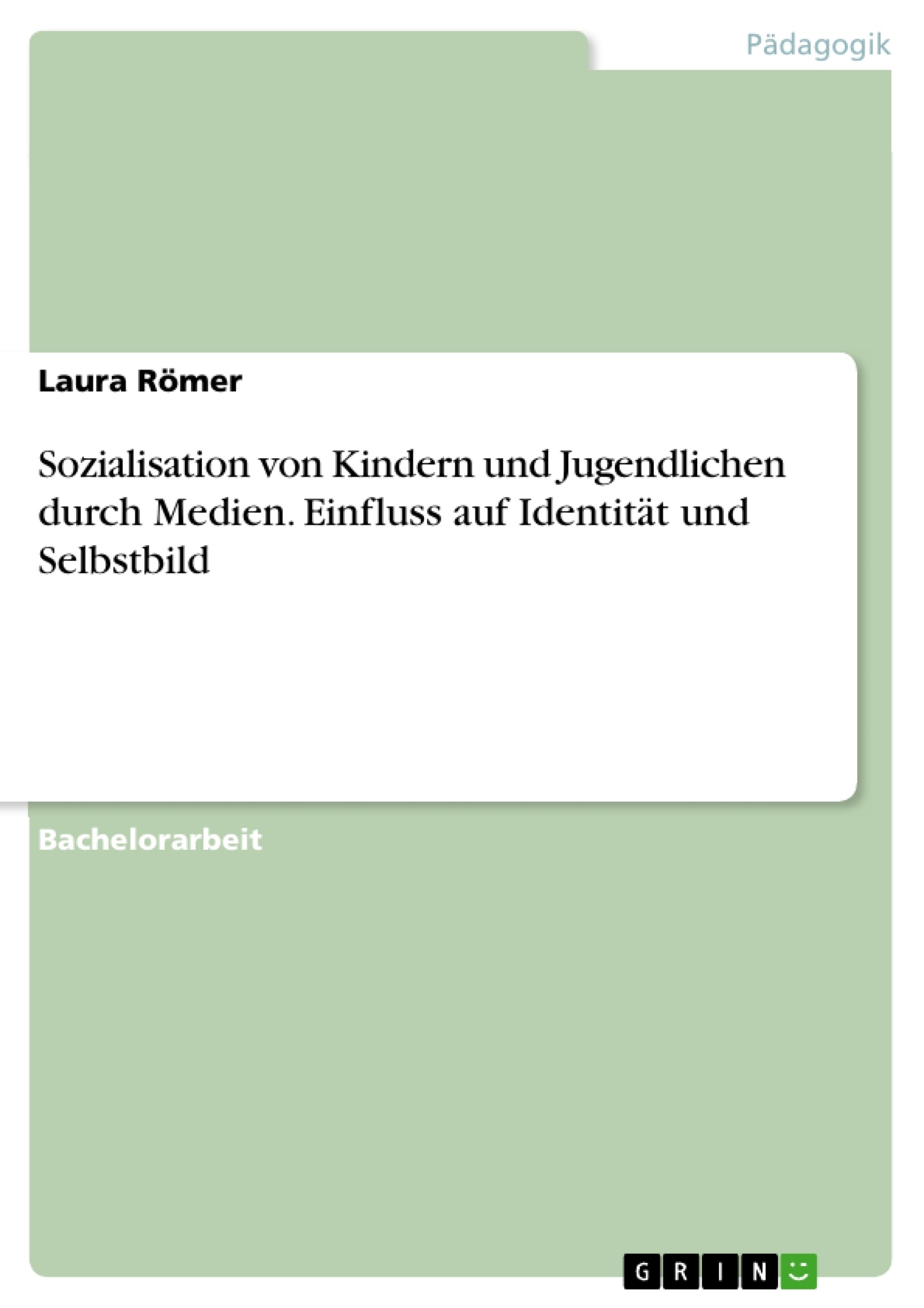Ziel der Arbeit ist es, herauszuarbeiten, ob es einen Einfluss von Internet und Fernsehen als Sozialisationsinstanz auf Kinder und Jugendliche gibt. Die leitende Fragestellung hierfür lautet: „Wie wirken Medien auf die Identität und das Selbstbild von sechs bis 18-Jährigen ein?“
„Sozialisation ist ohne Medien heute nicht mehr denkbar, sie erfolgt unter dem Vorzeichen eines aktiven Subjekts, das sich von klein auf mit den Medien auseinandersetzt, sie zielgerichtet nutzt und sich ihrer bedient, um seinen Alltag zu gestalten, das Wert und Normgefüge seines sozialen Umfeldes, seine Persönlichkeits- und Lebenskonzepte zu prüfen, zu erweitern, zu revidieren.“ Diese Aussage zeigt beispielhaft, die (immer größer) werdende Rolle von Medien bei der Sozialisation. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Internet, das neben Recherche und Kommunikation viele Möglichkeiten der Selbstdarstellung bietet. Neben dem Internet ist das Fernsehen ein wichtiges Medium für die Menschheit und somit auch für diese Untersuchung.
Oft wird die Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche von Wissenschaftlern kritisch beurteilt. Medien hätten z.B. einen negativen Einfluss auf die Entwicklung und seien manipulativ. Die Sozialisationsforschung beschäftigt sich allerdings kaum mit der zunehmenden Bedeutung von Medien. Die Ursache für diese Vernachlässigung sieht Dagmar Hoffmann darin, dass man in der Sozialisationsforschung die Auffassung hat, dass es keine wechselseitige Beziehung zwischen den Menschen und den Medien gibt und Medien somit nicht als Sozialisationsinstanz gezählt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen der Begriffe „Sozialisation“ und „Identität“
- Sozialisation
- Identität
- Mediennutzung
- Einführung
- Zahlen, Daten und Fakten zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen anhand von der Shell-, KIM-, und JIM- Studie
- Art der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
- Funktionen von Medien
- Einfluss von Medien auf die Sozialisation und Identitätsbildung
- Vorstellung der gewählten Medien
- Fernsehen
- Internet /Smartphone
- Aktuelle Studienergebnisse
- Facebook als Beispiel sozialer Netzwerke
- Beliebtheit von „Pseudo- Dokus“: Familien im Brennpunkt und Berlin- Tag und Nacht als Beispiel
- ,,Scripted- Reality- Serien
- ,,Familien im Brennpunkt“
- ,,Berlin-Tag & Nacht“
- Das Fernsehen als negativer Einfluss auf das Selbstbild und Auslöser für Essstörungen
- Das Frauenbild in den Medien
- Fernsehen als Auslöser für Essstörungen
- Zwischenfazit
- Vorstellung der gewählten Medien
- Stichprobenuntersuchung in einer offenen Kinder- und Jugendeinrichtung
- Umfrage
- Fragebogenerstellung
- Auswertung
- Fazit der Umfrage
- Interviews
- Fazit der Interviews im Zusammenhang mit der Umfrage
- Umfrage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie Medien die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen beeinflussen und welche Auswirkungen dies auf deren Identität und Selbstbild hat. Der Fokus liegt dabei auf den Medien Fernsehen und Internet, da diese in der heutigen Gesellschaft eine bedeutende Rolle im Alltag von Heranwachsenden spielen.
- Der Einfluss von Medien auf die Sozialisation und Identitätsbildung
- Die Rolle des Fernsehens und des Internets als Sozialisationsinstanzen
- Die Auswirkungen von Medienkonsum auf das Selbstbild und die Identität von Kindern und Jugendlichen
- Die Bedeutung von aktuellen Studien und empirischen Daten
- Die Rolle von sozialen Netzwerken, wie z.B. Facebook, in der Identitätsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die Relevanz der Medien im Kontext der Sozialisation heraus und beleuchtet die Forschungslücke, die diese Arbeit zu schließen versucht. Kapitel 2 definiert die Begriffe „Sozialisation“ und „Identität“ und erläutert deren Relevanz im Zusammenhang mit der Mediennutzung. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und liefert Zahlen, Daten und Fakten sowie eine detaillierte Beschreibung der Art und Funktionen von Medien. Kapitel 4 analysiert den Einfluss von Medien, insbesondere Fernsehen und Internet, auf die Sozialisation und Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen. Der Einfluss von „Pseudo- Dokus“ wie „Familien im Brennpunkt“ und „Berlin- Tag und Nacht“ auf die Identitätsentwicklung wird untersucht. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse einer Stichprobenuntersuchung in einer offenen Kinder- und Jugendeinrichtung, die mithilfe von Umfragen und Interviews die Erfahrungen und Perspektiven von Jugendlichen in Bezug auf Mediennutzung und Identitätsbildung erfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Sozialisation und Identitätsbildung im Kontext der Mediennutzung. Schlüsselbegriffe sind: Mediensozialisation, Identitätsentwicklung, Selbstbild, Fernsehen, Internet, soziale Netzwerke, „Pseudo- Dokus“, Stichprobenuntersuchung, Jugendforschung.
- Quote paper
- Laura Römer (Author), 2016, Sozialisation von Kindern und Jugendlichen durch Medien. Einfluss auf Identität und Selbstbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346360