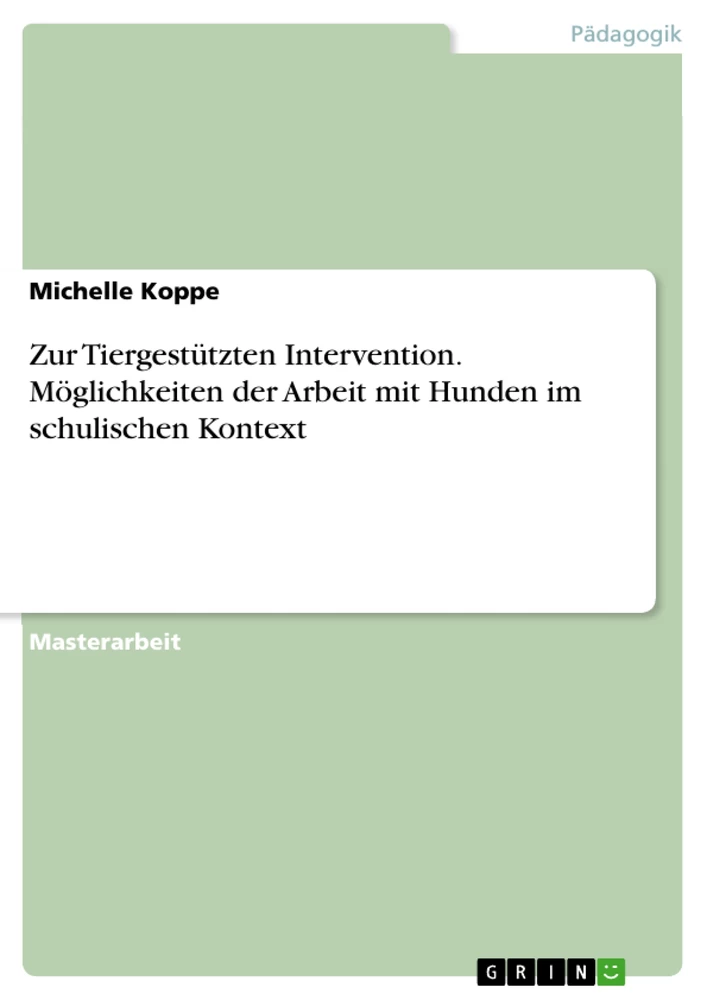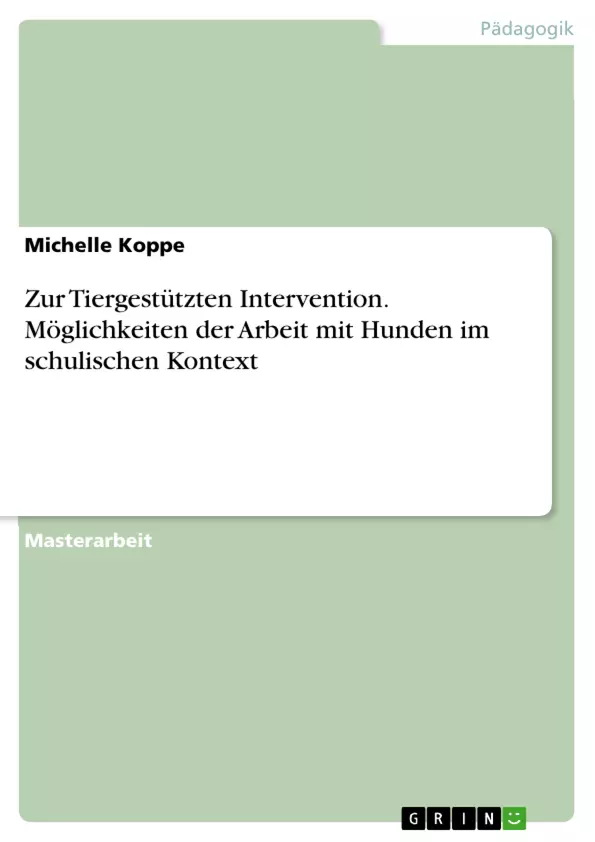Tiere in der Schule. Lange Zeit war dies eine undenkbare Vorstellung. Maximal ein Aquarium, vielleicht ein kleiner Hamster, der gemeinsam von der Klasse gepflegt und gefüttert wurde, fanden Einzug in ein Klassenzimmer. Doch immer vertrauter wird die Idee, auch große Tiere, die nicht in Käfigen, Terrarien oder Aquarien gehalten werden, in ein Klassenzimmer einziehen zu lassen. Generell scheinen die Menschen dem Gedanken, einem Tier die pädagogische oder therapeutische Arbeit zu überlassen, aufgeschlossener zu sein – das zeigt zumindest die Fülle an Literatur und Seminarangeboten zu diesem Thema. Vermehrt werden Schulen von Hunden besucht, oder ein Lehrer bringt seinen bzw. ihren Vierbeiner mit in die Schule – nicht nur um den Hund nicht zu Hause allein lassen zu müssen, sondern auch um ihn in die Arbeit zu integrieren, denn ein Tier kann eine sehr positive Wirkung auf eine Schülergemeinschaft haben. Der Einsatz von Tieren wird als neue, frische Methode betrachtet.
Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, über Tiergestützte Intervention zu informieren, vorhandene Problematiken der Anerkennung aufzuzeigen und in einem praktischen Selbstversuch die Wirkung eines Hundes auf einen Klassenverband zu untersuchen.
„Tiere können den Umgang mit Menschen nicht ersetzen. Doch gerade dort, wo das menschliche Umfeld versagt, leisten sie Unglaubliches“ (Kotzina, 2011, S. 181).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Theorien der Mensch-Tier-Beziehung
- 2.1.1 Biophilie
- 2.1.2 Du-Evidenz
- 2.1.3 Bindungs-Theorie
- 2.2 Besonderheiten der Mensch-Tier-Beziehung
- 2.2.1 Anthropomorphisierung
- 2.2.2 Kommunikation
- 2.2.3 Interaktion
- 2.3 Wirkung von Tieren
- 2.3.1 Tiere bauen Brücken
- 2.3.2 Tiere motivieren
- 2.3.3 Tiere unterstützen Selbstständigkeit
- 2.3.4 Tiere unterstützen Sozialkompetenzen
- 3. Zur Tiergestützten Intervention
- 3.1 Begriffsbestimmungen
- 3.2 Qualifikation und Anerkennung
- 3.3 Was kann ein Hund in der Schule leisten?
- 3.3.1 Vorschläge zur praktischen Arbeit mit dem Hund
- 3.3.1.1 Verbesserung von Motorik und Körpergefühl
- 3.3.1.2 Verbesserung des Sozialklimas
- 3.3.1.3 Gewaltprävention
- 3.4 Checkliste
- 4. Ein Schulprojekt mit Hund
- 4.1 Welches Ziel verfolgt das Projekt?
- 4.2 Zum Ablauf des Projektes
- 4.3 Methoden und Dokumentation
- 4.4 Ergebnisse
- 4.5 Interpretation
- 4.6 Fazit des Schulprojektes
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
- Theoretische Fundierung der Mensch-Tier-Beziehung
- Möglichkeiten und Grenzen der Tiergestützten Intervention in der Schule
- Praktische Implementierung eines Schulprojektes mit Hund
- Bewertung der Wirkung des Hundes auf Schüler und Schulgemeinschaft
- Herausforderungen und Perspektiven der Professionalisierung der Tiergestützten Intervention
- Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt die Relevanz und Aktualität der Tiergestützten Intervention im schulischen Kontext dar und gibt einen Überblick über die Themenbereiche der Arbeit. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung von Mensch-Tier-Beziehungen und die Notwendigkeit einer systematischen Analyse und Professionalisierung der Tiergestützten Intervention.
- Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen): Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Theorien der Mensch-Tier-Beziehung, wie der Biophilie-Theorie, der Du-Evidenz und der Bindungs-Theorie. Es untersucht zudem die Besonderheiten der Mensch-Tier-Beziehung, wie Anthropomorphisierung, Kommunikation und Interaktion. Schließlich werden die Wirkungen von Tieren auf den Menschen, wie Brückenbau, Motivation, Unterstützung der Selbstständigkeit und Förderung sozialer Kompetenzen, beleuchtet.
- Kapitel 3 (Zur Tiergestützten Intervention): Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Definitionen und Begriffen der Tiergestützten Intervention, der Qualifikation und Anerkennung sowie den Einsatzmöglichkeiten von Hunden in der Schule. Es werden Vorschläge für die praktische Arbeit mit Hunden in der Schule vorgestellt, die sich auf die Verbesserung von Motorik und Körpergefühl, die Förderung des Sozialklimas und die Gewaltprävention konzentrieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erstellung einer Checkliste für die gelungene Durchführung eines Schulprojektes mit Hund.
- Kapitel 4 (Ein Schulprojekt mit Hund): Dieses Kapitel beschreibt ein konkretes Schulprojekt mit Hund, das von der Autorin durchgeführt wurde. Es werden das Ziel des Projektes, der Ablauf, die Methoden und die Dokumentation sowie die Ergebnisse und Interpretationen des Projektes dargestellt. Die Autorin analysiert die Auswirkungen des Hundes auf die Schüler und die Schulgemeinschaft.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit dem Einsatz von Tieren in der Schule, speziell im Kontext der Tiergestützten Intervention. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung und untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Arbeit mit Hunden im schulischen Kontext. Die Arbeit verfolgt das Ziel, das Potenzial der Tiergestützten Intervention in der Pädagogik aufzuzeigen, bestehende Problematiken der Anerkennung zu beleuchten und mit einem praktischen Selbstversuch die Wirkung eines Hundes auf einen Klassenverband zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Thematik der Tiergestützten Intervention im schulischen Kontext und beinhaltet Themen wie Mensch-Tier-Beziehung, Biophilie, Du-Evidenz, Bindungs-Theorie, Anthropomorphisierung, Kommunikation, Interaktion, Wirkung von Tieren, Schulhund, Pädagogik, Sozialkompetenz, Gewaltprävention, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Tiergestützte Intervention in der Schule?
Es handelt sich um den gezielten Einsatz von Tieren, meist Hunden, um pädagogische oder therapeutische Ziele im Klassenverband zu unterstützen.
Welche Wirkung haben Hunde auf Schüler?
Tiere können Brücken bauen, die Motivation steigern, die Selbstständigkeit fördern und soziale Kompetenzen sowie das Klassenklima verbessern.
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien wie die Biophilie, die Du-Evidenz und die Bindungstheorie nach Bowlby.
Wie kann ein Hund konkret im Unterricht eingesetzt werden?
Einsatzmöglichkeiten liegen in der Verbesserung der Motorik, der Gewaltprävention und der allgemeinen Förderung des Sozialklimas.
Gibt es eine Checkliste für Schulprojekte mit Hund?
Ja, die Arbeit enthält eine Checkliste zur praktischen Implementierung und Professionalisierung von Tiergestützter Intervention an Schulen.
- Quote paper
- Michelle Koppe (Author), 2015, Zur Tiergestützten Intervention. Möglichkeiten der Arbeit mit Hunden im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346524