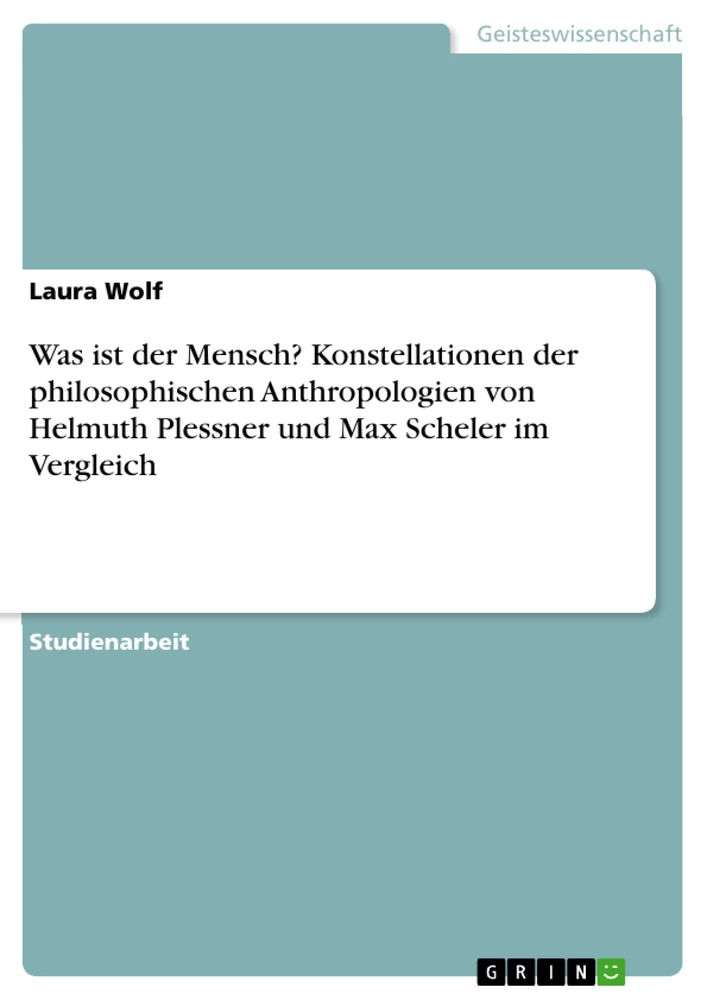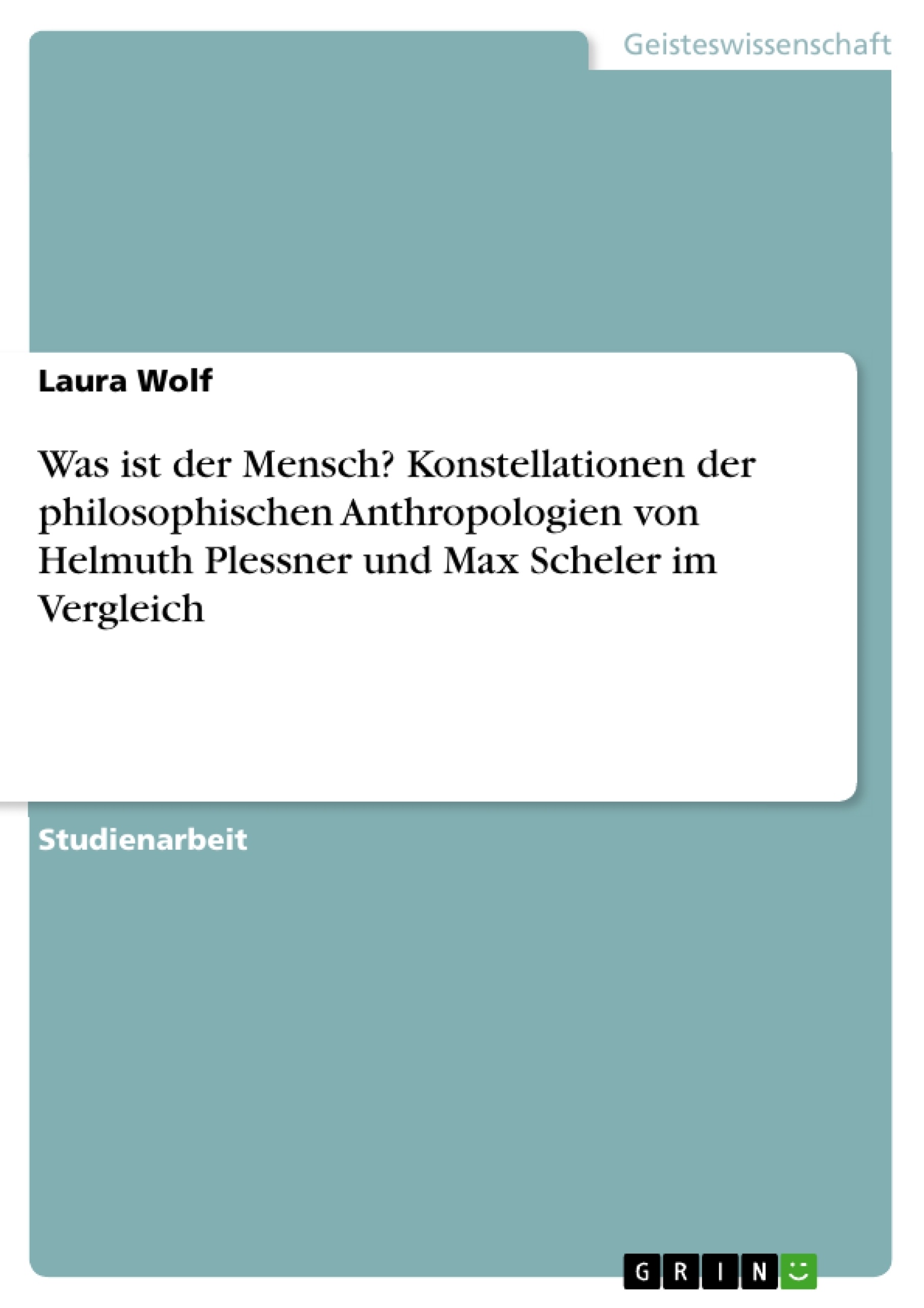Die Intention eines Vegetariers/Veganers sollte trivial sein: sei es einerseits wegen der Haltung der Tiere oder der Tiere selbst. Doch eine vegetarische beziehungsweise vegane Ernährung wirft die Frage auf: „Worin unterscheiden wir uns von den Tieren? Was macht uns als Menschen aus?“
Es handelt sich hierbei um eine Frage der Philosophie. Sie ist im Gegensatz zu der Frage: „Wer ist der Mensch?“ allgemein gehalten und nicht personell abhängig. Die Frage, was wir sind, ist aber nicht erst seit Neustem ein Thema der Menschheit.
Wie definieren Max Scheler und Helmuth Plessner, zwei Autoren des 20. Jahrhunderts, den Menschen? Wie beantworten sie die Frage nach der Stellung des Menschen und in was für einem Verhältnis steht der Mensch zum Tier? Diese Fragen sollen im weiteren Verlauf geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Inhalt
- 1. EINLEITUNG.
- 1.1 PHILOSOPHISCHE ANTHROPOLOGIEN: EIN KURZER HISTORISCHER UMRISS
- 2. MAX SCHELER...
- 2.1 GRUNDPOSITION UND ANSATZ.....
- 2.1.1. GEFÜHLSDRANG..
- 2.1.2. INSTINKT..
- 2.1.3. ASSOZIATIVES GEDÄCHTNIS.
- 2.1.4. PRAKTISCHE INTELLIGENZ
- 2.1.5. GEISTSPHÄRE ..
- 2.2 DER MENSCH UND SEINE STELLUNG IN DER WELT BEI SCHELER.
- 2.3 RESÜMEE.........
- 3. HELMUTH PLESSNER.
- 3.1. GRUNDPOSITION UND ANSATZ..........\n
- 3.2 BELEBTE UND UNBELebte Dinge und das WESEN DER GRENZE
- 3.3 DIE POSITIONALITÄT.
- 3.3.1 DIE OFFENE ORGANISATIONSFORM DER PFLANZE.
- 3.3.2 DIE GESCHLOSSENE ORGANISATIONSFORM DES TIERS.
- 3.4 DIE EXZENTRISCHE POSITIONALITÄT DES MENSCHEN.
- 3.4.1 GESETZ DER NATÜRLICHEN KÜNSTLICHKEIT
- 3.4.2 GESETZ DER VERMITTELTEN UNMITTELBARKEIT
- 3.4.3 GESETZ DES UTOPISCHEN STANDORTES.
- 3.5
- 4. WAS IST DER MENSCH? UNTERSCHIEDE UND GEMEINSAMKEITEN DER PHILOSOPHISCHEN ANTHROPOLOGIEN VON SCHELER UND PLESSNER.
- 5. LITERATURVERZEICHNIS..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der philosophischen Anthropologie und analysiert die Ansätze von Helmuth Plessner und Max Scheler im Vergleich. Die Arbeit zielt darauf ab, die unterschiedlichen Definitionen des Menschen und seiner Stellung in der Welt zu beleuchten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der beiden Philosophen herauszuarbeiten.
- Die Frage nach der Sonderstellung des Menschen im Vergleich zu Tieren
- Die Rolle von Körper und Geist in der philosophischen Anthropologie
- Die Bedeutung der Freiheit und des Selbstbewusstseins für das menschliche Dasein
- Die Grenzen des menschlichen Wissens und Verstehens
- Die philosophische Anthropologie als Grundlage für die ethische und politische Reflexion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der philosophischen Anthropologie und stellt die Relevanz der Frage nach dem Wesen des Menschen heraus. Kapitel 2 befasst sich mit der philosophischen Anthropologie von Max Scheler, indem es seine Grundposition und seinen Ansatz zur Definition des Menschen beschreibt. Hier werden insbesondere seine Gedanken zur Entwicklung der psychischen Kräfte und Fähigkeiten im Verlauf der Evolution beleuchtet. Kapitel 3 widmet sich der philosophischen Anthropologie von Helmuth Plessner. Der Fokus liegt auf Plessners Konzepten der Positionalität und der exzentrischen Positionalität, die die Sonderstellung des Menschen im Verhältnis zum Tier erläutern. Kapitel 4 analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der philosophischen Anthropologien von Scheler und Plessner und diskutiert die jeweiligen Argumente und Ansätze im Detail.
Schlüsselwörter
Philosophische Anthropologie, Max Scheler, Helmuth Plessner, Mensch, Tier, Stellung im Kosmos, Positionalität, Exzentrische Positionalität, Körper, Geist, Selbstbewusstsein, Freiheit, Evolution, Grenzen des Wissens, Ethische Reflexion, Politische Reflexion
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Mensch und Tier bei Max Scheler?
Scheler sieht den Menschen durch die „Geistsphäre“ charakterisiert. Während Tiere durch Gefühlsdrang, Instinkt und praktische Intelligenz geleitet werden, ist der Mensch „weltoffen“ und kann sich von seinen Trieben distanzieren.
Was bedeutet „exzentrische Positionalität“ bei Helmuth Plessner?
Im Gegensatz zum Tier, das „zentrisch“ in seiner Umwelt lebt, kann der Mensch eine Perspektive außerhalb seiner selbst einnehmen. Er ist sich seines Körpers bewusst und lebt in einer Distanz zu sich selbst.
Was ist Plessners „Gesetz der natürlichen Künstlichkeit“?
Es besagt, dass der Mensch von Natur aus darauf angewiesen ist, sich durch Kultur und Technik eine künstliche Umwelt zu schaffen, um überleben zu können.
Wie definieren beide Philosophen die Freiheit des Menschen?
Freiheit entsteht für beide aus der Sonderstellung gegenüber dem Tier: Bei Scheler durch den Geist, bei Plessner durch die exzentrische Lage, die eine Reflexion über das eigene Dasein ermöglicht.
Welche Rolle spielt die Evolution in diesen Anthropologien?
Beide nutzen biologische Erkenntnisse ihrer Zeit, um die psychischen und physischen Stufen des Lebens (Pflanze, Tier, Mensch) abzugrenzen und die Einzigartigkeit des Menschen zu begründen.
- Arbeit zitieren
- Laura Wolf (Autor:in), 2016, Was ist der Mensch? Konstellationen der philosophischen Anthropologien von Helmuth Plessner und Max Scheler im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346538