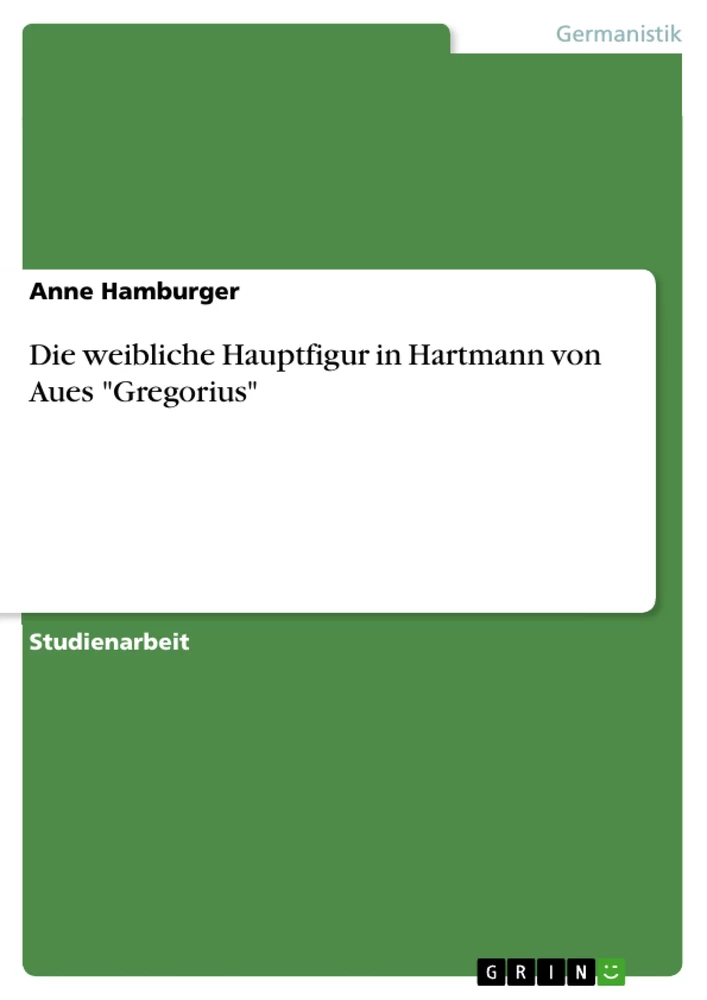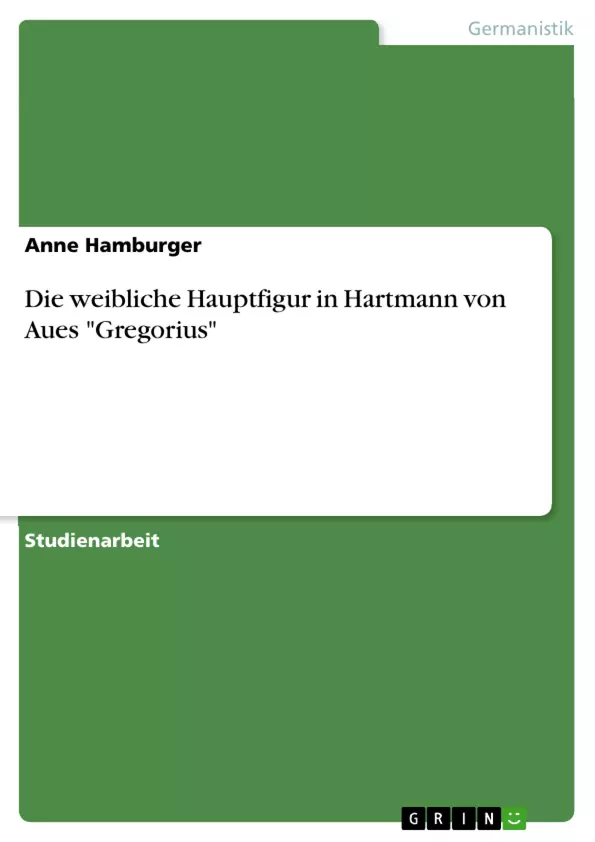Die Hauptaufgaben der Frau sowie die gesellschaftliche und rechtliche Stellung war im Mittelalter eine gänzlich andere als im heutigen Zeitalter. Im Wesentlichen bestand ihre Aufgabe darin Kinder zu gebären, aufzuziehen und den Haushalt zu führen. Den Frauen wurde somit eine untergeordnete Rolle zugeschrieben. Sie hatten im Gegensatz zum Mann eine schwächere Rechtsstellung und waren dadurch dem Ehemann oder männlichen Verwandten unterworfen.
Im Alter von 12 bis 16 Jahren heirateten die Frauen beziehungsweise wurden durch die Befugnis ihres Vaters mit einem Mann verheiratet. In der Trauungsformel hieß es, dass die Ehefrau ihrem Ehemann untertan ist. Dies bedeutet, dass der Gatte die Vormundschaft über seine Frau besitzt. Dies wirkte sich besonders in Rechtsangelegenheiten aus und der Mann hatte das alleinige Nutzungsrecht des ehelichen Vermögens. Trotz dieser untergeordneten Stellung der Frau durften die Männer nicht willkürlich über ihre Ehefrauen entscheiden. Beispielsweise war der Inzest verboten und die vertragliche Bindung mit der Familie seiner Gattin musste eingehalten werden. Jedoch waren diese Regeln und Normen je nach gesellschaftlichem Stand der Frau unterschiedlich stark ausgeprägt. Einer adeligen Frau war es beispielsweise eher möglich einen gewissen Einfluss auszuüben als einer Frau aus den unteren Ständen. In Kriegszeiten war es adeligen Frauen möglich, einen Anteil an der Herrschaftsausübung zu erlangen und als Landesherrin zu fungieren. Somit konnte sie selbst über ihren Besitz und ihr Vermögen bestimmen. Auch wenn die Frau des Adels gewisse Privilegien genießen konnte und ihr ein höherer Status als den Frauen unterer Stände zugebilligt wurde, war ihre gesellschaftliche Stellung unterhalb des Mannes angesiedelt.
Da die weibliche Hauptfigur des „Gregorius“ aus eben solch einer adeligen Gesellschaft stammt, wird die Rolle dieser Frau im Folgenden genauer untersucht. Hierzu wird zunächst auf ihre Namenlosigkeit eingegangen, da die Frau in Hartmann von Aues Werk keinen Namen besitzt. Im Anschluss werden die drei Ausschnitte, in denen die weibliche Hauptfigur auftritt dargestellt wird, behandelt und ihre Funktionen für den Verlauf der Geschichte beschrieben. Hierbei wird erneut auf die unterschiedlichen Bezeichnungen der Frau Bezug genommen. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Arbeit in Kapitel 3 zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die weibliche Hauptfigur in „Gregorius“
- Die Namenlosigkeit
- Der erste Inzest
- Der zweite Inzest
- Zusammenkunft in Rom
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der weiblichen Hauptfigur in Hartmanns „Gregorius“ und untersucht deren Rolle im Kontext des Mittelalters. Der Fokus liegt auf der Analyse der Namenlosigkeit, den inzestuösen Beziehungen und der Darstellung der Frau in ihrer komplexen Funktion innerhalb der Geschichte.
- Die Bedeutung der Namenlosigkeit der weiblichen Hauptfigur
- Die Darstellung der inzestuösen Beziehungen in „Gregorius“
- Die Rolle der Frau im mittelalterlichen Gesellschaftsbild
- Die Funktion der weiblichen Figur für die Entwicklung des Protagonisten
- Die Verbindung von Minne und Religion in Hartmanns Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Dieses Kapitel stellt den historischen Kontext der weiblichen Rolle im Mittelalter vor und beleuchtet die gesellschaftliche und rechtliche Stellung der Frau in dieser Zeit. Die Einleitung dient als Grundlage für die anschließende Analyse der weiblichen Hauptfigur in „Gregorius“.
2. Die weibliche Hauptfigur in „Gregorius“
Der zweite Abschnitt widmet sich der Analyse der weiblichen Hauptfigur und ihrer Bedeutung für die Handlung des Werkes. Dabei wird insbesondere auf ihre Namenlosigkeit, die inzestuösen Beziehungen und ihre Rolle in der Geschichte eingegangen.
2.1 Die Namenlosigkeit
Hier wird untersucht, warum die weibliche Hauptfigur in „Gregorius“ keinen Namen trägt und welche Auswirkungen diese Namenlosigkeit auf die Interpretation des Werkes hat.
2.2 Der erste Inzest
Dieser Abschnitt behandelt den ersten Inzest zwischen Gregorius und seiner Mutter und analysiert die Darstellung dieser Szene im Kontext des mittelalterlichen Werkes.
2.3 Der zweite Inzest
Dieser Abschnitt setzt sich mit dem zweiten Inzest, der Beziehung zwischen Gregorius und seiner Tochter, auseinander und untersucht die Bedeutung dieser Szene für die Handlung.
2.4 Zusammenkunft in Rom
Hier wird die Begegnung von Gregorius und seiner Mutter in Rom analysiert und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Geschichte beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Analyse der weiblichen Hauptfigur in „Gregorius“ konzentriert sich auf die Themen Namenlosigkeit, Inzest, mittelalterliches Frauenbild, Rolle der Frau in der Gesellschaft, Minne, Religion und die Funktion der weiblichen Figur für den Protagonisten.
Häufig gestellte Fragen
Warum hat die weibliche Hauptfigur in Hartmanns "Gregorius" keinen Namen?
Die Namenlosigkeit unterstreicht ihre Rolle als Repräsentantin eines Typus oder Schicksals und kann als literarisches Mittel zur Fokussierung auf die moralische und religiöse Problematik des Werkes gesehen werden.
Welche Stellung hatten Frauen im Mittelalter?
Frauen hatten eine untergeordnete Rechtsstellung und standen unter der Vormundschaft ihres Vaters oder Ehemanns. Adlige Frauen konnten jedoch in Abwesenheit ihrer Männer zeitweise Herrschaftsfunktionen übernehmen.
Wie wird das Thema Inzest im "Gregorius" behandelt?
Das Werk thematisiert zwei Inzestfälle: den zwischen Geschwistern (Gregorius' Eltern) und den zwischen Mutter und Sohn (Gregorius und seine Mutter). Der Inzest dient als Ausgangspunkt für die religiöse Bußthematik.
Was verbindet Minne und Religion in diesem Werk?
Die höfische Liebe (Minne) führt im Werk zu sündhaftem Verhalten, das nur durch tiefe religiöse Buße und göttliche Gnade überwunden werden kann.
Was geschieht bei der Zusammenkunft in Rom?
Nach Jahren der Buße begegnen sich Gregorius (nun Papst) und seine Mutter in Rom wieder. Diese Begegnung symbolisiert die endgültige Vergebung und Erlösung von ihrer Schuld.
- Citar trabajo
- Anne Hamburger (Autor), 2016, Die weibliche Hauptfigur in Hartmann von Aues "Gregorius", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346625