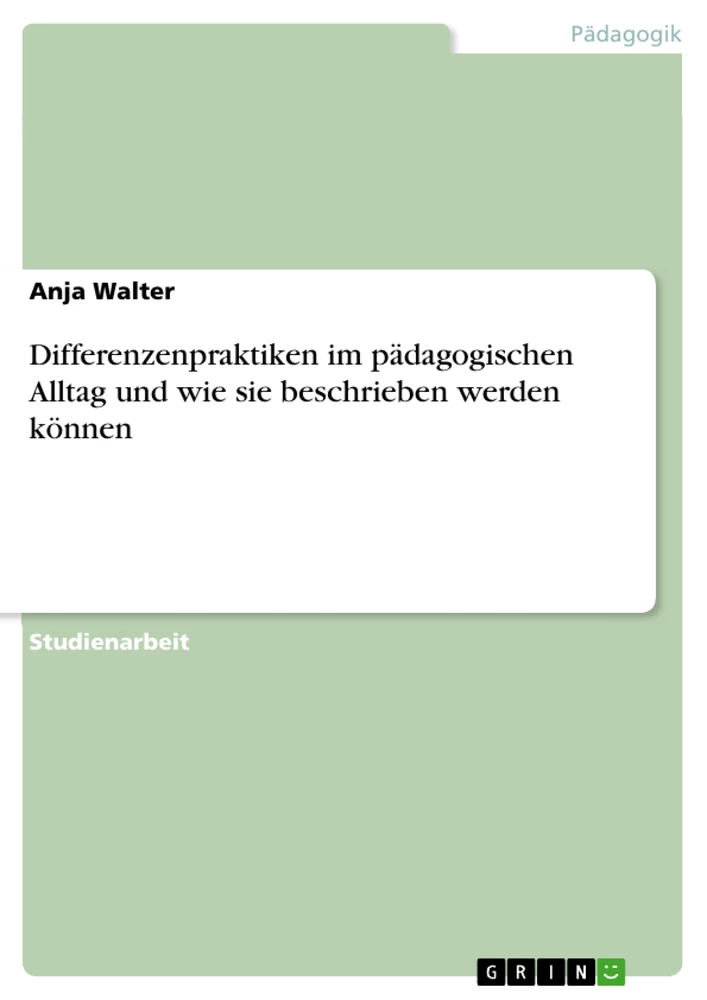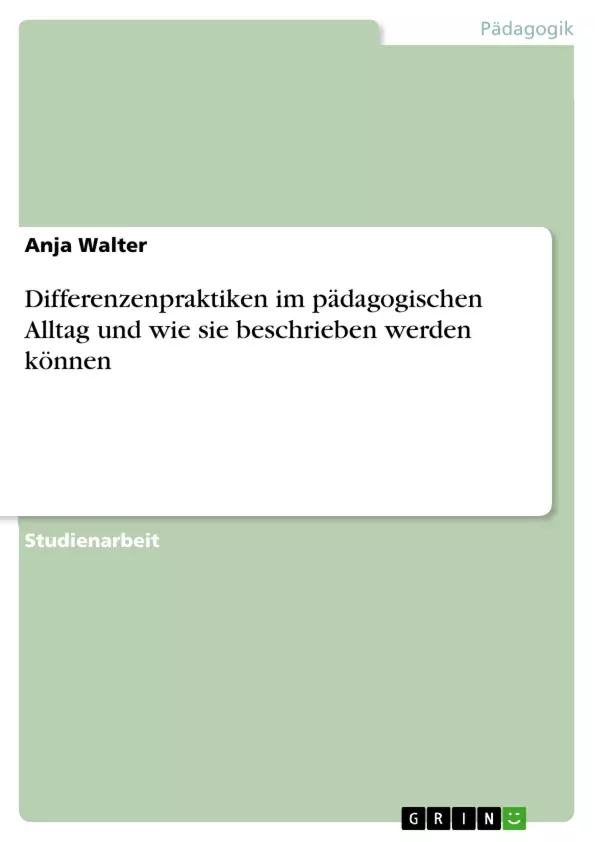Im Zusammenhang mit gegenwärtig intensiven Diskussionen, wie im pädagogischen Alltag Differenzen entstehen und wie diese verhindert werden können, stellt sich die Frage, welchen Einfluss hat beziehungsweise welche Rolle spielt das Lehrpersonal in konkreten pädagogischen Situationen in denen Differenzen sichtbar werden.
Die aktuellen Rahmenbedingungen in Schulklassen und Kindergartengruppen, im deutschsprachigen Raum, sind derzeit so gestaltet, dass Kinder aus verschiedenen Herkunftsverhältnissen ein und dieselbe Klasse beziehungsweise Gruppe besuchen. Das Lehrpersonal ist auf Grund dieser Tatsache täglich vor die Herausforderung gestellt, wie es mit dieser gelebten Heterogenität umgehen soll, kann und darf. In einer modernen, multikulturellen und multidigitalen Welt ist die Gesellschaft nicht nur über den gesamten Erdball miteinander vernetzt und verbunden, sondern sie hat auch die Möglichkeit Menschen, die in unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, kennenzulernen und vor allem mit Ihnen und ihrer ganz eigenen, zu uns selbst divergenten Art des Menschseins, umgehen zu lernen. Im privaten Bereich ist es möglicherweise noch einfach, da die Situation, in den meisten Fällen, frei wählbar ist. Aber wie sieht es in einer Schulklasse oder Kindergartengruppe aus, die bunt zusammen gewürfelt wurde? Wie und warum entstehen in solchen Situationen Differenzpraktiken, wie können diese beschrieben werden und wie kann Ihnen sinnvoll begegnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Überlegungen
- Postkoloniale Theorie
- Das Konzept „Othering“
- Anerkennung
- Konklusion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag durch das Konzept „Othering“ beschrieben und als Othering-Prozess verstanden werden können. Sie analysiert den Einfluss des Lehrpersonals in Situationen, in denen Differenzen sichtbar werden, insbesondere im Kontext der zunehmenden Heterogenität in Schulklassen und Kindergartengruppen.
- Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag
- Das Konzept „Othering“ und seine Anwendung auf pädagogische Situationen
- Die Rolle des Lehrpersonals im Umgang mit Heterogenität
- Postkoloniale Theorie und ihre Relevanz für das Verständnis von Differenz
- Machtverhältnisse und ihre Auswirkung auf die Konstruktion von „Andersheit“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag ein und stellt die zentrale Forschungsfrage: Inwiefern lassen sich Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag durch das Konzept „Othering“ beschreiben und als ein Othering-Prozess verstehen? Sie hebt die Herausforderungen hervor, vor denen das Lehrpersonal im Umgang mit der Heterogenität in multikulturellen und multidigitalen Lerngruppen steht und legt den Fokus auf die Notwendigkeit, diese Praktiken zu verstehen und ihnen sinnvoll zu begegnen. Die Arbeit kündigt die Struktur an: einen theoretischen Teil mit Fokus auf postkoloniale Theorie und das Konzept „Othering“, gefolgt von einer Analyse dieser Theorien im Hinblick auf die Forschungsfrage.
Theoretische Überlegungen: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung dar. Die Postkoloniale Theorie, insbesondere Saids Konzept des Orientalismus, wird als Ausgangspunkt verwendet, um zu zeigen, wie die Konstruktion von „Andersheit“ durch Machtverhältnisse entsteht und wie Wissen über „andere“ Kulturen zur Ausübung von Macht verwendet wird. Das Konzept des „Othering“ wird als zentrales Werkzeug zur Beschreibung von Prozessen der Differenzierung und Ausgrenzung vorgestellt. Der Abschnitt beleuchtet auch die Bedeutung von Anerkennung im Umgang mit Diversität. Der theoretische Rahmen wird als Basis für die spätere Analyse der Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag bereitgestellt.
Schlüsselwörter
Differenzpraktiken, Othering, Postkoloniale Theorie, Pädagogik, Heterogenität, Multikulturalität, Machtverhältnisse, Anerkennung, Differenzierung, kolonialer Diskurs.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, wie Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag mithilfe des Konzepts „Othering“ beschrieben und als Othering-Prozess verstanden werden können. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des Lehrpersonals in Situationen, in denen Differenzen sichtbar werden, besonders im Kontext der zunehmenden Heterogenität in Schulklassen und Kindergartengruppen.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die postkoloniale Theorie, insbesondere Saids Konzept des Orientalismus, um die Konstruktion von „Andersheit“ durch Machtverhältnisse zu beleuchten. Das Konzept „Othering“ dient als zentrales Werkzeug zur Beschreibung von Differenzierungs- und Ausgrenzungsprozessen. Die Bedeutung von Anerkennung im Umgang mit Diversität wird ebenfalls thematisiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag, die Anwendung des Konzepts „Othering“ auf pädagogische Situationen, die Rolle des Lehrpersonals im Umgang mit Heterogenität, die Relevanz der postkolonialen Theorie für das Verständnis von Differenz und die Auswirkung von Machtverhältnissen auf die Konstruktion von „Andersheit“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage formuliert und die Herausforderungen im Umgang mit Heterogenität in multikulturellen und multidigitalen Lerngruppen aufzeigt. Es folgt ein theoretischer Teil, der die postkoloniale Theorie und das Konzept „Othering“ erläutert. Die Arbeit schließt mit einer Konklusion und einem Ausblick.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen Abschnitt mit theoretischen Überlegungen (Postkoloniale Theorie, „Othering“, Anerkennung) und eine Konklusion mit Ausblick. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage. Der theoretische Teil legt die Grundlagen für die Untersuchung dar, indem er postkoloniale Theorie und das Konzept „Othering“ erklärt und die Bedeutung von Anerkennung beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Differenzpraktiken, Othering, Postkoloniale Theorie, Pädagogik, Heterogenität, Multikulturalität, Machtverhältnisse, Anerkennung, Differenzierung, kolonialer Diskurs.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern lassen sich Differenzpraktiken im pädagogischen Alltag durch das Konzept „Othering“ beschreiben und als ein Othering-Prozess verstehen?
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagog*innen, Lehramtsstudierende und alle, die sich mit dem Umgang mit Heterogenität und Diversität im Bildungskontext auseinandersetzen.
- Quote paper
- Anja Walter (Author), 2015, Differenzenpraktiken im pädagogischen Alltag und wie sie beschrieben werden können, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346742