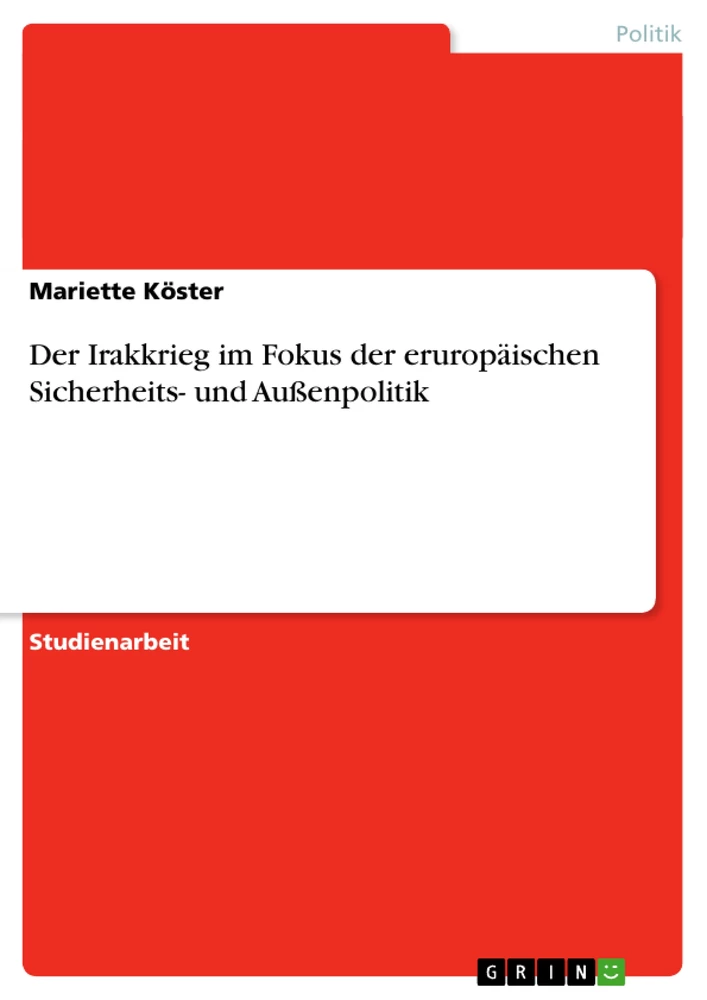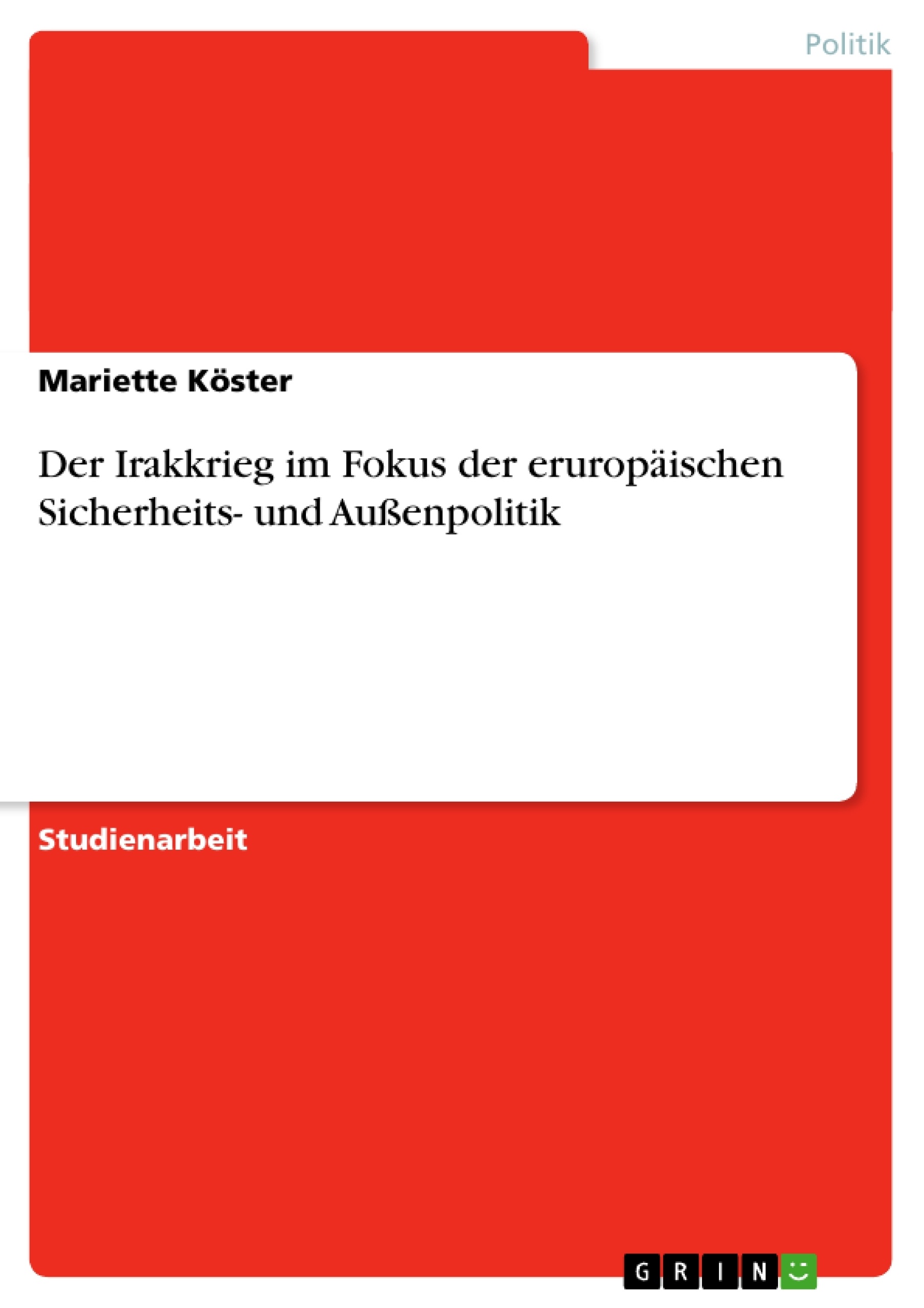Die Terroranschläge auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001 rückten die internationale Sicherheit besonders gegenüber Terroristen und terroristischen Regimes auf die internationale Agenda. Nach dem Krieg gegen die Al Quaida in Afghanistan, gewann auch der Konflikt mit dem Irak neuerlich an Brisanz. Den Anschlägen folgten die Solidaritätsbekundungen aller europäischen Staaten, die den militärischen Einsatz in Afghanistan trotz einer undurchsichtigen Beweislage bedingungslos unterstützten.
Am 8.11.2002 trat die UN- Resolution 1441 in Kraft, die anknüpfend an die vorausgehenden Resolutionen, die den Irak mit Wirtschaftsembargo und politischer Isolation in Folge des Golfkrieges belegten, dem Irak „eine letzte Chance einzuräumen, seinen Abrüstungsverpflichtungen nach den einschlägigen Resolutionen des Rates nachzukommen“. Inspektionen durch Waffeninspekteure sollten überprüfen, ob der Irak gemäß seinen Verpflichtungen seine Bestände an Massenvernichtungswaffen vernichtet hatte, da einmütig von einer Gefahr für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit durch den Irak respektive durch die vermuteten Massenvernichtungswaffen und Langstreckenflugkörper des Iraks ausgegangen wurde. Gleichwohl stand man dem irakischen Volk zu, daß die territoriale Integrität und Souveränität des irakischen Volkes unberührt bleiben sollten.
Abschließend „erinnert der Rat (...) daran, daß der Rat Irak wiederholt vor ernsthaften Konsequenzen gewarnt hat, wenn Irak weiter gegen seine Verpflichtungen verstößt“. Die vage Androhung „ernster Konsequenzen“, mit denen das weitere Handeln der Staatengemeinschaft bei einem Verstoß gegen die Resolution, eine weite Palette von weiteren wirtschaftlichen Sanktionen bis zu militärischem Eingreifen offenließ, führte in der Folge zu einem Disput, inwiefern diese Formulierung hinrei- chend sei, den Krieg gegen den Irak zu legitimieren. Gab es einen Automatismus der kriegerischen Intervention bei Zuwiderhandeln des Iraks? Es kam im Zuge der Inspektionen zu Schwierigkeiten, die den zeitweiligen Abzug der Waffeninspektoren nach sich zog. Diese Inkooperation des Irak stellte in den Augen der USA einen deutlichen Verstoß gegen die Resolution dar, gleichwohl die Waffe ninspekteure keine Waffenarsenale aufspüren konnte, und der Irak in Folge des internationalen Drucks vollständige Kooperation zusagte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Ausgangslage des Irak-Konfliktes
- 2. Diplomatische Erwägungen im Vorfeld des Irak - Krieges
- 2.1 Die Position der USA
- 2.2 Die Position der USA-Befürworter in Europa
- 2.3 Die Position der USA -Gegner in Europa
- 3. Die Europäische Union im Irak-Konflikt
- 3.1 Die Spaltung Europas
- 3.2 Konsequenzen für die Zukunft der europäischen Union
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Irak-Konflikt im Kontext der europäischen Sicherheits- und Außenpolitik. Der Fokus liegt auf den diplomatischen Erwägungen und Positionierungen der verschiedenen Akteure im Vorfeld des Irakkrieges, insbesondere der USA, deren Befürworter und Gegner in Europa, sowie der Europäischen Union.
- Die Ausgangslage des Irak-Konfliktes und die Rolle der UN-Resolution 1441
- Die Position der USA und ihre Argumentation für einen Präventivkrieg
- Die Haltung der europäischen Befürworter der US-amerikanischen Irak-Politik, insbesondere Großbritanniens
- Die Kritik der europäischen Gegner der US-amerikanischen Irak-Politik
- Die Folgen des Irakkonflikts für die europäische Union und die zukünftige Gestaltung der europäischen Sicherheits- und Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Ausgangslage des Irak-Konfliktes, insbesondere die Rolle der UN-Resolution 1441. Diese Resolution, die im Anschluss an den Golfkrieg erlassen wurde, sollte dem Irak „eine letzte Chance einräumen“, seinen Abrüstungsverpflichtungen nachzukommen. Die Resolution sah Inspektionen durch Waffeninspekteure vor, um zu überprüfen, ob der Irak seine Bestände an Massenvernichtungswaffen vernichtet hatte. Die vage Androhung „ernsthafter Konsequenzen“ im Falle eines Verstoßes gegen die Resolution führte zu einem Disput, inwiefern diese Formulierung einen Krieg gegen den Irak rechtfertigte.
Kapitel 2 behandelt die diplomatischen Erwägungen im Vorfeld des Irakkrieges. In Kapitel 2.1 wird die Position der USA dargestellt, die den Irak bereits früh als Gefahr für die nationale Sicherheit betrachtete. Die US-amerikanische Regierung unter George W. Bush argumentierte für einen Präventivkrieg gegen den Irak, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. In Kapitel 2.2 werden die Positionen der europäischen Befürworter der US-amerikanischen Irak-Politik vorgestellt. Zu diesen Staaten gehörten Großbritannien, Spanien, Italien, die Tschechische Republik, Polen, Portugal und Dänemark. Diese Staaten argumentierten mit der Bündnistreue gegenüber den USA, die auf geteilten Werten wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechten basiere. Kapitel 2.3 beleuchtet die Position der europäischen Gegner der US-amerikanischen Irak-Politik. Diese Staaten kritisierten die militärische Intervention im Irak als völkerrechtswidrig und sahen die Gefahr, dass der Krieg zu Instabilität und Terrorismus in der Region führen könnte.
Kapitel 3 befasst sich mit der Rolle der Europäischen Union im Irak-Konflikt. Kapitel 3.1 beleuchtet die Spaltung Europas im Zusammenhang mit dem Irakkrieg. Die EU war in zwei Lager gespalten, wobei die meisten Mitgliedstaaten eine militärische Intervention ablehnten, während einige Länder, allen voran Großbritannien, die US-amerikanische Politik unterstützten. Kapitel 3.2 diskutiert die Folgen des Irakkonflikts für die Zukunft der Europäischen Union. Die Spaltung Europas im Zusammenhang mit dem Irak-Konflikt hat die Frage der Gestaltung der europäischen Sicherheits- und Außenpolitik neu aufgeworfen.
Schlüsselwörter
Irak-Konflikt, europäische Sicherheits- und Außenpolitik, UN-Resolution 1441, Präventivkrieg, Massenvernichtungswaffen, Bündnistreue, Wertegemeinschaft, Spaltung Europas.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für die neue Brisanz im Irak-Konflikt nach 2001?
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 führten zu einer Neubewertung der internationalen Sicherheit gegenüber terroristischen Regimes und Massenvernichtungswaffen.
Welche Rolle spielte die UN-Resolution 1441?
Die Resolution räumte dem Irak eine letzte Chance zur Abrüstung ein und drohte bei Verstößen mit ernsthaften Konsequenzen, was später als Rechtfertigung für den Krieg diskutiert wurde.
Warum war die Europäische Union im Irak-Konflikt gespalten?
Während Staaten wie Großbritannien die USA unterstützten, kritisierten andere Mitglieder wie Deutschland und Frankreich die Intervention als völkerrechtswidrig und gefährlich für die Stabilität.
Was waren die Hauptargumente der USA für den Irakkrieg?
Die US-Regierung argumentierte mit der Notwendigkeit eines Präventivkrieges, um die Gefahr durch vermutete Massenvernichtungswaffen und die Unterstützung von Terrorismus zu eliminieren.
Welche Konsequenzen hatte der Konflikt für die europäische Außenpolitik?
Die Spaltung verdeutlichte die Schwierigkeiten einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Außenpolitik und warf Fragen über die zukünftige transatlantische Zusammenarbeit auf.
- Arbeit zitieren
- Mariette Köster (Autor:in), 2003, Der Irakkrieg im Fokus der eruropäischen Sicherheits- und Außenpolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34677