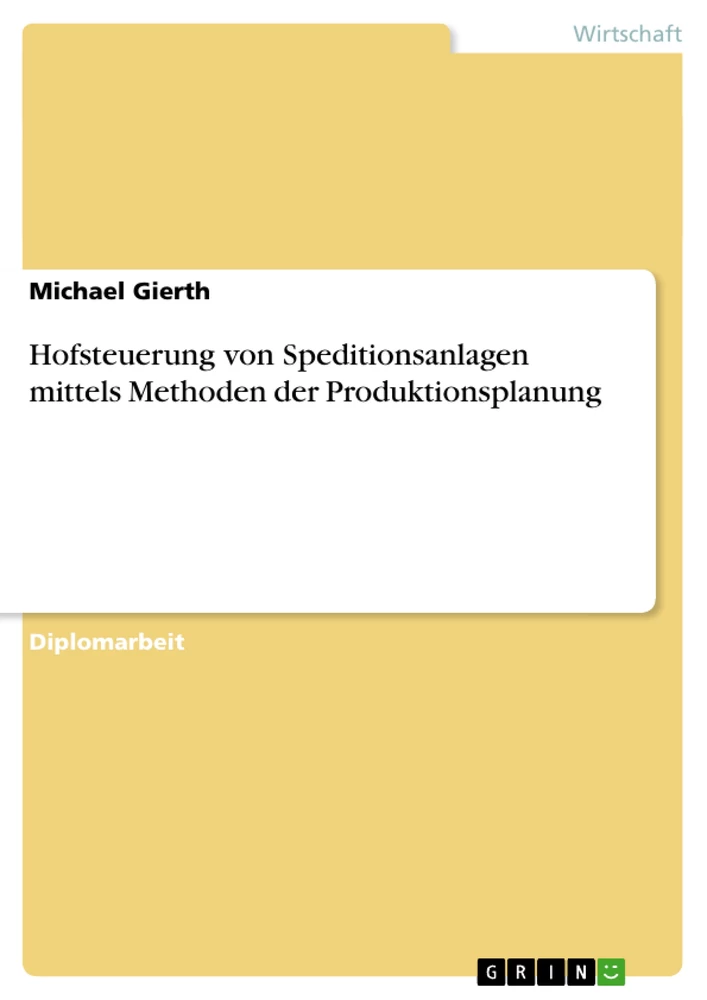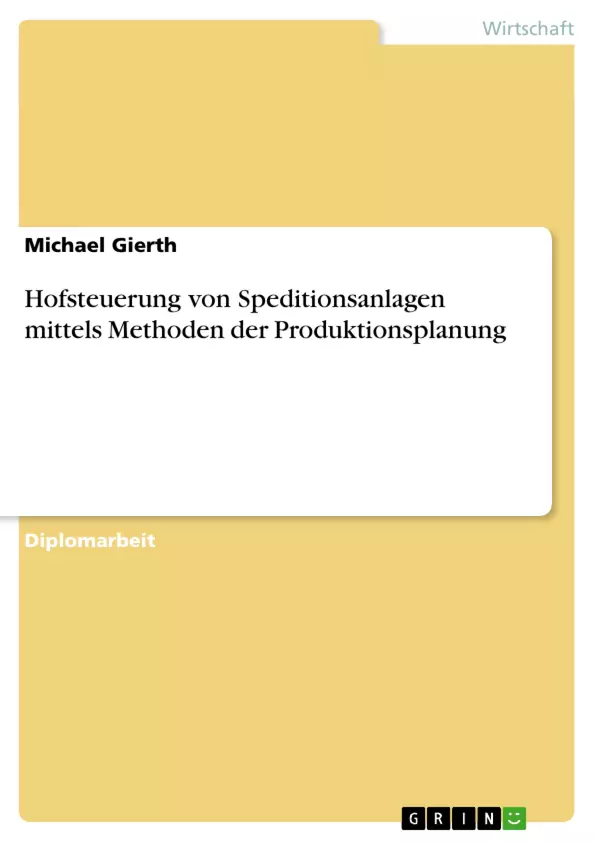Der Güterverkehrsmarkt wird in der heutigen Zeit geprägt durch einen verschärften Kostendruck und hohen Leistungsanforderungen. Die Intensivierung des Wettbewerbs und die gestiegenen Kundenanforderungen verlangen eine intensitätsmäßige Anpassung an die veränderten Marktbedingungen. Die Wertedynamik der Konsumenten sowie Veränderungen im Konsumentenverhalten verstärken den Wettbewerbsdruck auf Industrie und Handel.
ufgrund der zunehmenden Internationalisierung und Globalisierung, des Outsourcings durch verringerte Fertigungstiefen und der Vernetzung der Handelspartner sind die am Güterverkehr beteiligten Unternehmen gezwungen, ihre Distributionssysteme an den veränderten Bedingungen auszurichten. Dabei ergeben sich für die Logistikdienstleister neue Aufgabengebiete, so dass sie sich zunehmend zu Komplettdienstleistern entwickeln. Durch die veränderten Strukturen ergeben sich neue moderne Umschlagplätze und Konzepte, wie zum Beispiel das Cross Docking.
Die veränderten Wettbewerbsbedingungen äußern sich in einer steigenden Kundenpflege. So wird der Servicegedanke verstärkt, was sich in kurzen Lieferzeiten bei sinkenden Sendungsgrößen bemerkbar macht. Zusätzlich beeinflussen ordnungspolitische Maßnahmen, wie zum Beispiel Maut-Gebühren, den Wettbewerb.
Der intensivere Wettbewerb, sowohl national wie international, bewirkt aber gleichzeitig eine Zunahme des Verkehrsaufkommens, insbesondere des Straßengüterverkehrs.
Durch Kooperationen und partnerschaftliches Verhalten der beteiligten Gruppen können effiziente Strukturen und Prozesse aufgebaut werden. In der Transportlogistik lassen sich dadurch die Kundenanforderungen in Form von zugesicherten Lieferzeiten zu einem minimalen Aufwand und maximaler Qualität erfüllen. Durch die Bündelung des Sendungsaufkommens mehrerer Hersteller über einen gemeinsamen Logistikdienstleister ergeben sich Kostendegressionseffekte für alle Kooperationspartner. Die Optimierung der Transportprozesse erfordert dabei den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationssysteme, wodurch sich Kostensenkungspotentiale ergeben. Gleichzeitig wird die Bereitstellung aller relevanten Daten für die Beteiligten sichergestellt. Eine enge physische und informatorische Verbindung zwischen Herstellern, Kunden und Lieferanten sowie eingeschalteten Logistikdienstleistern ist zur Ausschöpfung der Optimierungspotentiale erforderlich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Produktionsplanung
- 2.1 Einordnung in die betriebliche Planung
- 2.2 Teilbereiche der Produktionsplanung
- 2.3 Reihenfolgeplanung
- 2.3.1 Definition, Aufgabe und Voraussetzungen
- 2.3.2 Zielsetzungen und Zielbeziehungen
- 2.3.3 Verfahren der Reihenfolgeplanung
- 2.4 Prioritätsregeln
- 2.4.1 Definition und Aufgabe
- 2.4.2 Klassifikation von Prioritätsregeln
- 2.4.3 Ausgewählte Prioritätsregeln
- 2.4.4 Simulationsergebnisse
- 3. Logistikleistungen und -prozesse in Speditionsbetrieben
- 3.1 Strukturen von Logistiksystemen
- 3.2 Der Spediteur als logistischer Dienstleister
- 3.3 Sammelgutverkehr auf der Straße
- 3.3.1 Eingliederung in die Transportkette
- 3.3.2 Ablaufbeschreibung des Sammelgutverkehrs
- 3.3.3 Anforderungen und Vorteile für die Beteiligten
- 3.4 Umschlags- und Versorgungskonzepte
- 3.4.1 Versorgungskonzepte
- 3.4.2 Umschlagskonzepte
- 4. Hofsteuerung einer Speditionsanlage
- 4.1 Anforderungen an die Speditionsanlage
- 4.2 Steuerung des Hofverkehrs
- 4.3 Hofsteuerung mittels Prioritätsregeln
- 4.3.1 Ausgangssituation
- 4.3.2 Einordnung der Elemente
- 4.3.3 Voraussetzungen und Differenzierungen
- 4.3.4 Modellierungsansatz und Auswahl von Prioritätsregeln
- 4.3.5 Anwendung ausgewählter Prioritätsregeln
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Hofsteuerung von Speditionsanlagen mittels Methoden der Produktionsplanung. Das Hauptziel ist es, ein geeignetes Konzept für die Steuerung des Hofverkehrs in Speditionsbetrieben zu entwickeln, das die Effizienz der Abläufe optimiert. Dabei wird insbesondere auf die Anwendung von Prioritätsregeln aus der Reihenfolgeplanung fokussiert.
- Die Einordnung der Hofsteuerung in die betriebliche Planung
- Die Analyse von Logistikleistungen und -prozessen in Speditionsbetrieben
- Die Anwendung von Prioritätsregeln zur Optimierung der Hofsteuerung
- Die Entwicklung eines Modells zur Simulation und Bewertung verschiedener Prioritätsregeln
- Die praktische Anwendung ausgewählter Prioritätsregeln im Kontext der Hofsteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Hofsteuerung ein und erläutert die Problemstellung sowie den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der Produktionsplanung, insbesondere die Reihenfolgeplanung und die Anwendung von Prioritätsregeln. Kapitel 3 analysiert die Logistikleistungen und -prozesse in Speditionsbetrieben, insbesondere den Sammelgutverkehr auf der Straße und die verschiedenen Umschlags- und Versorgungskonzepte. Kapitel 4 widmet sich der Hofsteuerung einer Speditionsanlage, untersucht die Anforderungen an die Anlage und die Steuerung des Hofverkehrs sowie die Anwendung von Prioritätsregeln zur Optimierung der Abläufe. Schließlich fasst Kapitel 5 die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Hofsteuerung, Speditionsanlage, Produktionsplanung, Reihenfolgeplanung, Prioritätsregeln, Logistik, Sammelgutverkehr, Umschlagskonzepte, Versorgungskonzepte, Effizienzsteigerung, Modellierung, Simulation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Hofsteuerung in Speditionsanlagen?
Das Hauptziel der Hofsteuerung ist die Entwicklung eines Konzepts zur effizienten Steuerung des Hofverkehrs, um Abläufe zu optimieren und Kosten zu senken.
Welche Rolle spielen Prioritätsregeln in der Speditionslogistik?
Prioritätsregeln aus der Produktionsplanung werden eingesetzt, um die Reihenfolge der Abfertigung von Fahrzeugen auf dem Hof zu optimieren und Wartezeiten zu minimieren.
Was versteht man unter Cross Docking?
Cross Docking ist ein modernes Umschlagskonzept, bei dem Waren ohne Zwischenlagerung direkt vom Wareneingang zum Warenausgang umgeschlagen werden.
Wie beeinflussen Maut-Gebühren den Wettbewerb in der Logistik?
Ordnungspolitische Maßnahmen wie Maut-Gebühren erhöhen den Kostendruck auf Logistikdienstleister und zwingen sie zu effizienteren Transportprozessen.
Warum sind Informationssysteme für die Transportoptimierung wichtig?
Moderne Kommunikationssysteme stellen alle relevanten Daten bereit, ermöglichen die Bündelung von Sendungen und helfen dabei, Kostensenkungspotentiale auszuschöpfen.
Was ist Sammelgutverkehr auf der Straße?
Beim Sammelgutverkehr werden Kleinsendungen verschiedener Absender zu einer größeren Transporteinheit zusammengefasst, um Transportkapazitäten besser auszulasten.
- Quote paper
- Michael Gierth (Author), 2004, Hofsteuerung von Speditionsanlagen mittels Methoden der Produktionsplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34692