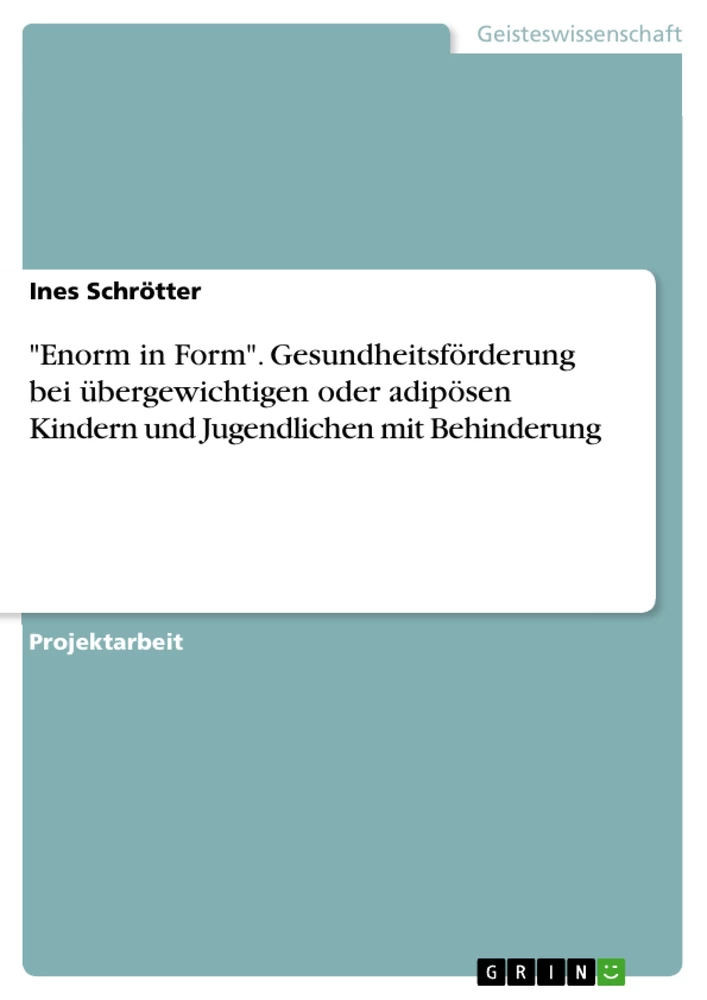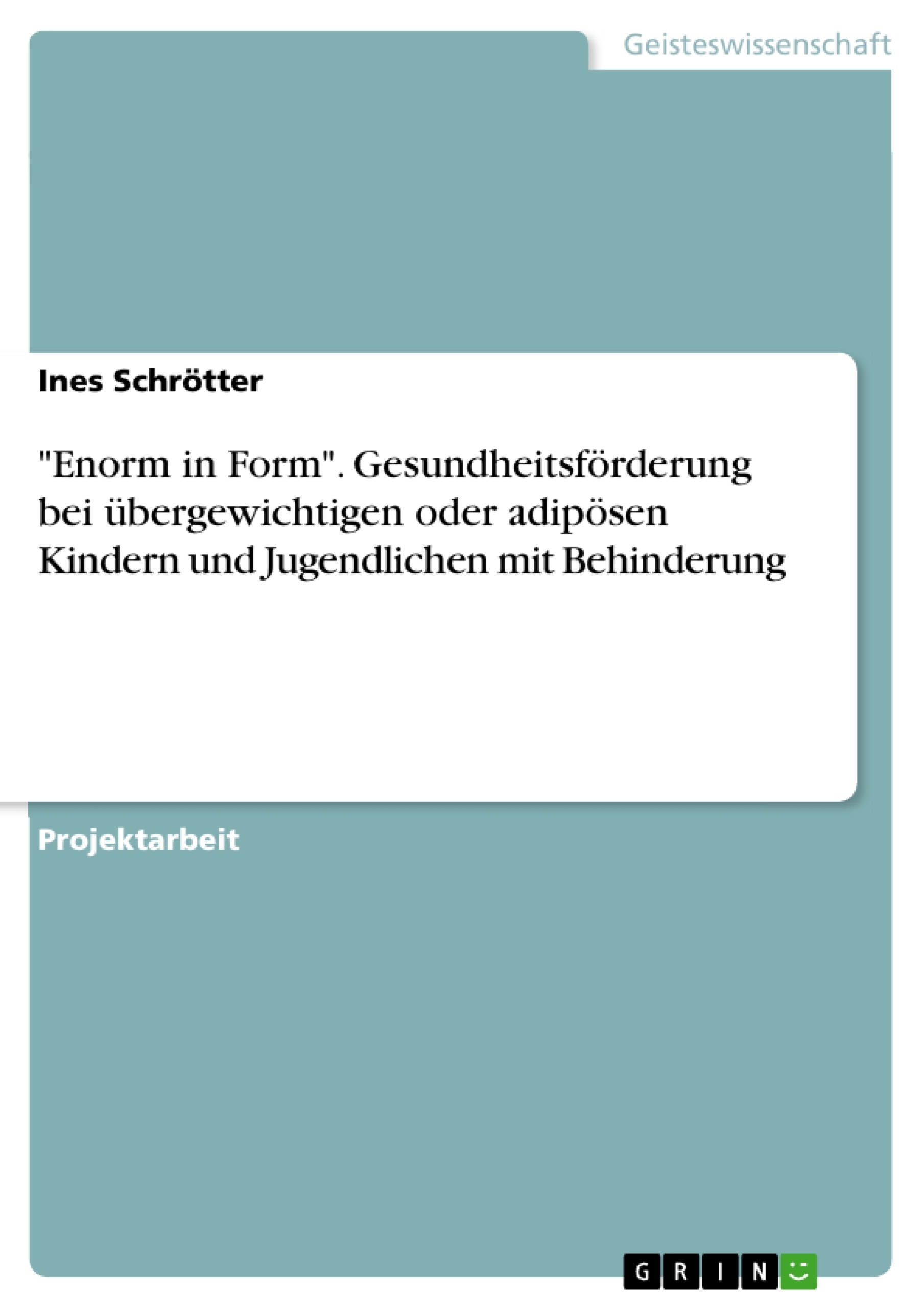Der vorliegende Projektbericht stellt einen Überblick der Planung, Durchführung und Evaluation des Projektes ‚Enorm in Form‘ dar. Dazu wird anfänglich die Ausgangssituation des Projektes inbegriffen der institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen einer Problemanalyse unterzogen sowie der Projektzielgruppe dargelegt. Entsprechend der aufgezeigten Problemanalyse werden die Ziele und Handlungsleitlinien entwickelt, welche der anschließenden Projektplanung zugrunde liegen.
Der darauf folgende Projektverlauf wird mittels eines Projekttagebuches veranschaulicht und evaluiert. In einem abschließenden Fazit wird zusammenfassend dargelegt, ob das Projektwirkungsziel nachhaltig erreicht werden konnte und in welchem Maß die Handlungsschritte des Fachpersonals dazu beigetragen haben. Diese Ergebnisse und Erkenntnisse können dann in den praktischen Arbeitsverlauf mit einbezogen werden, z. B. zur Übertragung auf ähnliche Projekte und deren Optimierung. Der Ergebnisdarstellung folgen Erkenntnisse, wie durch Prozessveränderungen Projekte optimiert und neue Handlungsleitlinien abgeleitet werden können.
Für dieses Projekt werden neben der Betrachtung aus medizinischer Perspektive, ernährungs- und sportwissenschaftliche sowie soziologische Gesichtspunkte unter der Berücksichtigung von Lebensstilaspekten und risikotheoretischen Zusammenhängen von Bedeutung sein. Ferner erfolgen Bezüge- zur gesundheitlichen- und sozialen Chancengleichheit, zum gesundheitsfördernden Ernährungs- und Bewegungsverhalten und zur Verhaltensprävention.
So werden die Lebensumstände der Kinder berücksichtigt und ihre gesamte Familie in das Programm einbezogen. Denn letztlich folgt das Konzept dem Modell der Salutogenese von Antonovsky, welches dem Einzelnen und der Gemeinschaft hilft, ein Gesundheitsgefühl durch Aktivierung gesundheitsfördernder Ressourcen, Kompetenz und Eigenverantwortung zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation für das Projekt,Enorm in Form'
- Organisatorische und institutionelle Rahmenbedingungen
- Problemanalyse
- Projektzielgruppe
- Prozessbezogene Operationalisierung
- Strukturbezogene Operationalisierung
- Projektverlaufsbeschreibung
- Projektorganisation
- Projektplanung und Vorbereitungsphase
- Arbeitspaket 1: Projektvorstellung
- Arbeitspaket 2: Teamberatung
- Arbeitspaket 3: Erfassung des Ist-Standes
- Arbeitspaket 4: Eltern- und Kinderinformationsabend
- Arbeitspaket 5: Projektteamberatung
- Projektrealisierung
- Arbeitspaket 6: Einführungsveranstaltung
- Arbeitspaket 7: Bewegungstherapie
- Arbeitspaket 8: Bewegungstherapie mit den Eltern
- Arbeitspaket 9: Abschlusssportprogramm mit Eltern
- Arbeitspaket 10: Elternabend
- Projektevaluation
- Evaluationsgegenstand
- Bewertungsmethoden
- Evaluationsbericht
- Datenauswertung: Hauswirtschaftliches Personal
- Datenauswertung: Eltern und Fachpersonal des ÜFZ
- Datenauswertung: Beteiligte Kinder
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Projekt "Enorm in Form" zielt auf die Gesundheitsförderung von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ab. Es verfolgt das Ziel, durch ein kombiniertes Programm aus sportlicher Aktivität, Ernährungsumstellung und Verhaltenstherapie die Gesundheit der Teilnehmer zu verbessern und gleichzeitig ihre soziale Teilhabe zu fördern.
- Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
- Entwicklung eines präventiven und gesundheitsfördernden Therapieprogramms
- Integration von Bewegung und Ernährung in den Alltag der Teilnehmer
- Zusammenarbeit und Teamarbeit im multiprofessionellen Team
- Bewertung und Evaluation der Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem des Übergewichts und der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei behinderten Kindern, dar und erläutert die Bedeutung von Gesundheitsförderung und Prävention in diesem Kontext. Die Ausgangssituation des Projektes "Enorm in Form" wird im zweiten Kapitel detailliert beschrieben, einschließlich der organisatorischen und institutionellen Rahmenbedingungen, der Problematik und der Projektzielgruppe. Die Kapitel 3 und 4 befassen sich mit der Projektplanung, -durchführung und -evaluation. Die detaillierte Projektverlaufsbeschreibung beinhaltet eine Darstellung der einzelnen Arbeitspakete und deren Umsetzung. Die Projektevaluation umfasst die Evaluationsmethoden, den Evaluationsbericht und die Datenauswertung.
Schlüsselwörter
Gesundheitsförderung, Adipositas, Kinder mit Behinderungen, Prävention, Bewegungstherapie, Ernährungsumstellung, Verhaltenstherapie, Projektorganisation, Evaluation, soziale Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Projekts "Enorm in Form"?
Ziel ist die Gesundheitsförderung bei übergewichtigen oder adipösen Kindern mit Behinderungen durch Bewegung, gesunde Ernährung und Verhaltensprävention.
Warum sind Kinder mit Behinderungen besonders betroffen?
Eingeschränkte Mobilität, Medikamente oder spezifische Lebensumstände können das Risiko für Übergewicht erhöhen, was zusätzliche gesundheitliche Belastungen mit sich bringt.
Wie werden die Eltern in das Projekt einbezogen?
Eltern nehmen an Informationsabenden und gemeinsamen Sportprogrammen teil, da eine nachhaltige Verhaltensänderung nur im familiären Kontext gelingen kann.
Was ist das Modell der Salutogenese nach Antonovsky?
Es ist ein Konzept, das sich nicht auf die Entstehung von Krankheit, sondern auf die Faktoren konzentriert, die Gesundheit erhalten und fördern (Ressourcenorientierung).
Wie wird der Erfolg des Projekts evaluiert?
Durch ein Projekttagebuch sowie Befragungen des Fachpersonals, der Eltern und der Kinder wird analysiert, inwieweit die gesetzten Gesundheitsziele erreicht wurden.
Welche Fachbereiche arbeiten bei "Enorm in Form" zusammen?
Das Projekt ist interdisziplinär und vereint Medizin, Ernährungs- und Sportwissenschaften sowie Soziologie und Pädagogik.
- Quote paper
- Ines Schrötter (Author), 2016, "Enorm in Form". Gesundheitsförderung bei übergewichtigen oder adipösen Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347120