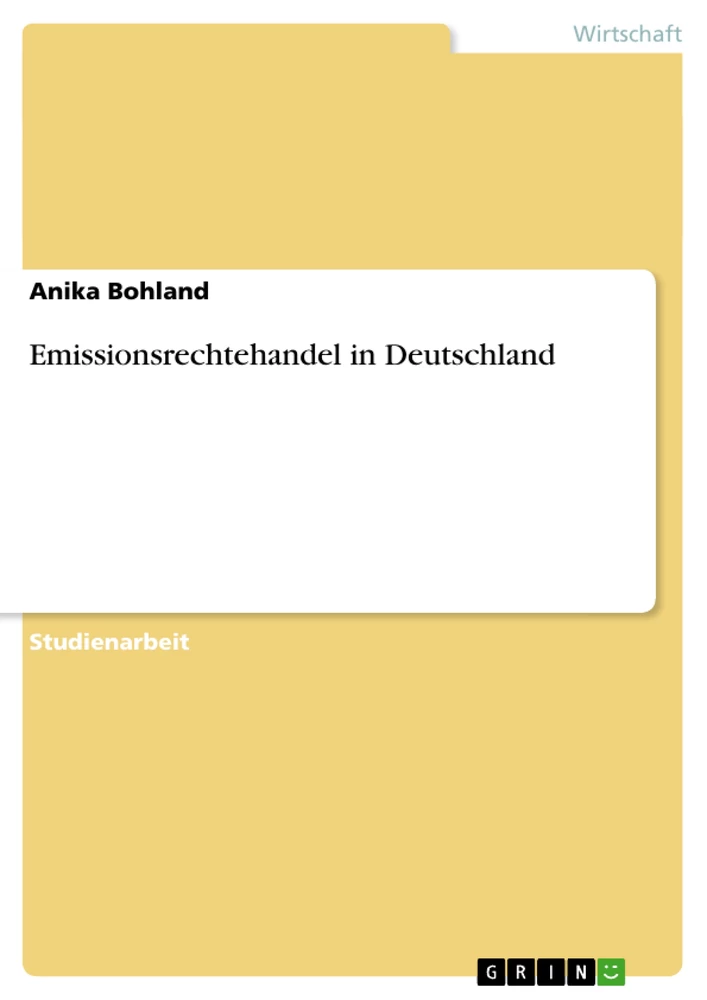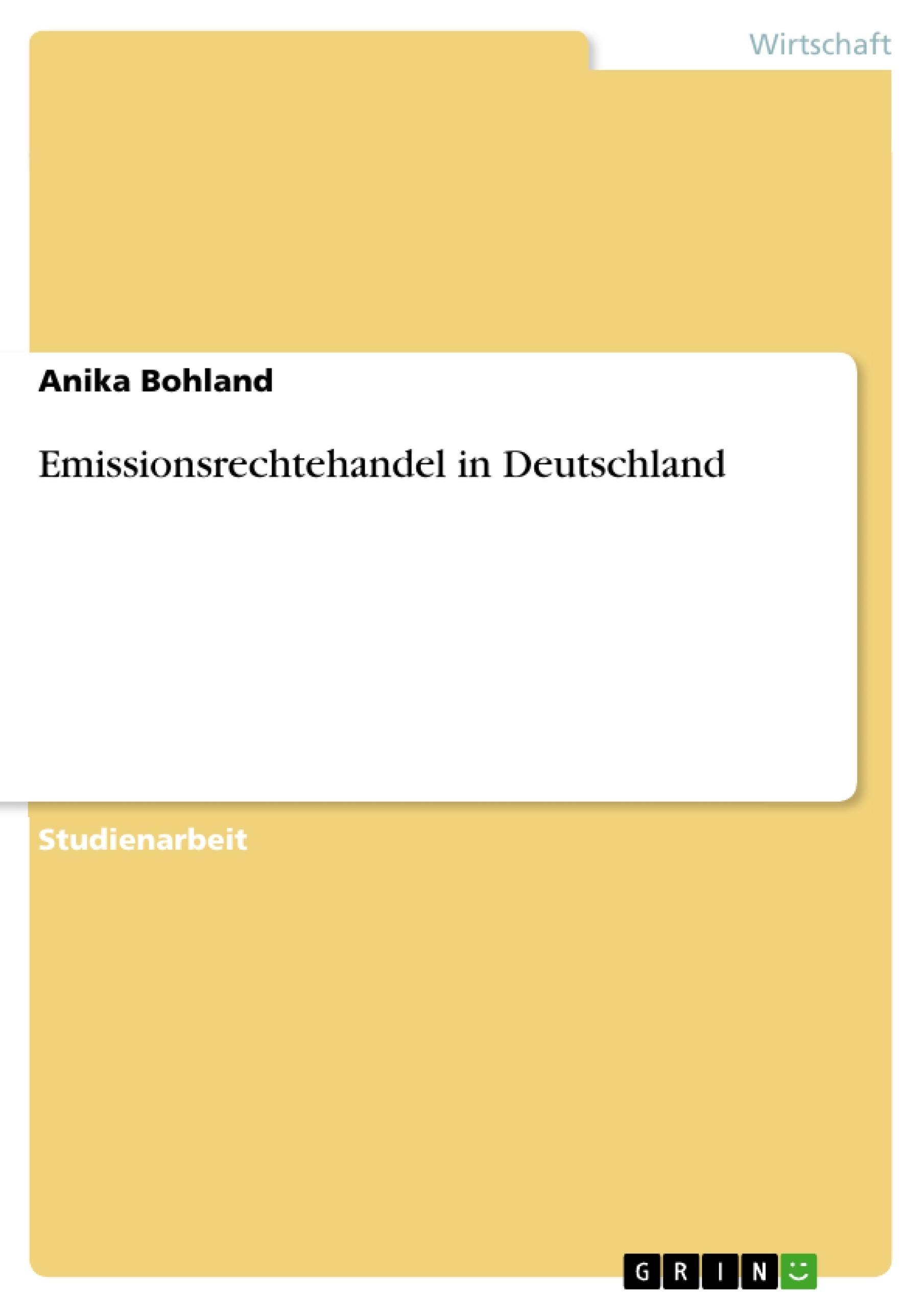Die Arbeit beschäftigt sich mit der Implementierung des Emissionsrechtehandels in Deutschland. Sie beleuchtet neben dem Kyoto-Protokoll als Grundlage, das System des Emissionsrechtehandels und die Vergabepraxis von Zertifikaten in Deutschland. Darüber hinaus wird ein Ausblick auf die internationalen Entwicklungen gegeben.
Das Thema Emissionsrechtehandel ist sehr aktuell, denn die Einführung in Deutschland und der EU wird im Januar 2005 erfolgen, auf internationaler Ebene ist der Start für 2008 geplant. Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob es möglich ist Umweltschutz in Einklang mit einer wirtschaftlichen Umsetzung zu bringen. Die Einführung vom Emissionshandel macht dies meiner Meinung nach möglich und ist auch ein gutes Beispiel für internationale Zusammenarbeit. Es demonstriert den langen Weg von globalen Verhandlungen. Das Instrument des Emissionshandels zur CO 2- Reduzierung basiert auf dem Kyoto-Protokoll. Dieses ist weltweit einmalig, da sich die Mehrheit der Länder an den Verhandlungen beteiligt haben und zu einem Ergebnis gekommen sind, das zwar kontrovers aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden muss, aber erst mal für die Länder bindend ist, welche es ratifiziert haben.
Zu Beginn der Arbeit wurde als Stichtag der 1. Juni 2004 festgelegt. Allerdings ergab sich während des Schreibens die weitreichende Veränderung, dass Russland das Protokoll ratifiziert hat und damit die notwendige Mehrheit besteht, um den Vertrag in Kraft treten zu lassen. Dieses Ereignis ist erst Ende September durch den Entschluss des russischen Präsidenten bzw. durch die Annahme des Parlamentes im Oktober eingetreten, sodass ich von anderen Tatsachen ausgehe. Die Entscheidung Russlands wird den Emissionshandel massiv beeinflussen, da das Land nun berechtig ist, mit in dieses System einzusteigen. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und damit dem Untergang der Wirtschaft kam es zu erheblichen CO 2 -Einsparungen. Dieses Potential kann jetzt verkauft werden und so den Markt für Emissionszertifikate beträchtlich verändern. Es gilt diese Entwicklungen zu beobachten, um zu sehen, ob der Vertrag das gewünschte Ziel der Unterzeichner erreicht hat.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1 - Einführung
- 1.1 Hintergrund: Das Kyoto-Protokoll
- 1.2 Aufnahme des Emissionshandels in das Vertragswerk
- Kapitel 2 – Das System des Emissionsrechtehandels
- 2.1 Gründe für die Entscheidung zum Emissionsrechtehandel
- 2.2 Emissionsvermeidungskosten
- 2.3 Beeinflussung der Konkurrenzfähigkeit
- 2.4 Zertifikate
- 2.5 Praktische Erfahrung mit Emissionshandel
- 2.6 Fazit
- Kapitel 3: Situation in Deutschland
- 3.1 Bisherige Entwicklungen in Deutschland
- 3.2 Chronologie der Implementierung des Emissionshandels in Deutschland
- 3.3 Nationaler Allokationsplan
- 3.3.1 Makroplan
- 3.3.2 Mikroplan
- 3.3.3 Harmonisierung des Makro- und Mikroplans
- 3.4 Sanktionen bei Verstößen gegen die Meldepflicht
- 3.5 Marktplätze
- 3.6 Umgang der Firmen mit dem Emissionshandel
- 3.6.1 Beispiel RWE
- 3.6.2 Beispiel Royal Dutch/Shell Group
- Kapitel 4 - Internationale Entwicklungen
- 4.1 Europäische Union
- 4.2 International
- Kapitel 5 - Abschließende Anmerkungen
- 5.1 Probleme innerhalb der EU
- 5.2 Nationale Probleme
- 5.3 Zukünftige Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Emissionsrechtehandel in Deutschland, seine Implementierung und seine internationalen Bezüge. Sie beleuchtet die Gründe für die Einführung dieses Systems, analysiert dessen Mechanismen und betrachtet die praktische Umsetzung in Deutschland und im internationalen Kontext. Die Arbeit bewertet auch die Herausforderungen und potenziellen Probleme dieses Systems.
- Das Kyoto-Protokoll und seine Bedeutung für den Emissionsrechtehandel
- Die Funktionsweise des Emissionsrechtehandelssystems
- Die Implementierung des Emissionsrechtehandels in Deutschland
- Internationale Entwicklungen im Emissionsrechtehandel
- Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen des Emissionsrechtehandels
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 - Einführung: Dieses einführende Kapitel beschreibt den Hintergrund des Kyoto-Protokolls als Grundlage für den internationalen Emissionsrechtehandel. Es erläutert die Ziele des Protokolls, die Verpflichtung der Industrienationen zur Reduktion von Treibhausgasen und den Rückzug der USA aus dem Abkommen. Der Rückzug der USA wird als ein kritischer Punkt dargestellt, der die Umsetzung des Protokolls erschwert hat. Die Bedeutung der Ratifizierung durch Russland für das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls wird hervorgehoben, sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf den globalen Emissionshandel.
Kapitel 2 – Das System des Emissionsrechtehandels: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Funktionieren des Emissionsrechtehandelssystems. Es erörtert die ökonomischen Argumente für die Einführung eines solchen Systems, insbesondere die Kosten der Emissionsvermeidung und den Einfluss auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Rolle der Emissionszertifikate und die bisherigen praktischen Erfahrungen mit dem Emissionshandel werden umfassend behandelt. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte des Systems und versucht, die komplexen Zusammenhänge verständlich zu erklären. Der Fokus liegt auf der Wirkungsweise des Systems als Marktmechanismus zur Reduktion von Treibhausgasemissionen.
Kapitel 3: Situation in Deutschland: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifische Situation des Emissionsrechtehandels in Deutschland. Es beleuchtet die Entwicklungen der Implementierung, die Chronologie der einzelnen Schritte und die Struktur des nationalen Allokationsplans (Makro- und Mikroplan). Besonderes Augenmerk wird auf die Sanktionen bei Nichteinhaltung der Meldepflicht gelegt. Das Kapitel analysiert auch die Rolle der Marktplätze und untersucht anhand von Beispielen (RWE und Royal Dutch/Shell Group) die praktische Umsetzung des Systems in der deutschen Wirtschaft. Die Komplexität der nationalen Umsetzung und die Herausforderungen für Unternehmen werden hervorgehoben.
Kapitel 4 - Internationale Entwicklungen: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die internationalen Entwicklungen im Bereich des Emissionsrechtehandels. Es behandelt die Situation innerhalb der Europäischen Union und im globalen Kontext. Der Fokus liegt hier auf der internationalen Zusammenarbeit und den verschiedenen Strategien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Die Herausforderungen der internationalen Koordination und die Unterschiede in den nationalen Ansätzen werden diskutiert. Die Kapitel bietet einen Vergleich verschiedener nationaler und internationaler Strategien.
Schlüsselwörter
Emissionsrechtehandel, Kyoto-Protokoll, Treibhausgase, Kohlendioxid (CO₂), Deutschland, Europäische Union, Nationaler Allokationsplan, Emissionszertifikate, Umweltschutz, Wirtschaftspolitik, internationale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Emissionsrechtehandel in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht umfassend den Emissionsrechtehandel in Deutschland, seine Implementierung und seine internationalen Bezüge. Sie beleuchtet die Gründe für die Einführung dieses Systems, analysiert dessen Mechanismen und betrachtet die praktische Umsetzung in Deutschland und im internationalen Kontext. Die Arbeit bewertet auch die Herausforderungen und potenziellen Probleme dieses Systems.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter das Kyoto-Protokoll und seine Bedeutung, die Funktionsweise des Emissionsrechtehandelssystems, die Implementierung in Deutschland (inkl. Nationaler Allokationsplan), internationale Entwicklungen (EU und global), Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen des Emissionsrechtehandels. Sie beinhaltet auch Fallstudien von Unternehmen wie RWE und Royal Dutch/Shell Group.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 bietet eine Einführung und beleuchtet den Hintergrund des Kyoto-Protokolls. Kapitel 2 beschreibt detailliert das Funktionieren des Emissionsrechtehandelssystems. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Situation in Deutschland, einschließlich der Implementierung und des nationalen Allokationsplans. Kapitel 4 behandelt internationale Entwicklungen innerhalb der EU und global. Kapitel 5 bietet abschließende Anmerkungen zu Problemen und zukünftigen Entwicklungen.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Seminararbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Emissionsrechtehandel, Kyoto-Protokoll, Treibhausgase, Kohlendioxid (CO₂), Deutschland, Europäische Union, Nationaler Allokationsplan, Emissionszertifikate, Umweltschutz, Wirtschaftspolitik, internationale Zusammenarbeit.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Seminararbeit (Kapitelzusammenfassungen)?
Kapitel 1 (Einführung): Beschreibt den Hintergrund des Kyoto-Protokolls und dessen Bedeutung für den Emissionsrechtehandel, inklusive des Rückzugs der USA und der Rolle Russlands. Kapitel 2 (Emissionsrechtehandelssystem): Erklärt detailliert die Funktionsweise des Systems, die ökonomischen Argumente und die Rolle der Emissionszertifikate. Kapitel 3 (Situation in Deutschland): Konzentriert sich auf die Implementierung in Deutschland, den nationalen Allokationsplan, Sanktionen und Fallstudien (RWE, Shell). Kapitel 4 (Internationale Entwicklungen): Gibt einen Überblick über die Situation in der EU und global, inklusive Herausforderungen der internationalen Kooperation.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, den Emissionsrechtehandel in Deutschland umfassend zu analysieren, seine Mechanismen zu erklären und die Herausforderungen sowie die zukünftigen Entwicklungen zu bewerten. Sie soll ein tieferes Verständnis für dieses komplexe System schaffen und die internationalen Bezüge aufzeigen.
- Arbeit zitieren
- Anika Bohland (Autor:in), 2004, Emissionsrechtehandel in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34787