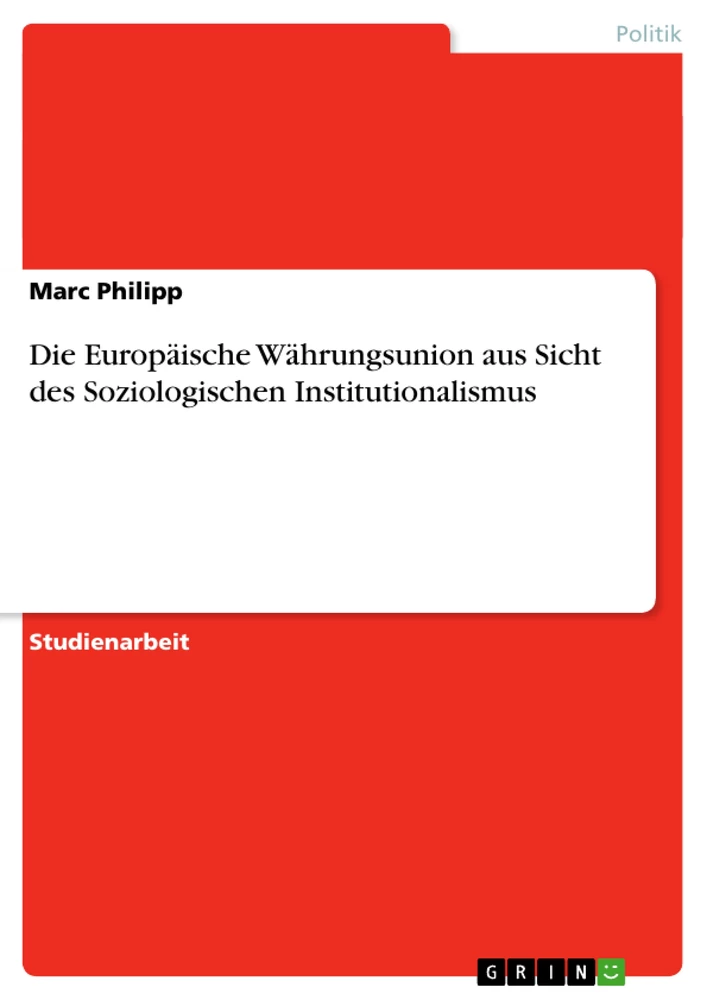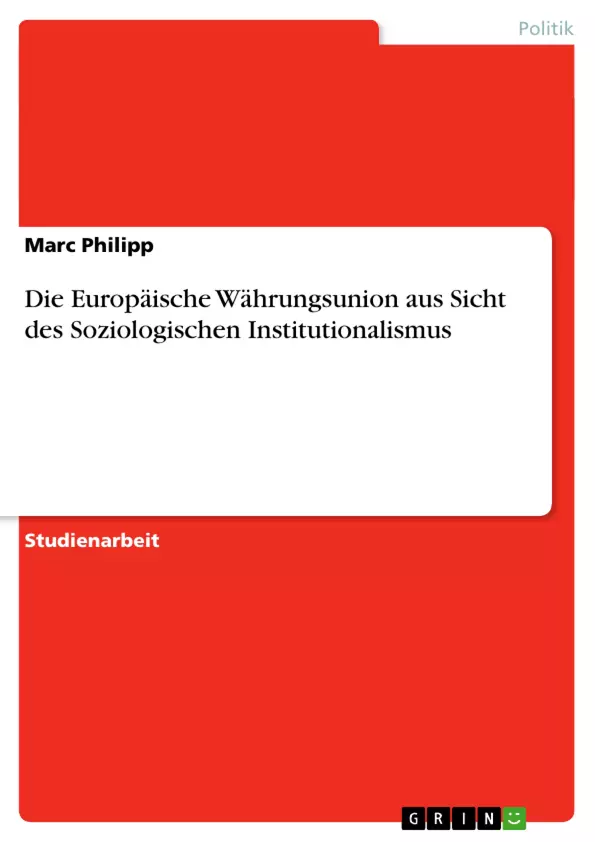Nach der Bargeldeinführung am 1. Januar 2002 ist der Euro seit dem 1. März in zwölf der 15 EU-Staaten das einzig offiziell gültige Zahlungsmittel. Trotz anfänglicher Skepsis in der Bevölkerung und Problemen mit der Einhaltung der Konvergenzkriterien traten 1999 11 Staaten der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion (EWU) bei. Auffällig hierbei war, daß nur zwei der drei größten und wirtschaftlich bedeutendsten EU-Mitgliedsstaaten, nämlich Deutschland und Frankreich, sich 1999 für die Einführung des Euro entschieden haben, während England trotz Erfüllung der Konvergenzkriterien der EWU vorerst nicht beitreten wollte. Ziel dieser Hausarbeit ist es, zu untersuchen, warum Deutschland und Frankreich der dritten Stufe der EWU beigetreten sind, England aber nicht. Als Perspektive zur Beantwortung dieser Fragestellung dient der Soziologische Institutionalismus, der die Identitäten und Interessen der jeweiligen Länder als Ursache für ihr außenpolitisches Handeln, also ihre Entscheidung für bzw. gegen den Euro heranzieht. Punkt zwei stellt dabei die wichtigsten Aspekte des Soziologischen Institutionalismus vor, der als Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung dient. Um einen Überblick über die Entwicklung und das Zustandekommen der EWU zu bekommen, werden unter Punkt drei der Weg nach Maastricht, der Inhalt des Vertrages und die drei Stufen zur EWU kurz skizziert. Punkt vier hat schließlich die drei Länder England, Deutschland, Frankreich und ihren Beitritt bzw. Ablehnung der EWU zum Gegenstand. 4.1 untersucht Englands Haltung zu Europa und seine Identität und analysiert, warum London der dritten Stufe der EWU vorerst nicht beigetreten ist. Unter 4.2 wird der Blick auf Deutschland gerichtet und analysiert, warum Deutschland trotz der Stellung der D-Mark als europäische Leitwährung der dritten Stufe nicht nur beigetreten ist, sondern als Architekt der EWU die Konvergenzkriterien und die Strukturen der EZB maßgeblich mitgestaltet hat. Den Beitritt Frankreichs gilt es unter 4.3 zu untersuchen, wobei hierbei zum einen auf die Haltung der Sozialisten und der Gaullisten einzugehen ist, zum anderen aber auch auf das deutsch-französische Verhältnis im Hinblick auf EWU.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Soziologische Institutionalismus
- III. Die Entstehung der Europäischen Währungsunion
- IV. Der Euro aus Sicht der nationalen Identitäten in England, Deutschland und Frankreich
- 4.1 England: Der Euro gegen die „Englishness“
- 4.2 Deutschland: Zwischen Euro und D-Mark
- 4.3 Frankreich: Der Euro und das französische Verhältnis zu Deutschland
- V. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, warum Deutschland und Frankreich der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion (EWU) beigetreten sind, England aber nicht. Die Arbeit untersucht diese Frage aus der Perspektive des Soziologischen Institutionalismus, der die Identitäten und Interessen der jeweiligen Länder als Ursache für ihr außenpolitisches Handeln betrachtet.
- Die Kritik des Soziologischen Institutionalismus am Neoliberalismus und Rationalismus
- Das Akteursmodell des homo sociologicus im Soziologischen Institutionalismus
- Die Rolle von kollektiven Identitäten und kulturellen Normen und Werten im außenpolitischen Handeln von Staaten
- Die Bedeutung von Institutionen für die Definition von Identitäten und Interessen
- Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Währungsunion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage vor. Kapitel II erläutert die wichtigsten Aspekte des Soziologischen Institutionalismus, der als Grundlage für die Analyse der Beitrittsentscheidungen der drei Länder dient. Kapitel III skizziert den Weg nach Maastricht, den Inhalt des Vertrages und die drei Stufen zur EWU. Kapitel IV befasst sich mit der Haltung Englands, Deutschlands und Frankreichs zum Beitritt zur EWU und analysiert die jeweiligen nationalen Identitäten und Interessen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf den Soziologischen Institutionalismus, nationale Identitäten, Interessen, Europäische Währungsunion, Euro, England, Deutschland, Frankreich, Maastricht-Vertrag, Konvergenzkriterien.
Häufig gestellte Fragen
Warum trat England der Europäischen Währungsunion (EWU) nicht bei?
Aus Sicht des Soziologischen Institutionalismus kollidierte der Euro mit der britischen nationalen Identität („Englishness“). Trotz Erfüllung der Konvergenzkriterien überwogen die kulturellen Vorbehalte gegenüber einer tieferen Integration.
Welche Rolle spielte Deutschland bei der Einführung des Euro?
Deutschland fungierte als Architekt der EWU. Trotz der starken Bindung an die D-Mark entschied sich Deutschland für den Euro, um die europäische Integration voranzutreiben und die Strukturen der EZB maßgeblich zu prägen.
Was erklärt der Soziologische Institutionalismus in Bezug auf die Außenpolitik?
Dieser Ansatz betont, dass nicht nur rationale Interessen, sondern vor allem kollektive Identitäten, kulturelle Normen und Werte das Handeln von Staaten bestimmen.
Wie beeinflusste das deutsch-französische Verhältnis den Beitritt zur EWU?
Für Frankreich war der Euro ein Mittel, um die deutsche Vormachtstellung im Währungsbereich auszugleichen und eine engere politische Bindung zu Deutschland im Rahmen der EU zu festigen.
Was sind die drei Stufen der Europäischen Währungsunion?
Die Arbeit skizziert den Weg von den Vorbereitungen über die Festlegung der Konvergenzkriterien im Maastricht-Vertrag bis hin zur endgültigen Bargeldeinführung am 1. Januar 2002.
- Arbeit zitieren
- Marc Philipp (Autor:in), 2002, Die Europäische Währungsunion aus Sicht des Soziologischen Institutionalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34797