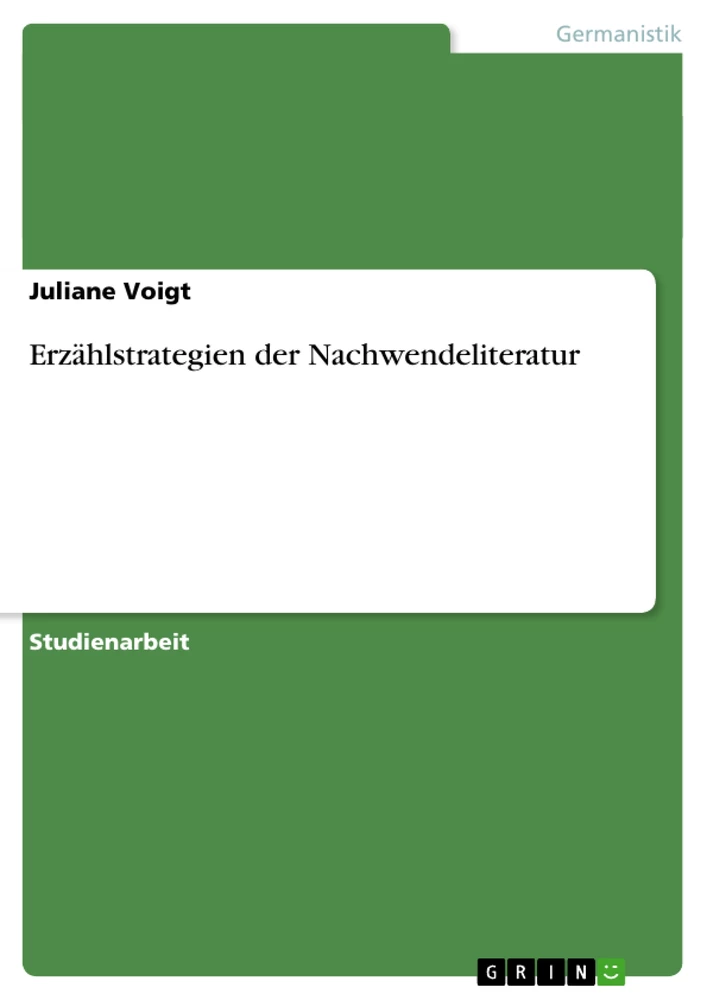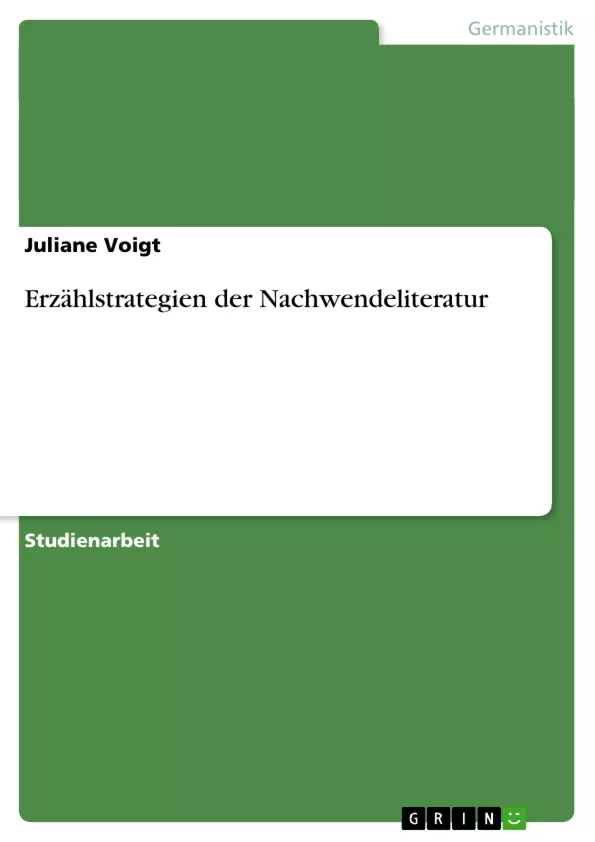„Ostdeutsche Autoren haben es leichter. Weil die DDR verschwunden ist und mit ihr so viele Dinge, Gewohnheiten und Lebensweisen, haben sie um so mehr von ihr zu erzählen.“ Diese Aussage beschreibt zum einen die Themen der deutschen Nachwendeliteratur und zum anderen die Situation, aus der heraus viele literarische Werke in den Jahren nach 1989 in Deutschland entstanden sind. Autoren wie Ingo Schulz, Jens Sparschuh, Jana Hensel und Thomas Brussig haben es gemeinsam, einen gewissen Teil ihres Lebens in einem nicht mehr existierenden Staat mit einer als überholt geltenden Gesellschaftsform verbracht zu haben. Sie können aus einer bestimmten zeitlichen Distanz auf einen Lebensabschnitt zurückblicken, den sie, und mit ihnen Millionen andere Menschen, abgeschlossen haben bzw. abschließen mussten.
Den Werken der Nachwendeliteratur, die größtenteils von ostdeutschen Autoren geprägt ist, ist folglich ein übergreifendes Merkmal gemeinsam: „Das Moment der Erinnerung“ , d.h. ein Abschiednehmen von der DDR und die Suche nach einem Neuanfang. Es geht dabei allerdings nicht nur um das bloße Berichten von Lebensumständen und Geschichten, die sich unter diesen abgespielt haben (könnten). Die Erinnerung an das Leben vor und nach 1989 ist vielmehr auch eine Form der Verarbeitung von Erfahrungen, die die Autoren in der politischen und sozialen Vergangenheit der DDR und durch die Umbrüchen, die nach dem Fall der Berliner Mauer in ihrer Heimat stattgefunden haben, machten. Und genauso, wie jeder Mensch entsprechend seines Charakters eine ganz eigene Strategie im Umgang und mit der Verarbeitung solcher existentieller Erfahrungen hat, so nutzt auch jeder Autor eine individuelle Form der literarischen Auseinandersetzung mit diesem Thema.
In dieser Arbeit soll es um einen Vergleich zweier prosaischer Texte der Nachwendeliteratur gehen, denen „das Moment der Erinnerung“ gemeinsam ist, die sich jedoch in der Strategie des Erinnerns unterscheiden. Es sollen der von Thomas Brussigs 1995 veröffentlichte Roman „Helden wie wir“ und Jana Hensels im Jahr 2002 erschienener Bericht „Zonenkinder“ mit-einander verglichen werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf die von den Autoren in diesen Werken angewandten Erzählstrategien gelegt werden soll. Dazu werden beide Werke nacheinander zunächst inhaltlich vorgestellt und anschließend hinsichtlich der Form des Erzählens untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THOMAS BRUSSIGS „HELDEN WIE WIR“
- KURZE INHALTSANGABE
- DIE ERZÄHLSTRATEGIE
- DER REGRESSIVE WITZ
- SELBSTINSZENIERUNG
- MORALISCHE EINSCHÜBE
- SCHLUSSFOLGERUNG
- JANA HENSELS „ZONENKINDER“
- KURZE INHALTSANGABE
- ERZÄHLSTRATEGIE
- DAS AUTOBIOGRAPHISCHE
- DAS WIR-GEFÜHL
- DAS AUTOBIOGRAPHISCHE
- SCHLUSSFOLGERUNG
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert zwei Prosatexte der Nachwendeliteratur, die sich in ihrer Erzählstrategie des Erinnerns unterscheiden: „Helden wie wir“ von Thomas Brussig und „Zonenkinder“ von Jana Hensel. Beide Werke setzen sich mit dem Moment der Erinnerung an die DDR auseinander, wobei die Autoren unterschiedliche narrative Strategien verfolgen, um die Erfahrungen der Wende und die Verarbeitung der Vergangenheit zu gestalten.
- Das „Moment der Erinnerung“ als zentrales Merkmal der Nachwendeliteratur
- Verarbeitung der Lebensumstände und Geschichten in der DDR
- Die Suche nach einem Neuanfang nach dem Fall der Mauer
- Individuelle Strategien der literarischen Auseinandersetzung mit der Geschichte
- Vergleichende Analyse der Erzählstrategien in den beiden Texten
Zusammenfassung der Kapitel
2. Thomas Brussigs „Helden wie wir“
„Helden wie wir“ erzählt die Geschichte des ehemaligen DDR-Bürgers Klaus Uhltzscht, der behauptet, den Fall der Berliner Mauer herbeigeführt zu haben. Der Roman verfolgt einen chronologischen Aufbau, in dem Uhltzscht sein Leben vom Zeitpunkt seiner Geburt bis zum Tag des Interviews schildert. Seine Erzählweise ist geprägt vom „regressiven Witz“, der die Lebensumstände und Personen seiner Umgebung lächerlich macht, sowie von der Selbstinszenierung des Protagonisten und gelegentlichen moralischen Einwürfen.
3. Jana Hensels „Zonenkinder“
„Zonenkinder“ ist ein autobiographischer Bericht, der sich mit der Erfahrung des Aufwachsens in der DDR beschäftigt. Der Text zeichnet die Geschichte einer Generation von „Zonenkindern“ nach, die mit dem Fall der Mauer ihre gewohnte Lebenswelt verloren. Jana Hensels Erzählstrategie zeichnet sich durch die Perspektive des autobiographischen Ichs und das Gefühl des „Wir“ aus, das die gemeinsame Erfahrung der Generation DDR hervorhebt.
Schlüsselwörter
Nachwendeliteratur, Erinnerungskultur, DDR, Wende, Erzählstrategien, „regressiver Witz“, Selbstinszenierung, Autobiographie, „Zonenkinder“, Generation DDR.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet die deutsche Nachwendeliteratur?
Zentrales Merkmal ist das „Moment der Erinnerung“ – die literarische Verarbeitung des Lebens in der DDR, der Wendeerfahrung und die Suche nach einem Neuanfang.
Welche Erzählstrategie nutzt Thomas Brussig in „Helden wie wir“?
Brussig nutzt den „regressiven Witz“, Selbstinszenierung und eine groteske Übersteigerung, um die DDR-Vergangenheit und den Mauerfall satirisch zu beleuchten.
Wie unterscheidet sich Jana Hensels „Zonenkinder“ davon?
Hensel wählt einen autobiographischen Ansatz, der das kollektive „Wir-Gefühl“ einer Generation thematisiert, die ihre Kindheitswelt durch die Wende verloren hat.
Warum wird die Erinnerung als Form der Verarbeitung gesehen?
Die Autoren nutzen die zeitliche Distanz, um existentielle Erfahrungen des Systemwechsels und soziale Umbrüche individuell und literarisch zu bewältigen.
Wer sind typische Autoren der Nachwendeliteratur?
Neben Brussig und Hensel werden Ingo Schulze, Jens Sparschuh und weitere ostdeutsche Autoren genannt, die den verschwundenen Staat DDR thematisieren.
- Quote paper
- Juliane Voigt (Author), 2005, Erzählstrategien der Nachwendeliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34815