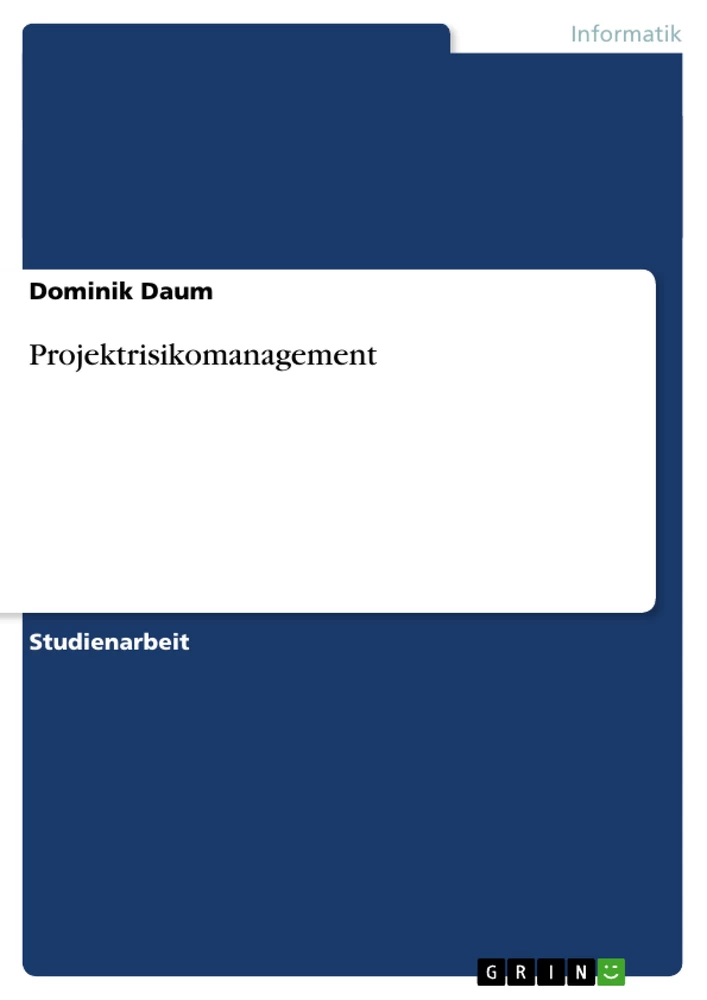Egal ob ein Flughafen gebaut, ein neues EDV-System implementiert oder ein Produkt entwickelt wird: Wirtschaft, Forschung und Politik setzen diese Vorhaben verstärkt in Form von Projekten1 um. Ein Beleg hierfür ist die hohe Anzahl an initiierten Projekten in den Unternehmen. Aus der Projektarbeit ergeben sich zwar Chancen für eine mögliche Kostensenkung oder einer verbesserten Marktpositionierung, aber zwangsläufig auch Risiken. Diese gilt es adäquat zu behandeln, worauf jedoch in der Vergangenheit in den meisten Unternehmen verzichtet wurde. Dementsprechend häufig stellten sich Projektabbrüche oder Termin- bzw. Budgetüberschreitungen andere, professionellere Vorgehensweise bezüglich der Projektrisiken notwendig wurde. Die Lösung kann Projektrisikomanagement sein, da unerwünschte Entwicklungen, die Fehler und Probleme verursachen, frühzeitig identifizier- und steuerbar sind. Das den Projekten zugrundeliegende Risikopotential hat der Gesetzgeber ebenfalls erkannt und am 1. Mai 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG)2 verabschiedet. Dieses Gesetz verpflichtet die Unternehmen zum sensibilisierten Umgang mit Projektrisiken. Sehr erfolgreich wurden bereits beim Militär und in der Luft- und Raumfahrtstechnik Projektrisiken gemanagt. Andere Branchen adaptieren diese Projektmanagementdisziplin dagegen nur sehr schleppend; lediglich in der Informationstechnologiebranche wird diese Projektmanagementdisziplin in jüngster Vergangenheit verstärkt angewendet. Von einer „passablen Umsetzung und Anwendung sind die meisten Unternehmen allerdings weit entfernt“3. Diese Studienarbeit vermittelt die Notwendigkeit von Projektrisikomanagement, jedoch nicht ohne auch den Aufwand aufzuzeigen. Es wird erläutert, welche Risikokategorien existieren und wie die Projektmanagementdisziplin Risikomanagement als Prozess umgesetzt werden kann. Abschließend wird die Wirtschaftlichkeit von Projektrisikomanagement betrachtet. 1 Siehe Kapitel 2: Notwendige Begrifflichkeiten 2 Siehe S. 7. 3 Siehe Thaller, Georg E.: Drachentöter – Risikomanagement für IT-Projekte, S. 81-82
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abbildungsverzeichnis
- III. Tabellenverzeichnis
- 1 Hinführung zum Thema
- 2 Notwendige Begrifflichkeiten
- 2.1 Projekt
- 2.2 Risiko
- 2.3 Risikomanagement
- 2.4 Projektcontrolling
- 2.5 Projektrisikomanagement
- 3 Notwendigkeit eines Projektrisikomanagements
- 3.1 KonTraG
- 3.2 Wettbewerbsvorteil durch bewusstes Eingehen von Risiken
- 4 Risikokategorien
- 5 Risikomanagementprozess
- 5.1 Risikoidentifikation
- 5.1.1 Techniken zur Risikoidentifikation
- 5.1.1.1 Post Mortem Analyse
- 5.1.1.2 Projektumfeldanalyse
- 5.1.1.3 Risiko-Workshops
- 5.1.1.4 Interviews
- 5.1.1.5 Risikofragebogen
- 5.1.1.6 Einsatz der Techniken
- 5.2 Risikoanalyse
- 5.2.1 Risikoliste
- 5.2.2 ABC-Analyse
- 5.2.3 Abhängigkeitsmatrix
- 5.3 Risikobehandlung
- 5.3.1 Risikovermeidung
- 5.3.2 Risikoverminderung
- 5.3.2.1 Risikoverminderung in inkrementellen Schritten
- 5.3.2.2 Reaktiver und proaktiver Inkrementalismus
- 5.3.2.3 Inkrementeller Fertigstellungsplan
- 5.3.3 Risikobegrenzung
- 5.3.4 Risikoverlagerung
- 5.3.5 Risikoakzeptanz
- 5.4 Risikoüberwachung
- 5.4.1 Risikoportfolio
- 5.4.2 Meilenstein- und Kostentrendanalyse (MTA und KTA)
- 5.4.3 Earned Value Analyse (EVA)
- 5.4.4 Frühwarnsystem
- 5.5 Risikokommunikation
- 6 Wirtschaftlichkeit des Projektrisikomanagements
- 7 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Projektrisikomanagement und untersucht dessen Bedeutung in der modernen Projektlandschaft. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte des Risikomanagements, von der Definition und Kategorisierung von Risiken über die Identifikation und Analyse bis hin zur Behandlung und Überwachung von Risiken. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung des Projektrisikomanagements in der Praxis, insbesondere im Kontext des IT-Projekts.
- Definition und Bedeutung von Projektrisiken
- Risikoidentifikation und -analyse
- Techniken zur Risikosteuerung und -bewältigung
- Die Bedeutung von Risikoüberwachung und -kommunikation
- Wirtschaftlichkeit des Projektrisikomanagements
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Projektrisikomanagement ein und definiert wichtige Begrifflichkeiten wie Projekt, Risiko und Risikomanagement. Anschließend werden die Notwendigkeit eines Projektrisikomanagements sowie relevante Risikokategorien beleuchtet.
Im zweiten Kapitel wird der Risikomanagementprozess im Detail dargestellt, beginnend mit der Risikoidentifikation und Analyse. Hier werden verschiedene Techniken zur Risikoidentifikation erläutert, darunter die Post Mortem Analyse, die Projektumfeldanalyse, Risiko-Workshops, Interviews und Risikofragebögen. Darüber hinaus werden Methoden wie die ABC-Analyse und die Abhängigkeitsmatrix zur Risikoanalyse vorgestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Risikobehandlung, wobei verschiedene Strategien zur Risikosteuerung präsentiert werden, darunter Risikovermeidung, Risikoverminderung, Risikobegrenzung, Risikoverlagerung und Risikoakzeptanz. Die Bedeutung von Risikoüberwachung und -kommunikation wird ebenfalls behandelt, inklusive der Anwendung von Tools wie dem Risikoportfolio, der Meilenstein- und Kostentrendanalyse (MTA und KTA) sowie der Earned Value Analyse (EVA).
Das vierte Kapitel analysiert die Wirtschaftlichkeit des Projektrisikomanagements und zeigt die Vorteile einer systematischen Risikosteuerung auf. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit über die Bedeutung des Projektrisikomanagements für den Erfolg von Projekten.
Schlüsselwörter
Projektrisikomanagement, Risiko, Risikoidentifikation, Risikoanalyse, Risikobehandlung, Risikoüberwachung, Risikokommunikation, IT-Projekt, Projektcontrolling, KonTraG, Wettbewerbsvorteil
- Arbeit zitieren
- Dominik Daum (Autor:in), 2004, Projektrisikomanagement, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34859