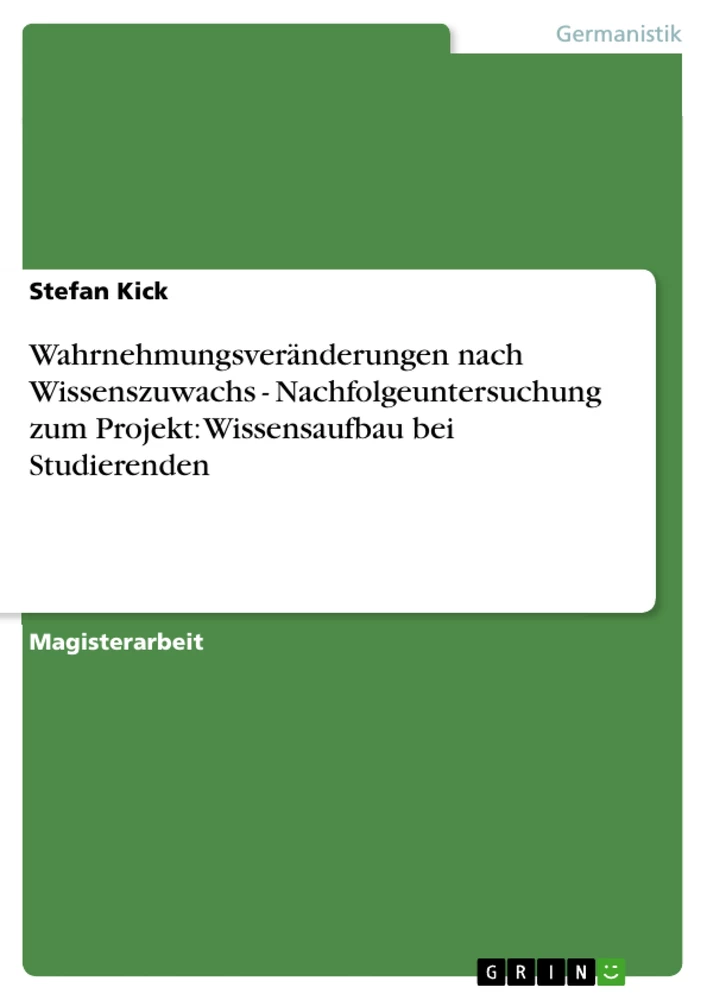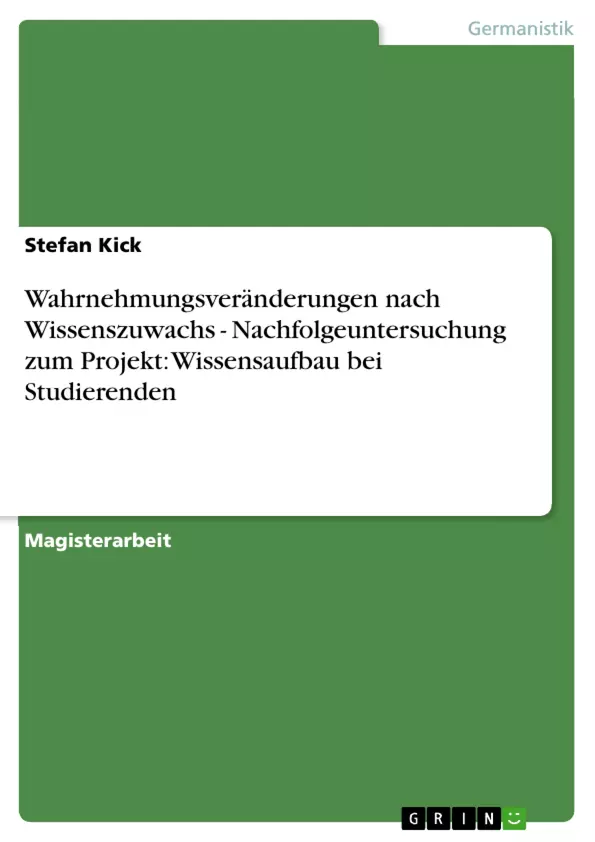,,Horizontal sequences of letters separated by empty spaces symbolize words. Letters within words symbolize phonetic segments which are blended together in pronunciations." (EHRI 1984, S.120).
Diese zwei Grundprinzipien unseres Schriftsystems sind für Lesekundige so offensichtlich, daß sie manchmal gar nicht mehr bewußt wahrgenommen werden. Überraschend ist die Tatsache, daß die Schrift, die wir erlernen, Auswirkungen auf unser Sprachbewußtsein und sogar auf unsere Wahrnehmung gesprochenen Materials hat.
In einem situativen Lernkontext sollten Studenten der Universität Regensburg auf diese Zusammenhänge hingewiesen werden. Indem sie mit sprachliche m Material konfrontiert wurden, bei dem ihnen ihre Kenntnis der Schrift ihrer Muttersprache nicht weiter half, sollten sie die Schwierigkeiten erleben, denen auch ihre späteren Schüler
ausgesetzt sind.
Die beiden Versuche in diesem situativen Lernkontext beinhalteten das Erkennen und Schreiben einer Phonemschrift (,,Rephos" = ,,Regensburger Phonemschrift") sowie einen ,,Text in einer fremden Sprache". Hierbei sollte den Studenten der Vorteil genommen werden, den man hat, wenn man die Rechtschreibung einer Sprache
beherrscht: Die Schreibung wirkt logisch und man glaubt, von der Schreibung suggerierte lautliche Phänomene auch zu hören, egal ob diese meßbar sind oder nicht. Die hier verwendete finnische Sprache nimmt den Probanden des Versuchs also den sicheren Untergrund und will sie so in die Situation ihrer zukünftigen Schüler versetzen.
Einige Aspekte dieses Versuchs ,,Text in einer fremden Sprache" sollen im weiteren untersucht werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands
- Einbettung der Untersuchung in einen wissenschaftlichen Kontext
- Konkreter Versuch/ Anleitung
- Der Diktattext
- Teil a) der Lerneinheit: Übung
- Teil b) der Lerneinheit: Reflexion zur didaktischen Perspektive
- Theoretische Grundlagen
- Zusammenfassung der aktuellen Forschung zum situativen Lernen
- Der Begriff des Konstruktivismus
- Konstruktivismus in der Psychologie
- Konstruktivistische Ansätze in Lerntheorie/Pädagogik
- ,,Träges Wissen"
- Metaprozeßerklärungen
- Strukturdefiziterklärungen
- Situiertheitserklärungen
- Interventionsmodelle
- Konsequenzen neuerer (konstruktivistischer) Ergebnisse für die Psychologie des Wissenserwerbs
- Die Gestaltung konstruktivistischer Lernumgebungen
- Der Bezug der situativen Lerntheorie zur konkreten Untersuchung
- Überblick über sprachwissenschaftliche Bezüge zum Thema
- Eigenheiten der finnischen Sprache
- Phonetische Grundlagen und Grundlagen zum Begriff „Wort"
- Zusammenhänge Laut- Schriftsprache
- Literatur zur sprachlichen Entwicklung auch nach und beim Schriftspracherwerb
- Phonetical Awareness/Sprachbetrachtungsfähigkeit
- Zusammenhänge zwischen Schriftsprache und grammatischen Phänomenen
- Das Wortkonzept
- Definition/Sprachwissenschaftliches über Wortgrenzen/Wörter
- Der Wortbegriff von Kindern/Probleme von Kindern mit dem „,Wort”
- Empirische Arbeiten über den kindlichen Wortbegriff
- Nicht hörbare Wortgrenzen oder mangelnde Sprachbetrachtungsfähigkeit als Grund für Verschriftungsfehler bei Kindern
- Psychologischer Erklärungsversuch für die Inhaltsbezogenheit vor dem Schriftspracherwerb
- Grundlagen aus dem pädagogisch-didaktischen Bereich
- Die Betonung des Lautlichen
- Stufenmodell/ Kind abholen wo es ist
- Fehlerbewertung
- Bezug zu unserem Thema
- Die drei Dimensionen nach VALTIN beim Erwerb von Schrift
- Situatives Lernen und Konstruktivismus
- Wahrnehmung von Wortgrenzen
- Der Einfluss von didaktischen Interventionen
- Schriftspracherwerb und Sprachbetrachtungsfähigkeit
- Phonetische und sprachwissenschaftliche Aspekte der finnischen Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Wahrnehmungsveränderungen bei Studierenden im Bereich der Schriftsprachdidaktik. Es soll herausgefunden werden, inwieweit sich die Wahrnehmung von Wortgrenzen in einem finnischen Text nach dem Erwerb neuen Wissens über die finnische Sprache verändert. Ziel ist es, die Bedeutung situativen Lernens und den Einfluss von didaktischen Interventionen auf die Wahrnehmung von Sprache und Schrift zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Hinführung zum Untersuchungsgegenstand und seiner Einbettung in den wissenschaftlichen Kontext. Das zweite Kapitel beschreibt den konkreten Versuch, bei dem Studierenden ein finnischer Text diktiert und anschließend ein didaktischer Text zu den Besonderheiten der finnischen Sprache präsentiert wird. Anschließend erfolgt eine Analyse der Veränderungen in der Wahrnehmung von Wortgrenzen nach der Intervention.
Das dritte Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen, indem es die aktuelle Forschung zum situativen Lernen und den Konstruktivismus beleuchtet. Zudem werden sprachwissenschaftliche Bezüge zum Thema, insbesondere zur phonetischen und sprachlichen Entwicklung, sowie zum Wortbegriff im Schriftspracherwerb, diskutiert. Schließlich werden pädagogisch-didaktische Aspekte, wie die Betonung des Lautlichen und die Bedeutung von Stufenmodellen, betrachtet.
Die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse erfolgen im vierten Kapitel. Dabei wird untersucht, inwieweit die Ergebnisse des Versuchs die Annahme bestätigen, dass sich die Wahrnehmung von Wortgrenzen nach dem Erwerb neuen Wissens verändert. Es werden außerdem mögliche Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung und Verschriftung von Lauten analysiert.
Schlüsselwörter
Situatives Lernen, Konstruktivismus, Schriftspracherwerb, Sprachbetrachtungsfähigkeit, Wortgrenzen, Phonetik, Finnisch, Didaktische Intervention, Wahrnehmungsveränderungen, Wissenszuwachs, Studierende.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Schriftsprache unsere Wahrnehmung von gesprochener Sprache?
Die Kenntnis der Rechtschreibung suggeriert uns oft lautliche Phänomene oder Wortgrenzen, die physikalisch kaum messbar sind. Wir "hören", was wir zu schreiben gewohnt sind.
Was ist das Ziel des Experiments mit der finnischen Sprache?
Studierende sollen in die Lage von Schulanfängern versetzt werden, die noch keine festen Wortkonzepte haben, um die Schwierigkeiten beim Erkennen von Wortgrenzen ohne Rechtschreibkenntnisse zu erleben.
Was versteht man unter "situativem Lernen"?
Lernen in Kontexten, die reale Anwendungssituationen widerspiegeln, um "träges Wissen" zu vermeiden und die praktische Problemlösekompetenz zu fördern.
Warum haben Kinder Probleme mit dem "Wortbegriff"?
Da Wortgrenzen im Redefluss oft nicht hörbar sind, müssen Kinder erst lernen, Sprache als abstraktes System aus Einheiten (Wörtern) wahrzunehmen, was durch den Schriftspracherwerb unterstützt wird.
Verändert Wissenszuwachs die unmittelbare Wahrnehmung?
Ja, die Untersuchung zeigt, dass Studierende nach einer didaktischen Intervention über die Struktur des Finnischen Wortgrenzen anders (korrekter) wahrnehmen und verschriften als zuvor.
Was ist phonologische Bewusstheit (Phonetical Awareness)?
Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit von der Bedeutung der Sprache auf deren Struktur und Lauteinheiten zu lenken, was eine Grundvoraussetzung für das Lesen- und Schreibenlernen ist.
- Arbeit zitieren
- Stefan Kick (Autor:in), 2000, Wahrnehmungsveränderungen nach Wissenszuwachs - Nachfolgeuntersuchung zum Projekt: Wissensaufbau bei Studierenden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3489