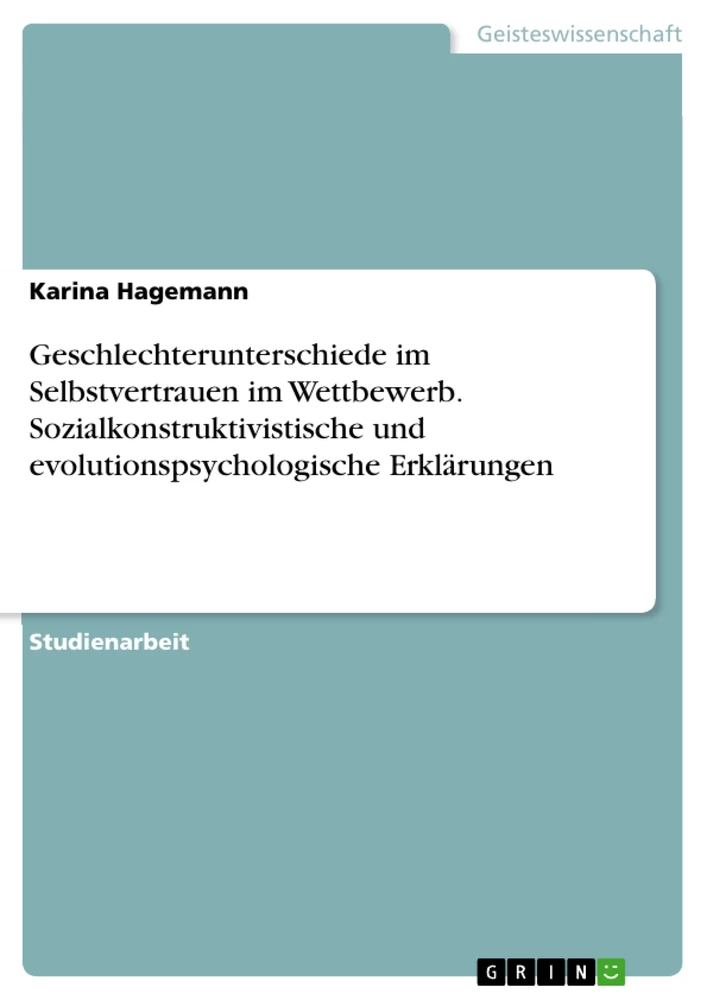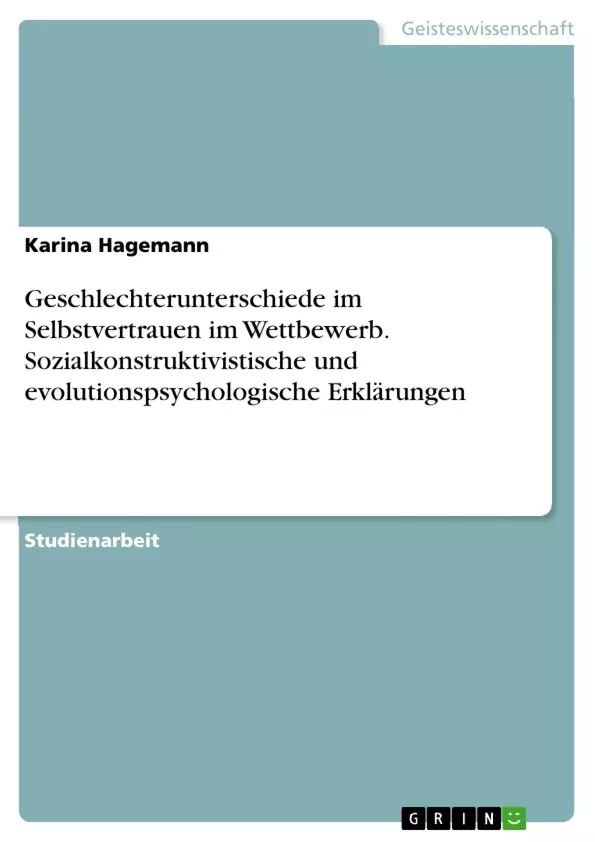Geschlechterunterschiede und die Erklärung von deren Ursachen sind bekannte Gebiete psychologischer Forschung. In dieser Arbeit werden Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Selbstvertrauen im Wettbewerb betrachtet.
Vorerst wird festgestellt, dass tendenziell bei Männern mehr Selbstvertrauen in Wettbewerbssituationen beobachtet wird. Daraufhin wird dieser Unterschied aus der sozialkonstruktivistischen und evolutionspsychologischen Perspektive untersucht. Während ersterer Ansatz den Einfluss des sozialen Umfeldes auf Geschlechterunterschiede betont, begründet letzterer diesen durch adaptive Vorteile durch verschiedenartige Veranlagung beider Geschlechter.
Aus sozialkonstruktivistischer Perspektive finden sich beispielsweise auf der Seite der Frauen ein unvorteilhafter Attribuierungsstil, Furcht vor Erfolg und dessen negativen Konsequenzen sowie die Befürwortung von Stereotypen über Wettbewerbsfähigkeit. Die Evolutionspsychologie erklärt den Unterschied dadurch, dass Männer einen Vorteil durch hohes Selbstvertrauen im Wettbewerb hatten. Für Frauen hingegen überwogen die Risiken gegenüber den möglichen Gewinnen im Wettbewerb, weshalb für sie ein niedriges Selbstvertrauen in Wettbewerben von Vorteil war, was zur Vermeidung von ebendiesen führte.
Um den Grad des Einflusses von Veranlagung und sozialer Umwelt festzustellen, können Kulturunterschiede erforscht werden. Weiterführend wird ein Kulturvergleich von Geschlechterunterschieden im Selbstvertrauen im Wettbewerb in Bezug auf weitgehende Ähnlichkeiten und Abweichung empfohlen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Geschlechterunterschiede im Selbstvertrauen im Wettbewerb
- Sozialkonstruktivistische Erklärungsansätze
- Konflikte mit dem traditionellen Rollenbild der Frau
- Verhaltensbestätigung
- Attribuierungsstil
- Furcht vor Erfolg
- Befürwortung von Stereotypen
- Evolutionspsychologische Erklärungsansätze
- Vorteil von hohem Selbstvertrauen für Männer
- Vorteil von niedrigem Selbstvertrauen für Frauen
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Geschlechterunterschieden im Selbstvertrauen im Wettbewerb. Sie untersucht die Ursachen dieser Unterschiede aus sozialkonstruktivistischer und evolutionspsychologischer Perspektive.
- Untersuchung von Geschlechterunterschieden im Selbstvertrauen im Wettbewerb
- Analyse der Ursachen aus sozialkonstruktivistischer und evolutionspsychologischer Perspektive
- Betrachtung von Attribuierungsstilen, der Furcht vor Erfolg und Stereotypen aus sozialkonstruktivistischer Sicht
- Erörterung der adaptiven Vorteile von hohem Selbstvertrauen bei Männern und niedrigem Selbstvertrauen bei Frauen aus evolutionspsychologischer Sicht
- Vergleich und Gegenüberstellung der beiden Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
- Abstract: Die Arbeit untersucht Geschlechterunterschiede im Selbstvertrauen im Wettbewerb und betrachtet dazu sozialkonstruktivistische und evolutionspsychologische Erklärungsansätze.
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Forschung zu Geschlechterunterschieden und stellt die beiden zentralen Perspektiven, die sozialkonstruktivistische und die evolutionspsychologische, vor. Sie definiert Selbstvertrauen und erklärt, wie es sich auf die Leistung von Personen auswirkt.
- Geschlechterunterschiede im Selbstvertrauen im Wettbewerb: Dieses Kapitel analysiert die Forschung zu Geschlechterunterschieden im Selbstvertrauen, insbesondere in Bezug auf Wettbewerbssituationen. Es stellt fest, dass Männer tendenziell mehr Selbstvertrauen in Wettbewerbssituationen haben als Frauen, und führt verschiedene Studien zu dieser Beobachtung an.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Geschlechterunterschiede, Selbstvertrauen, Wettbewerb, sozialkonstruktivistische Perspektive, evolutionspsychologische Perspektive, Attribuierungsstil, Furcht vor Erfolg, Stereotypen, adaptive Vorteile, Kulturunterschiede und Geschlechterrollen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Geschlechterunterschiede werden im Wettbewerb beobachtet?
Studien zeigen, dass Männer in Wettbewerbssituationen tendenziell ein höheres Selbstvertrauen zeigen als Frauen.
Wie erklärt der Sozialkonstruktivismus diese Unterschiede?
Dieser Ansatz betont den Einfluss des sozialen Umfelds, traditionelle Rollenbilder, Stereotype über Wettbewerbsfähigkeit und die sogenannte "Furcht vor Erfolg" bei Frauen.
Was ist die evolutionspsychologische Erklärung für das Selbstvertrauen?
Die Evolutionspsychologie sieht adaptive Vorteile: Für Männer war hohes Selbstvertrauen im Wettbewerb vorteilhaft, während für Frauen die Risiken oft die möglichen Gewinne überwogen.
Was versteht man unter dem Attribuierungsstil in diesem Kontext?
Es beschreibt, wie Personen Erfolg oder Misserfolg begründen; Frauen nutzen laut Forschung oft einen für Wettbewerbssituationen unvorteilhaften Attribuierungsstil.
Wie kann man den Einfluss von Veranlagung vs. Umwelt prüfen?
Die Arbeit empfiehlt Kulturvergleiche, um festzustellen, inwieweit Geschlechterunterschiede im Selbstvertrauen universell sind oder je nach Gesellschaft variieren.
- Quote paper
- Karina Hagemann (Author), 2015, Geschlechterunterschiede im Selbstvertrauen im Wettbewerb. Sozialkonstruktivistische und evolutionspsychologische Erklärungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349146