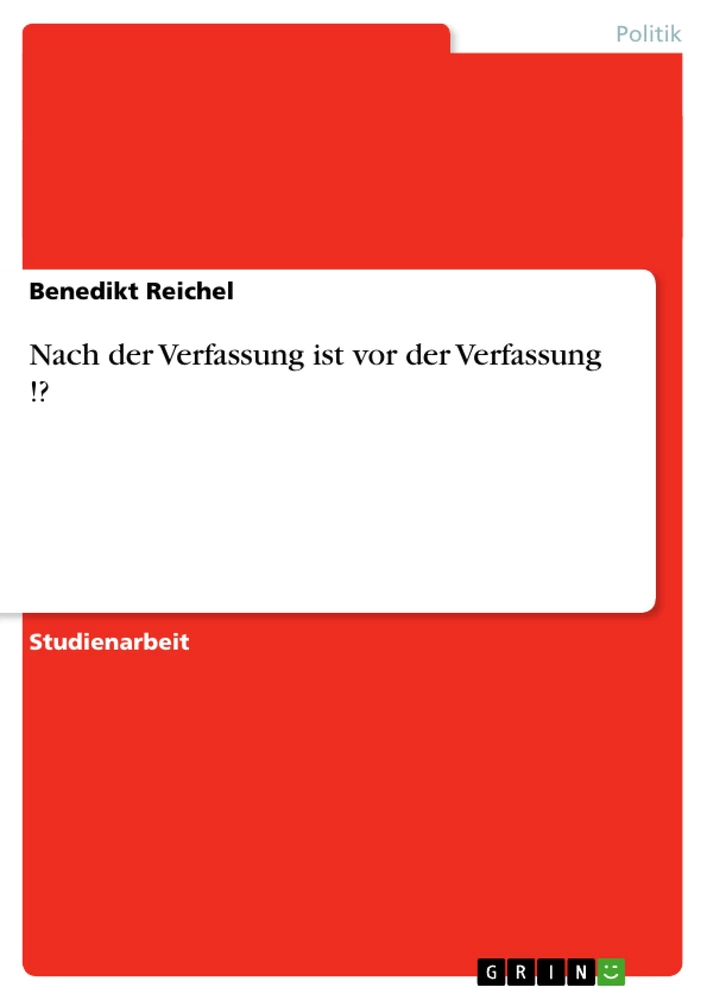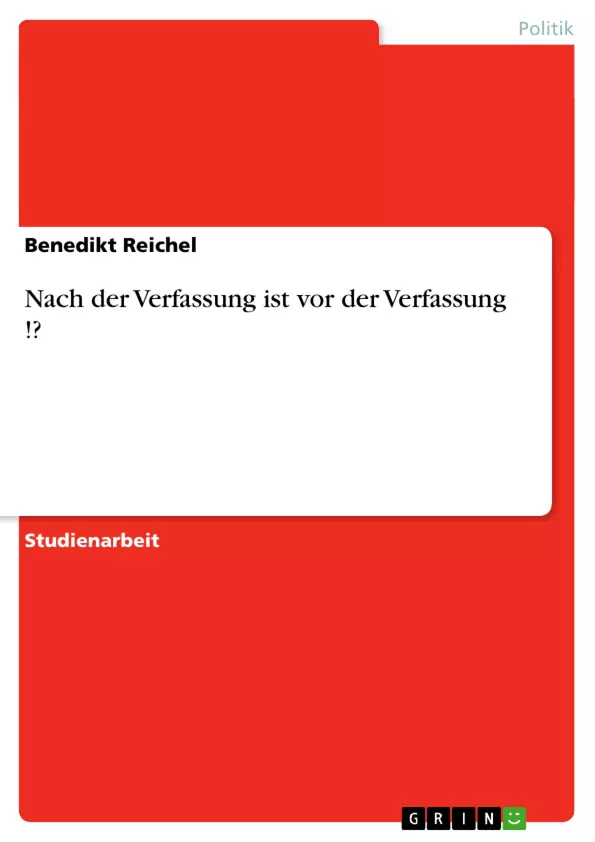„Wir müssen etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa schaffen. Nur so können Hunderte von Millionen schwer arbeitender Menschen wieder die einfachen Freuden und Hoffnungen zurückgewinnen, die das Leben lebenswert machen. [...] Die Struktur [...] muss so sein, dass die materielle Stärke eines einzelnen Staates von weniger großer Bedeutung ist. Kleine Nationen zählen ebensoviel wie große [...] Wenn es uns gelingen soll, die Vereinigten Staaten von Europa, oder welchen Namen auch immer sie tragen werden, zu errichten, müssen wir jetzt damit beginnen.“ 1 Der britische Premierminister Winston Churchill gab mit diesen Worten, ein Jahr nach Ende des zweiten Weltkrieges, den gedanklichen Startschuss für eine Vereinigung der europäischen Völker. Mit den Verträgen von Paris (1951) und Rom (1957) wurden kurze Zeit später die Grundsteine der heutigen Europäischen Union gelegt. Seit jenen Tagen entwickelt sich die Europäische Union territorial als auch politisch stetig weiter. Am 1. Mai 2004 traten zehn neue Staaten der Union bei und am 18. Juni 2004 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs eine Verfassung für Europa. Ein Tag den Bundeskanzler Gerhard Schröder als „wichtiges Signal für die Einigungsfähigkeit des gewachsenen Europas“ sieht. 2
Doch der Prozess der europäischen Integration macht nicht nur Fortschritte. Immer wieder wurden wichtige Entscheidungen und Reformen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner vereinbart, oder auf unbestimmte Zeit vertagt. Um diese Missstände zu verändern, berief der Europäische Rat ein Re-formkonvent. Dieser trat an um die EU konstitutionell neu zu gründen, den politischen Stillstand zu durchbrechen und für mehr Demokr atie zu sorgen. Nach fast zwei Jahren Arbeit legte er eine Verfassung für Europa vor. Ob dieses 465 Artikel umfassende Vertragswerk den an den Konvent gestellten Ansprüchen gerecht geworden ist, soll auf den folgenden Seiten untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gründe für ein geeintes Europa
- Europäische Identität
- Grenzen der Mehrheit
- Eine Verfassung für Europa
- Die Organe der Europäischen Union
- Die Inhalte der Verfassung
- Der EU-Präsident
- Die Reorganisation der Kommission
- Der EU-Außenminister
- Das Mehrheitsprinzip
- Die Regelung der Kompetenzen
- Kritik an der Verfassung
- ,,Beschwichtigungsformel“ der Europäischen Union
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den Verfassungsvertrag der Europäischen Union im Hinblick auf sein Reformpotenzial für die politische Struktur der Europäischen Union. Sie analysiert die Gründe für die Gründung einer europäischen Gemeinschaft und beleuchtet die Problematik der europäischen Identität im Kontext der Integration.
- Die Bedeutung der Europäischen Union für Friedenssicherung und Wirtschaftswachstum
- Die Herausforderungen der europäischen Identität und die Frage der staatsbürgerlichen Solidarität
- Die Rolle des Verfassungsvertrags für die Stärkung der Demokratie und die Überwindung des politischen Stillstands
- Die Reorganisation der europäischen Institutionen und die Einführung des Mehrheitsprinzips
- Die Kritik an der Verfassung und die Debatte um die Zukunft der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den historischen Hintergrund der europäischen Integration. Das zweite Kapitel beleuchtet die Gründe für die Gründung eines geeinten Europas, insbesondere die Bedeutung von Friedenssicherung und Wirtschaftswachstum. Das dritte Kapitel thematisiert die Herausforderungen der europäischen Identität, insbesondere die Schwierigkeit, eine gemeinsame Identität über die nationalen Grenzen hinweg zu entwickeln. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Grenzen des Mehrheitsprinzips und den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsstaaten. Das vierte Kapitel analysiert den Verfassungsvertrag der Europäischen Union, wobei die Reorganisation der europäischen Institutionen, die Einführung des Mehrheitsprinzips und die Kritik an der Verfassung im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Verfassung, Integration, Identität, Demokratie, Mehrheitsprinzip, Kritik, Reformen, Institutionen, Wirtschaftswachstum, Friedenssicherung.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des EU-Reformkonvents?
Der Konvent sollte die EU konstitutionell neu gründen, den politischen Stillstand durchbrechen und für mehr Demokratie sorgen.
Welche neuen Ämter sah der Verfassungsvertrag vor?
Geplant waren unter anderem ein ständiger EU-Präsident und ein EU-Außenminister.
Was versteht man unter dem Mehrheitsprinzip in der EU?
Es ist ein Verfahren zur Entscheidungsfindung, das den bisherigen Zwang zur Einstimmigkeit in vielen Bereichen ablösen sollte, um die Handlungsfähigkeit zu erhöhen.
Warum ist die europäische Identität problematisch?
Es ist schwierig, eine gemeinsame Identität und staatsbürgerliche Solidarität über nationale Grenzen hinweg zu entwickeln.
Welche Kritik wurde am Verfassungsvertrag geübt?
Kritiker bemängelten unter anderem eine mangelnde Bürgernähe und die Komplexität des 465 Artikel umfassenden Vertragswerks.
- Arbeit zitieren
- Benedikt Reichel (Autor:in), 2004, Nach der Verfassung ist vor der Verfassung !?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34953