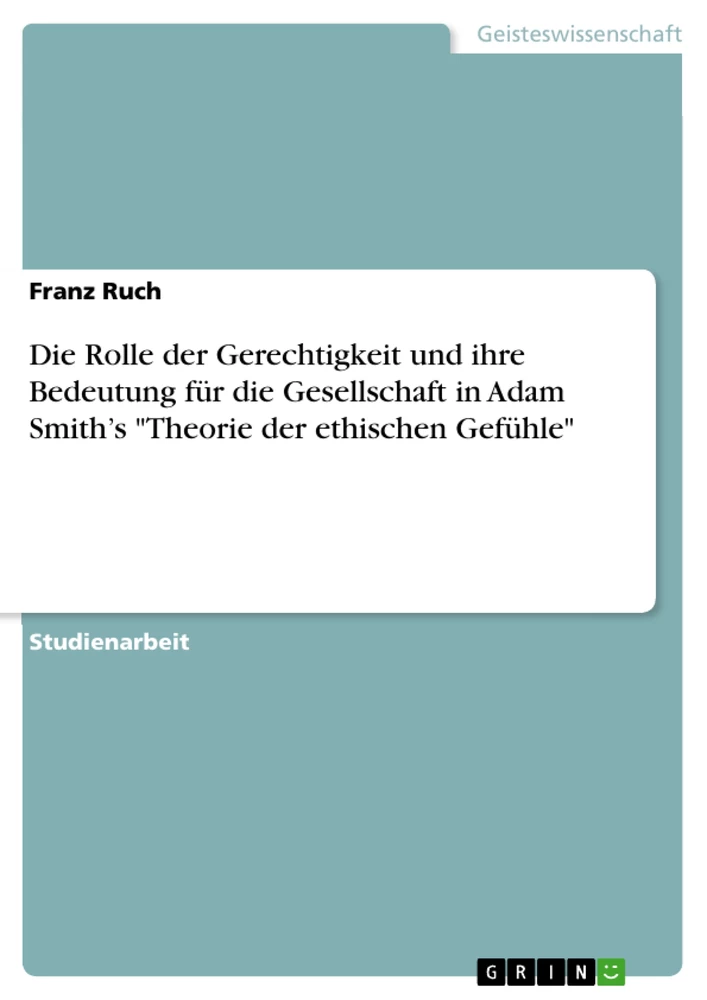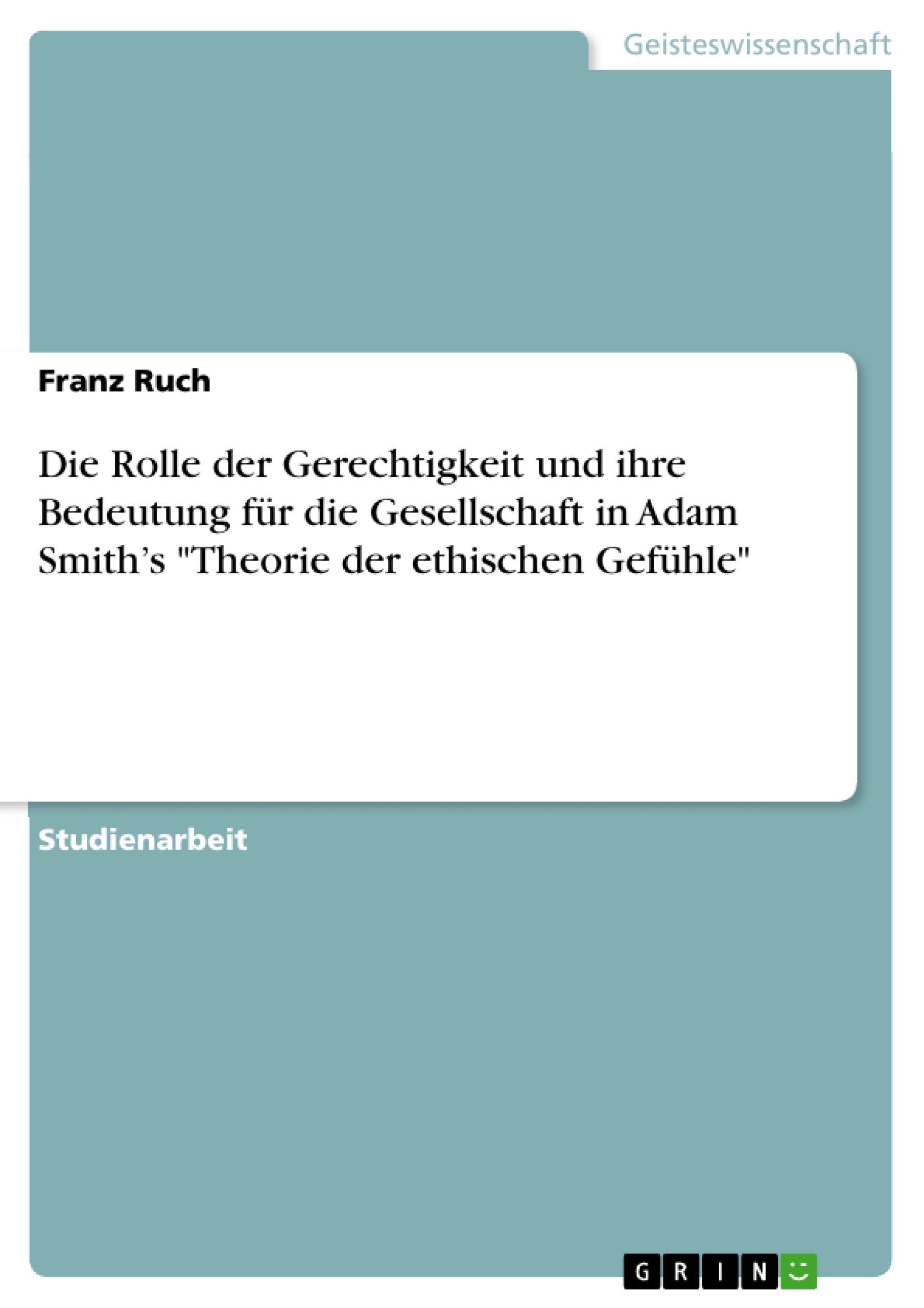Betrachtet man die philosophische und politische Diskurslandschaft in Hinblick auf Adam Smith, so wird dieser in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts geborene schottische Philosoph hauptsächlich mit seinem berühmten ökonomischen Hauptwerk „Der Wohlstand der Nationen“ in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist dieses in der öffentlichen Wahrnehmung am populärsten in Erscheinung getretene Werk über siebzehn Jahre nach Smiths Hauptwerk der Moralphilosophie „Theorie der ethischen Gefühle“ erschienen. Smith folgt formal der Aristotelischen Dreiteilung aus Ethik, Ökonomie und Politik. Die "Theorie der ethischen Gefühle" bildet so sein Hauptwerk über die Ethik und der "Wohlstand der Nationen" das Hauptwerk der Ökonomie.
Das erstmals 1759 in London erschienene Werk „The Theory of Moral Sentiments“ beschäftigt sich im Kern mit der Frage, wie der Mensch als soziales Wesen fühlt und wie es ihm möglich ist moralisch zu handeln, bzw. seine und andere Handlungen zu beurteilen und auf moralische Richtigkeit zu prüfen. Das von Smith entwickelte Prinzip der Sympathie als Grundpfeiler seiner Moraltheorie ermöglicht dem Menschen Handlungen zu billigen oder nicht zu billigen, wohingegen der von ihm eingeführte „unparteiische Beobachter“ das Kriterium für diese Beurteilung bildet. Methodisch bedient sich Smith dabei einer fast ausschließlich deskriptiven Darstellung der ethischen Gefühle in Verbindung mit dem Ziel der Rückführung dieser Phänomene auf gewisse grundlegende Prinzipien.
In der folgenden Arbeit beschäftige ich mich mit der Rolle der Gerechtigkeit und der Wohltätigkeit in Smiths Moraltheorie und ihrer besonderen Bedeutung für die Gesellschaft. Ich werde mich zunächst mit seinen Überlegungen über die Belohnung und Bestrafung von Handlungen befassen, welches den Ausgangspunkt für die folgende Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffs darstellt. Diese trifft Smith in Unterscheidung zur Wohltätigkeit, welche sich mit der Gerechtigkeit vergleichend untersuchen lässt, und somit den unterschiedlichen Charakter dieser beiden Tugenden herausstellt. Ausgehend von dieser Analyse kann dann die Bedeutung der Gerechtigkeit für die Gesellschaft und für den Menschen in der Gemeinschaft betrachtet werden. Im Kern steht dabei die Frage ob eine Gesellschaft ohne Gerechtigkeit möglich ist bzw. funktionieren kann, und wie Smiths Antwort auf diese Frage begründet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Begriffsentwicklung.
- 2.1 Belohnung und Bestrafung
- 2.2 Gerechtigkeit und Wohltätigkeit
- 3. Die Bedeutung für die Gesellschaft.
- 3.1 Gerechtigkeit und Wohltätigkeit im Vergleich
- 3.2 Die zweifache Begründung von Strafe
- 4. Exkurs
- 4.1 Die besondere Rolle der Gerechtigkeit unter den Tugenden
- 4.2 Die drei Arten der Gerechtigkeit
- 5. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Gerechtigkeit und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft in Adam Smiths Theorie der ethischen Gefühle. Sie beleuchtet Smiths Überlegungen zur Belohnung und Bestrafung von Handlungen und wie diese die Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffs beeinflussen.
- Die Unterscheidung zwischen Gerechtigkeit und Wohltätigkeit
- Die Bedeutung der Gerechtigkeit für das Zusammenleben in der Gesellschaft
- Die besondere Rolle der Gerechtigkeit unter den Tugenden
- Smiths Argumentation für die Notwendigkeit von Gerechtigkeit
- Die Bedeutung der Gerechtigkeit für das Individuum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt Adam Smith als schottischen Philosophen vor, der vor allem für sein ökonomisches Hauptwerk "Der Wohlstand der Nationen" bekannt ist. Die Hausarbeit beleuchtet Smiths "Theorie der ethischen Gefühle" und seine Konzeptionen zur Moral und den ethischen Gefühlen. Sie untersucht die Rolle der Gerechtigkeit und Wohltätigkeit in Smiths Moraltheorie und ihre Bedeutung für die Gesellschaft.
2. Die Begriffsentwicklung.
2.1 Belohnung und Bestrafung
Dieser Abschnitt analysiert Smiths Überlegungen zu den Gegenständen der Belohnung und Bestrafung. Smith argumentiert, dass bestimmte Eigenschaften von Handlungen eine besondere Art von Billigung oder Missbilligung hervorrufen. Handlungen, die als lobenswert empfunden werden, führen zu einem Gefühl der Belohnung, während strafwürdige Handlungen ein Gefühl der Bestrafung erzeugen.
2.2 Gerechtigkeit und Wohltätigkeit
Dieser Abschnitt vergleicht die Begriffe der Gerechtigkeit und Wohltätigkeit in Smiths Theorie. Smith unterscheidet zwischen beiden Tugenden und untersucht, wie sie sich in der Gesellschaft manifestieren.
3. Die Bedeutung für die Gesellschaft.
3.1 Gerechtigkeit und Wohltätigkeit im Vergleich
Dieser Abschnitt untersucht die Unterschiede zwischen Gerechtigkeit und Wohltätigkeit in Bezug auf ihre Bedeutung für die Gesellschaft. Smith zeigt auf, wie beide Tugenden unterschiedliche Funktionen erfüllen und zum Zusammenleben beitragen.
3.2 Die zweifache Begründung von Strafe
Dieser Abschnitt beleuchtet Smiths Argumentation für die Notwendigkeit von Strafe in der Gesellschaft. Smith beschreibt zwei Begründungen für Strafe: Vergeltung und Abschreckung.
4. Exkurs
4.1 Die besondere Rolle der Gerechtigkeit unter den Tugenden
Dieser Abschnitt untersucht die besondere Rolle der Gerechtigkeit unter den Tugenden in Smiths Theorie. Smith argumentiert, dass Gerechtigkeit eine zentrale Rolle für das Funktionieren einer Gesellschaft spielt.
4.2 Die drei Arten der Gerechtigkeit
Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Arten der Gerechtigkeit, die Smith in seiner Theorie unterscheidet. Es werden die Unterschiede zwischen kommutativer, distributiver und politischer Gerechtigkeit erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Adam Smith, Theorie der ethischen Gefühle, Gerechtigkeit, Wohltätigkeit, Belohnung, Bestrafung, Sympathie, unparteiischer Beobachter, Gesellschaft, Moral, Tugend.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Adam Smiths "Theorie der ethischen Gefühle"?
Das Werk von 1759 untersucht, wie Menschen als soziale Wesen fühlen, moralisch handeln und das Verhalten anderer beurteilen.
Was ist der "unparteiische Beobachter"?
Es ist ein von Smith eingeführtes Gedankenkonstrukt, das als inneres Kriterium dient, um Handlungen objektiv auf ihre moralische Richtigkeit zu prüfen.
Wie unterscheidet Smith Gerechtigkeit von Wohltätigkeit?
Wohltätigkeit ist freiwillig und lobenswert, aber nicht erzwingbar. Gerechtigkeit hingegen ist die notwendige Basis der Gesellschaft; ihre Verletzung zieht Strafe nach sich.
Kann eine Gesellschaft ohne Gerechtigkeit funktionieren?
Laut Smith nicht. Während eine Gesellschaft ohne Wohltätigkeit zwar unschön, aber existent sein kann, würde sie ohne Gerechtigkeit in Chaos zerfallen.
Welche drei Arten der Gerechtigkeit nennt Smith?
Smith unterscheidet zwischen kommutativer, distributiver und politischer Gerechtigkeit.
- Quote paper
- Franz Ruch (Author), 2015, Die Rolle der Gerechtigkeit und ihre Bedeutung für die Gesellschaft in Adam Smith’s "Theorie der ethischen Gefühle", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349728