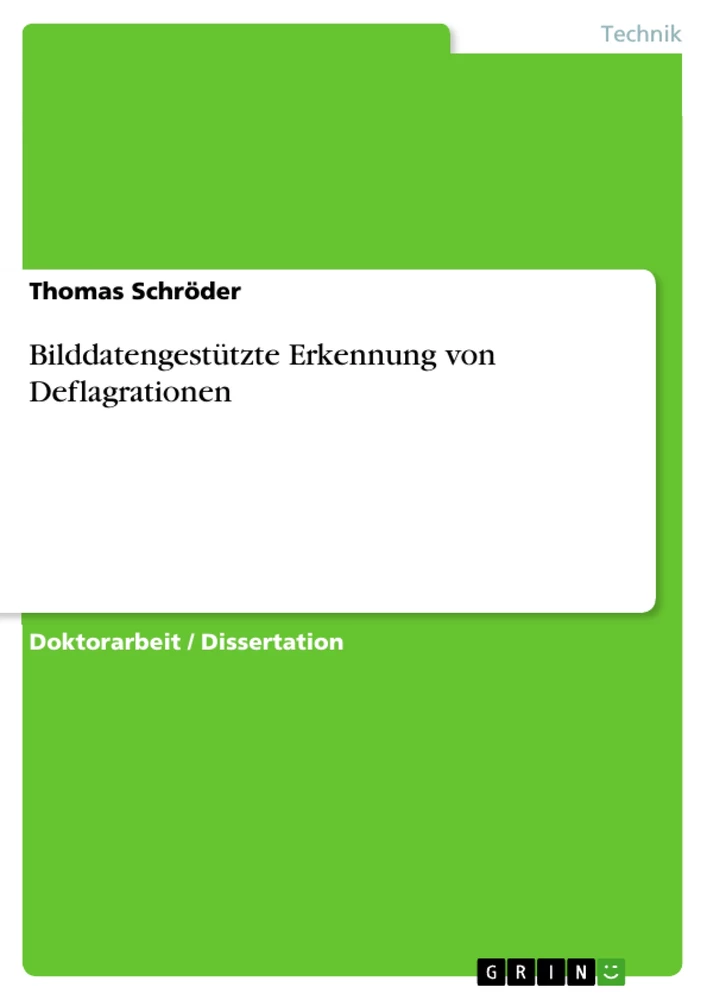Mit der Neuausrichtung des Aufgabengebietes der Bundeswehr infolge der veränderten politischen Lage in der Welt seit Ende des Kalten Krieges haben sich auch die Anforderungen an das Gesamtschutzkonzept für militärische Fahrzeuge stark gewandelt. Die Landesverteidigung im Bündnisrahmen gegen mögliche, aber unwahrscheinliche Bedrohungen stellt nicht mehr die alleinige Hauptaufgabe der Bundeswehr dar. Immer mehr in den Fokus kommen die Einsätze zur Verhütung internationaler Konflikte und die Krisenbewältigung sowie der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Damit ändert sich auch das Bedrohungsszenario ausgehend von symmetrischen Angriffen regulärer Armeen hin zu asymmetrischen Angriffen irregulärer Kräfte. Dennoch ist und bleibt der Schutz der Soldatinnen und Soldaten die oberste Priorität und muss an die sich ändernden Gegebenheiten angepasst und wann immer möglich verbessert werden.
Für die Einsätze innerhalb internationaler Bündnissysteme eigenen sich besonders leichte Radfahrzeuge, die sowohl taktisch, operativ als auch strategisch mobil sind. Dementsprechend muss sich auch das Gesamtschutzkonzept dieser Fahrzeuge stark an den möglichen Gefahren während der Operationen orientieren. Hierbei treten die direkten Schutzmaßnahmen, die primär die Überlebensfähigkeit der Besatzung zum Ziel haben, in den Fokus der weiteren Betrachtung.
Ein integraler Bestandteil dieser direkten Schutzmaßnahmen in militärischen Fahrzeugen ist die Brandunterdrückungsanlage (BUA). Dieses Löschsystem dient zur Reduzierung von Sekundärschäden infolge eines explosionsähnlichen Verbrennungsvorganges (Deflagration) im Kampfraum des Fahrzeuges. Dabei sollen die Deflagrationen bereits in ihren Anfangsstadien erfasst und gelöscht werden, um ernsthafte Verletzungen der Besatzung zu vermeiden. Typische Löschzeiten liegen für diese Anwendungsumgebung im Bereich von 150 – 250 ms. Ein entscheidender Faktor des Löschvorganges ist die schnelle und fehlerfreie Detektion. Aktuelle optische Detektionssysteme basieren immer noch auf dem klassischen Angriffsprofil und werden den heutigen Bedrohungsszenarien nur noch bedingt gerecht. Zudem liefern diese Systeme nur das Detektionssignal und keine zusätzlichen Informationen über das erfasste Ereignis, was wiederum einen Spielraum für Fehlalarme durch Störquellen zulässt. Dabei könnte sich mit zusätzlichen Informationen das nachfolgende Löschsystem effizienter betreiben lassen. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Grundlagen zur Deflagrationsdetektion
- Begriffsklärung: Feuer und Deflagration
- Aktuelle Methoden zur Detektion von Verbrennungsvorgängen
- Deflagrationsdetektion mittels optischer Detektoren
- Digitale Bildverarbeitung zur Erfassung von Feuern
- Gefährdungsszenarien
- Militärische Bedrohungsszenarien
- Zivile Anwendungsgebiete am Beispiel der Munitionsproduktion
- Konzept zur Deflagrationsdetektion
- Allgemeine Anforderungen
- Definition und Einordnung des Detektionskonzeptes
- Versuchsaufbauten
- Versuchsstand zur Simulation von Gasstrahlung
- Einrichtungen zur Nachbildung von Gasstrahlung
- Analytische Beschreibung der Strahlungsquellen
- Kleinskalige Propangas-Deflagrationen
- Bestimmung der physikalischen Randbedingungen
- Aufbau und Wirkungsweise des Versuchsstandes
- Charakterisierung der erzeugten Deflagrationen
- Nachbildung von realitätsnahen Szenarien
- Einrichtung zur Erzeugung von JP-8-basierten Deflagrationen
- Simulation von Angriffen mit BKM
- Simulation von Feuern definierter Größe
- Versuchsstand zur Simulation von Gasstrahlung
- Bildverarbeitungsbasierte Detektion
- Auswahl eines Detektionssystems
- Untersuchung von aktuellen Detektions- und Sensorsystemen
- Potential eines hochdynamischen Kamerasystems
- Modifikation des Detektionskonzeptes
- Strukturierung des Detektionsablaufes
- Identifizierung deflagrations- und feuerähnlicher Bildpunkte
- Chromatische Merkmale
- Erfassung der Intensitätsdynamik
- Parametrische Differenzierung von Verbrennungsvorgängen
- Zweidimensionale Expansionserfassung
- Auswahl eines Detektionssystems
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Dissertation befasst sich mit der Entwicklung eines bilddatengestützten Systems zur Erkennung von Deflagrationen. Ziel ist es, ein robustes und zuverlässiges System zu entwickeln, das in der Lage ist, Deflagrationen frühzeitig zu erkennen und eine entsprechende Alarmierung auszulösen.
- Analyse aktueller Methoden zur Deflagrationsdetektion
- Entwicklung eines neuartigen Detektionskonzepts
- Aufbau von Versuchsständen zur Simulation von Deflagrationen
- Anwendung von Bildverarbeitungsmethoden zur Detektion von Deflagrationen
- Bewertung der Leistungsfähigkeit des entwickelten Systems
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Dissertation beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik und den Aufbau der Arbeit erläutert. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen zur Deflagrationsdetektion, einschließlich der Begriffsklärung, aktueller Detektionsmethoden und relevanter Gefährdungsszenarien. Darüber hinaus wird das Detektionskonzept vorgestellt, das in dieser Arbeit verfolgt wird.
Kapitel 3 beschreibt die entwickelten Versuchsstände zur Simulation von Deflagrationen, unterteilt in drei Hauptbereiche: die Simulation von Gasstrahlung, die Erzeugung von kleinmaßstäblichen Propangas-Deflagrationen und die Nachbildung von realitätsnahen Szenarien.
Im Zentrum der Dissertation steht Kapitel 4, in dem die bildverarbeitungsbasierte Detektion von Deflagrationen behandelt wird. Hier werden die Auswahl eines geeigneten Detektionssystems, die Strukturierung des Detektionsablaufs sowie die Identifizierung deflagrations- und feuerähnlicher Bildpunkte näher erläutert. Darüber hinaus wird die parametrische Differenzierung von Verbrennungsvorgängen anhand der zweidimensionalen Expansionserfassung diskutiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Deflagrationsdetektion, Bildverarbeitung, Kamerasysteme, Verbrennungsvorgänge, Gefährdungsszenarien, Simulation, Versuchsstand, Detektionskonzept, Expansion, Intensitätsdynamik
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Deflagration im militärischen Kontext?
Eine Deflagration ist ein explosionsähnlicher Verbrennungsvorgang, der z. B. bei einem Angriff auf ein gepanzertes Fahrzeug im Kampfraum entstehen kann.
Wie funktioniert eine Brandunterdrückungsanlage (BUA)?
Sie detektiert Feuer innerhalb von Millisekunden und löst ein Löschsystem aus, um Sekundärschäden und Verletzungen der Besatzung zu verhindern.
Warum wird bildverarbeitungsbasierte Detektion untersucht?
Aktuelle optische Sensoren liefern oft nur ein einfaches Signal. Bildverarbeitung bietet zusätzliche Informationen (z. B. Expansion des Feuers), um Fehlalarme zu reduzieren.
Welche Versuchsstände wurden für die Dissertation genutzt?
Es wurden Stände zur Simulation von Gasstrahlung, Propangas-Deflagrationen und realitätsnahen JP-8-basierten Bränden aufgebaut.
Welche Merkmale nutzt das System zur Erkennung?
Das System analysiert chromatische Merkmale (Farbe), die Intensitätsdynamik und die zweidimensionale Expansionsrate der Verbrennungsvorgänge.
- Arbeit zitieren
- Thomas Schröder (Autor:in), 2016, Bilddatengestützte Erkennung von Deflagrationen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349760