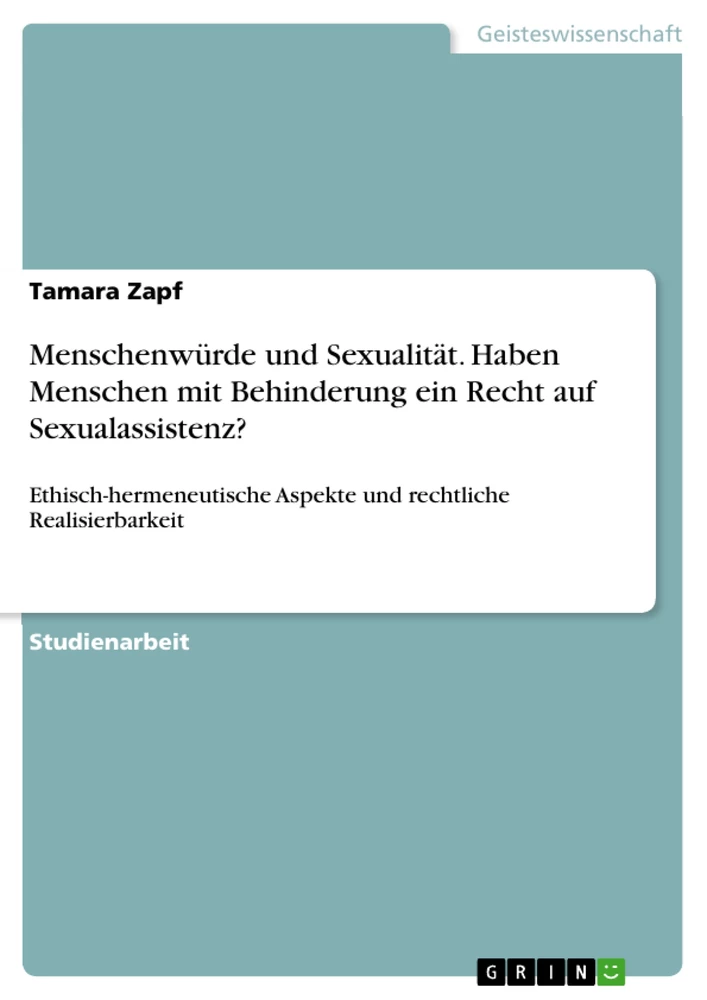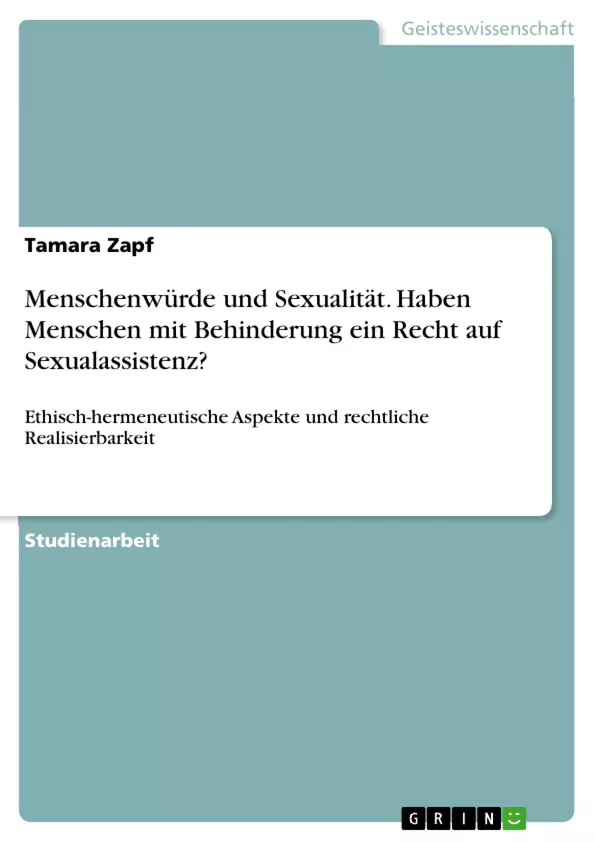Lange Zeit wurde in der Behindertenhilfe jedwede Form der Sexualität von Menschen mit Behinderung geleugnet, verdrängt und verboten. Erst als der Gedanke der Normalisierung in den 1980er und 1990er Jahren Einzug in die Behindertenhilfe hielt, kam es zu einer radikalen Neuorientierung in der herkömmlichen Behindertenhilfe, auch in Bezug auf das Thema Sexualität. Dieser Perspektivenwechsel war gekennzeichnet von folgender Erkenntnis: Menschen mit Behinderung unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen keineswegs von Menschen ohne Behinderung. Sie differenzieren sich einzig und allein in den Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse umzusetzen. Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich der Leitgedanke des Normalisierungsprinzips – nämlich der Auftrag der Behindertenhilfe, das Leben von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen, wozu neben Arbeit und Schule beispielsweise auch die Sexualität zählt, hin zur Normalität zu fördern. Die Sexualität von Menschen mit Behinderung wird somit nicht länger als Problem angesehen, sondern als Aufgabe.
Diese Entwicklung erfuhr mit dem Inkrafttreten des Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe – am 1. Juli 2001 eine Steigerung und fand schließlich eine rechtliche Grundlage: Programmatisches Hauptziel des SGB IX ist nicht die Angleichung der Lebensumstände von Menschen mit Behinderung an die derer ohne Behinderung, sondern die Förderung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen. Es soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, ihr Leben so gestalten zu können, wie sie es sich vorstellen, und nicht wie andere es für richtig halten.
Für den Lebensbereich der Sexualität bedeutet dies folgendes: Betroffene haben einen Anspruch darauf, ihre Sexualität selbstbestimmt leben zu können. Es ist nicht länger nur Aufgabe der Behindertenhilfe Wege zum Ausleben einer eigenen Sexualität zu ebnen, nein es ist die Pflicht der Behindertenhilfe, jedem Menschen mit Behinderung zu einer selbstbestimmten Sexualität zu verhelfen.
Doch worauf gründet dieser Anspruch auf sexuelle Selbstbestimmung? Und auf welche Weise kann die Förderung einer selbstbestimmten Sexualität erfolgen? Lässt sich aus dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch der konkrete Anspruch auf sexuelle Unterstützungshandlungen wie die Sexualassistenz ableiten? Und inwiefern trägt diese Assistenz tatsächlich zur Verwirklichung einer selbstbestimmten Sexualität bei? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die vorliegende Studienarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sexualität und Selbstbestimmung
- Begriffsbestimmung der Sexualität
- Funktionen von Sexualität
- Das Menschenrecht auf Sexualität
- Selbstbestimmung: verfassungsrechtlicher Grundsatz und ethisches Grundprinzip
- Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung
- Sexuelle Selbstbestimmung als Rechtsgut
- Standards zur Verwirklichung sexueller Selbstbestimmung
- Sexualassistenz - ein Konzept zur Verwirklichung sexueller Selbstbestimmung?
- Modelle der Sexualassistenz
- Die Bedeutung der Sexualassistenz für eine selbstbestimmte Sexualität - eine kritische Betrachtung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Thema der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung und untersucht, ob ein Recht auf sexuelle Assistenz besteht. Hierzu werden zunächst die Begriffe Sexualität und Selbstbestimmung definiert und ihre Bedeutung im Kontext der Menschenrechte beleuchtet. Anschließend wird das Recht von Menschen mit Behinderung auf eine selbstbestimmte Sexualität anhand von Gesetzen und Standards untersucht. Im Zentrum der Arbeit steht die Analyse des Konzepts der Sexualassistenz und dessen Beitrag zur Verwirklichung sexueller Selbstbestimmung.
- Begriffliche Klärung von Sexualität und Selbstbestimmung im Kontext der Menschenrechte
- Rechtliche Grundlagen und Standards zur Verwirklichung sexueller Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung
- Analyse des Konzepts der Sexualassistenz und dessen Bedeutung für die sexuelle Selbstbestimmung
- Ethische und rechtliche Implikationen der Sexualassistenz
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Sexualassistenz zur Förderung sexueller Selbstbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ein und beleuchtet den Wandel in der Behindertenhilfe, der weg von der Verdrängung und hin zur Förderung sexueller Selbstbestimmung führte. Das Kapitel 2 definiert den Begriff der Sexualität, erläutert ihre vielfältigen Funktionen und begründet das Menschenrecht auf Sexualität. Darüber hinaus werden verfassungsrechtliche und ethische Argumente für das Recht auf Selbstbestimmung vorgestellt. Kapitel 3 widmet sich der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung, indem es die rechtlichen Grundlagen und Standards zur Verwirklichung dieses Rechts beleuchtet. Kapitel 4 stellt das Konzept der Sexualassistenz vor, diskutiert unterschiedliche Modelle und analysiert kritisch, inwiefern diese Form der Unterstützung tatsächlich zur Förderung sexueller Selbstbestimmung beitragen kann. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Sexuelle Selbstbestimmung, Menschen mit Behinderung, Sexualassistenz, Normalisierungsprinzip, Behindertenrechtskonvention, SGB IX, ethische Aspekte, rechtliche Realisierbarkeit, Selbstbestimmung, Inklusion, Teilhabe
Häufig gestellte Fragen
Haben Menschen mit Behinderung ein Recht auf Sexualität?
Ja, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht und im deutschen Recht (z. B. SGB IX) als Teil der Teilhabe und Selbstbestimmung verankert.
Was versteht man unter dem Normalisierungsprinzip?
Es ist der Leitgedanke, Menschen mit Behinderung ein Leben zu ermöglichen, das dem von Menschen ohne Behinderung in allen Bereichen, inklusive der Sexualität, so nah wie möglich kommt.
Was ist Sexualassistenz?
Sexualassistenz umfasst verschiedene Modelle der Unterstützung, um Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen das Ausleben ihrer Sexualität zu ermöglichen.
Leitet sich ein rechtlicher Anspruch auf Sexualassistenz ab?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob aus dem allgemeinen Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ein konkreter Anspruch auf kostenpflichtige Assistenzleistungen hervorgeht.
Welche Rolle spielt das SGB IX in diesem Kontext?
Das SGB IX verpflichtet die Behindertenhilfe zur Förderung der Selbstbestimmung und schafft die Grundlage für die Teilhabe in allen Lebensbereichen.
- Quote paper
- Tamara Zapf (Author), 2016, Menschenwürde und Sexualität. Haben Menschen mit Behinderung ein Recht auf Sexualassistenz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349976