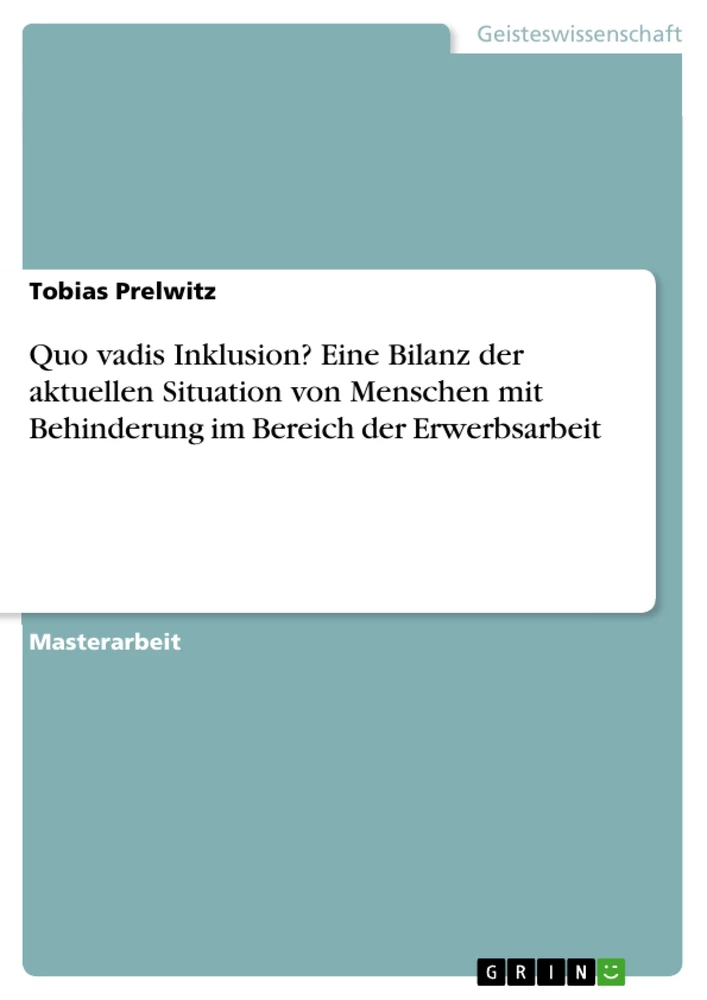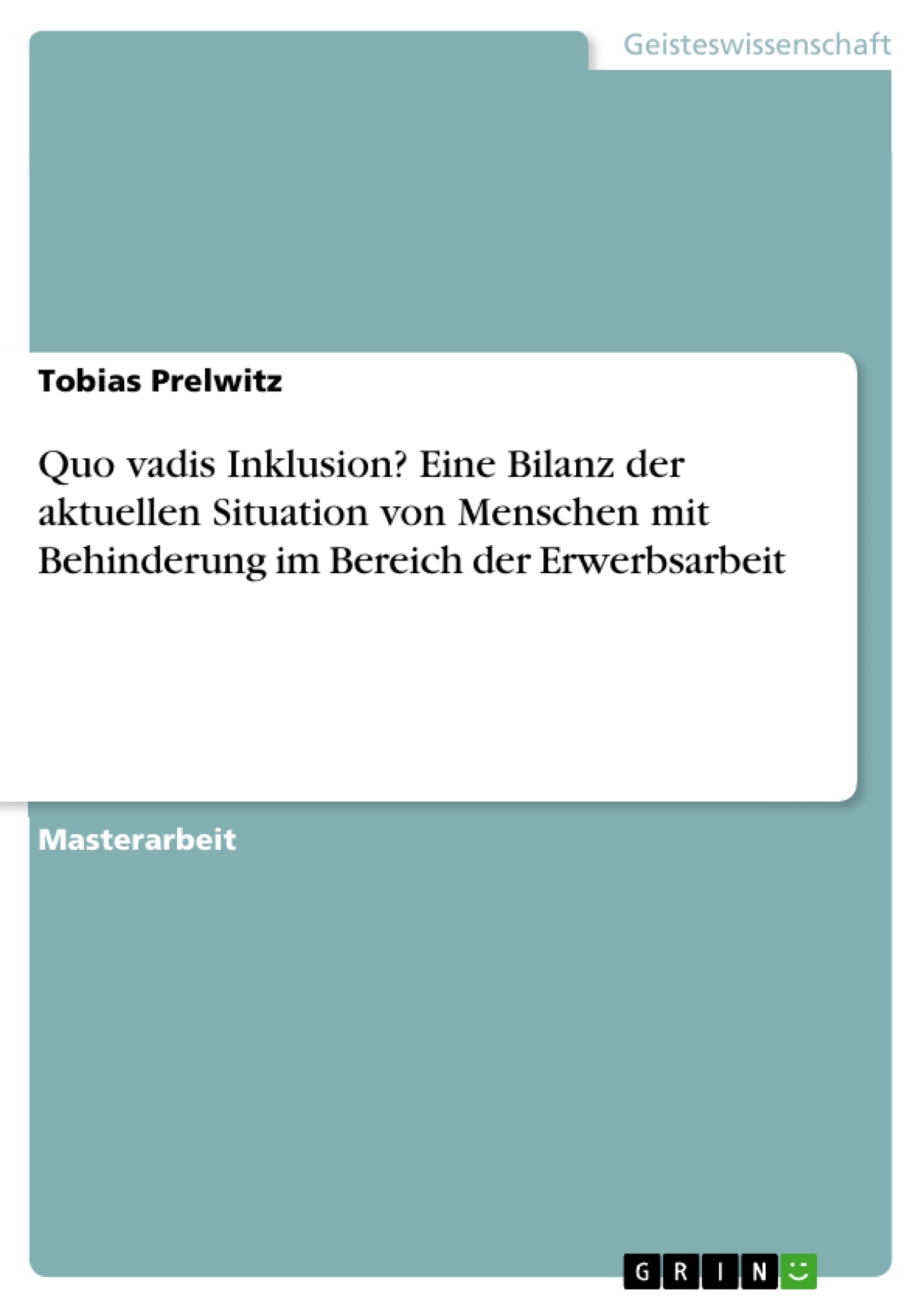Die Masterarbeit beschäftigt sich primär mit der Lage von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dabei wird mittels fünf Kriterien (Eingebundenheitsgrade, Varianz, Institutioneller Status, staatliche Involvierung und Wahrnehmung) und verschiedenen empirischen Studien überprüft, ob die Situation dem Leitgedanken des Inklusionskonzepts gerecht wird und an welchen Stellen Veränderungsbedarf besteht.
Wie differenziert sind die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse, wie inkludiert Menschen mit Behinderung in den bundesdeutschen Unternehmen, was wird von Seiten der Firmen bzw. der Bundesregierung getan, um die Gesellschaftsgruppe zu fördern und wie nimmt die Durchschnittsbevölkerung bzw. wie nehmen die Menschen mit Behinderung selbst ihre derzeitige Arbeitssituation wahr?
Diesen Teilfragen widmet sich die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung, um anschließend durch das Heranziehen verschiedener Theorieansätze aus Pädagogik und Sozialwissenschaft eine eindeutige Bilanz der aktuellen Situation von Menschen mit Behinderung im Bereiche der Erwerbsarbeit aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Fragestellung, Methode und Struktur.
- 2.1. Problem und Fragestellung.......
- 2.2. Methodik und Zielsetzung.
- 2.2.1. Ergänzende Sekundäranalyse.………………………..\n
- 2.2.2. Anlehnung an die Typologische Analyse
- 3. Forschungsstand........
- 3.1. Literaturüberblick..\n
- 3.2. Datengrundlage ....
- 3.2.1. Teilhabebericht der Bundesregierung 2013.\n
- 3.2.2. Verschiedene Mikrozensus 2003 bis 2015
- 3.2.3. Statistik der schwerbehinderten Menschen 2011
- 3.2.4. Allensbach-Studie zur gesellschaftlichen Teilhabesituation von Menschen mit\nBehinderung 2011
- 3.2.5. Inklusionsbarometer der Aktion Mensch zum Bereich Arbeit 2013\n....................
- 3.2.6. Abschlussbericht der Gesamtbetreuung zum Programm Job4000.\n
- 3.2.7. Bericht zur Arbeitsmarktsituation von schwerbehinderten Menschen im Jahr\n2013
- 3.3. Zwischenfazit.\n
- 4. Theoretische Grundlagen.\n
- 4.1. Das Verständnis von Behinderung\n
- 4.1.1. Das medizinische Modell von Behinderung\n
- 4.1.2. Das soziale Modell von Behinderung\n
- 4.1.3. Die Arbeitsdefinition...\n
- 4.2. Paradigmen der Soziologie der Behinderten.......
- 4.2.1. Das personenorientierte Paradigma ..\n
- 4.2.2. Das interaktionistische Paradigma
- 4.2.3. Das systemtheoretische Paradigma
- 4.2.4. Das gesellschaftsorientierte Paradigma..\n
- 4.3. Der Prozess des gesellschaftlichen Einbezugs ....
- 4.3.1. Soziale Teilhabe.\n
- 4.3.2. Exkurs zu den systemtheoretischen Verbindungen.\n
- 4.3.3. Exklusion.....
- 4.3.4. Separation.......
- 4.3.5. Integration.\n
- 4.3.6. Inklusion........\n
- 4.4. Zwischenfazit.\n
- 5. Auswahl des Untersuchungsbereichs, Hypothesen und Kriterienerstellung..\n
- 5.1. Erwerbsarbeit als Untersuchungsbereich\n
- 5.2. Teilhabedimensionen.\n
- 5.3. Hypothesen........
- 5.4. Kriterien..\n
- 5.4.1. Eingebundenheitsgrade.………………………………\n
- 5.4.2. Varianz
- 5.4.3. Institutioneller Status.\n
- 5.4.4. Staatliche Involvierung
- 5.4.5. Wahrnehmung..\n
- 5.5. Zwischenfazit.\n
- 6. Deskriptive Analyse (Typenkonstruktion)\n
- 6.1. Einleitender demografischer Überblick...\n
- 6.1.1. Behinderungsquoten.\n
- 6.1.2. Schwerbehinderung und Grade der Behinderung
- 6.1.3. Verteilung von Behinderung auf Geschlecht und Alter\n||\n
- 6.2. Eingebundenheitsgrade.….......
- 6.3. Varianz.\n
- 6.3.1. Arbeitsbereiche\n
- 6.3.2. Lebensunterhalt....\n
- 6.3.3. Arbeitsverhältnisse.\n
- 6.3.4. Zwischenfazit.\n
- 6.4. Institutioneller Status\n
- 6.4.1. Realisierte Teilhabe\n
- 6.4.2. Zugänglichkeit/Gleichheit........\n
- 6.4.3. Zwischenfazit.\n
- 6.5. Staatliche Involvierung.\n
- 6.5.1. 5%-Beschäftigungsquote von Menschen mit Schwerbehinderung .\n
- 6.5.2. Job4000-Programm\n
- 6.5.3. Bundesteilhabegesetz........\n
- 6.5.4. Zwischenfazit.\n
- 6.6. Wahrnehmung......\n
- 6.6.1. Selbstwahrnehmung..\n
- 6.6.2. Fremdwahrnehmung.\n
- 6.6.3. Zwischenfazit.\n
- 6.7. Zwischenfazit....\n
- 7. Modellzuordnung (Typendeskription).\n
- 7.1. Qualität der Teilhabe ……………………….\n
- 7.1.1. Materielle Teilhabe...\n
- 7.1.2. Politisch-institutionelle Teilhabe\n
- 7.1.3. Kulturelle Teilhabe...\n
- 7.2. Gesamthöhe der Teilhabe
- 7.3. Erklärungsansätze.........\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit "Quo vadis Inklusion?" analysiert die aktuelle Situation von Menschen mit Behinderung im Bereich der Erwerbsarbeit. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und so ein umfassendes Bild der aktuellen Situation zu zeichnen.
- Soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Kontext von Erwerbsarbeit
- Analyse der Eingebundenheitsgrade von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben
- Untersuchung der Varianz von Arbeitsbereichen, Lebensunterhalt und Arbeitsverhältnissen
- Bedeutung des institutionellen Status und der staatlichen Involvierung für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung
- Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung im Arbeitskontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung, die Methode und die Struktur der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet den Forschungsstand und die Datengrundlage, auf der die Arbeit basiert. In Kapitel 3 werden die theoretischen Grundlagen und die verschiedenen Modelle von Behinderung sowie der Prozess des gesellschaftlichen Einbezugs erläutert. Kapitel 4 widmet sich der Auswahl des Untersuchungsbereichs, der Erwerbsarbeit, und definiert die relevanten Teilhabedimensionen, Hypothesen und Kriterien. Kapitel 5 präsentiert eine deskriptive Analyse der Eingebundenheitsgrade, der Varianz, des institutionellen Status, der staatlichen Involvierung und der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben. Kapitel 6 widmet sich der Modellzuordnung und der Typendeskription der verschiedenen Formen der Teilhabe, die im Kontext der Erwerbsarbeit beobachtet werden können.
Schlüsselwörter
Inklusion, Behinderung, Erwerbsarbeit, Teilhabe, Eingebundenheitsgrade, Varianz, Institutioneller Status, Staatliche Involvierung, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist die aktuelle Lage von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt?
Die Arbeit bilanziert, dass trotz Inklusionsbemühungen weiterhin deutliche Barrieren bestehen und die Teilhabe oft hinter den gesetzlichen Leitgedanken zurückbleibt.
Welche Kriterien werden zur Bewertung der Inklusion herangezogen?
Die Untersuchung nutzt fünf Kriterien: Eingebundenheitsgrade, Varianz der Arbeitsbereiche, institutioneller Status, staatliche Involvierung und Wahrnehmung.
Was besagt das "soziale Modell" von Behinderung?
Im Gegensatz zum medizinischen Modell sieht es Behinderung nicht als Defekt des Einzelnen, sondern als Ergebnis gesellschaftlicher Barrieren ("behindert werden").
Was ist die 5%-Beschäftigungsquote?
Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, mindestens 5% ihrer Stellen mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen.
Wie nehmen Menschen mit Behinderung ihre Arbeitssituation selbst wahr?
Die Arbeit wertet Studien zur Selbstwahrnehmung aus, die oft eine Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach voller Inklusion und der erlebten Exklusion oder Separation aufzeigen.
Welche Rolle spielen Programme wie "Job4000"?
Solche Programme dienen der staatlichen Förderung zur Integration schwerbehinderter Menschen in den ersten Arbeitsmarkt durch finanzielle Anreize und Beratung.
- Quote paper
- Tobias Prelwitz (Author), 2016, Quo vadis Inklusion? Eine Bilanz der aktuellen Situation von Menschen mit Behinderung im Bereich der Erwerbsarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349990