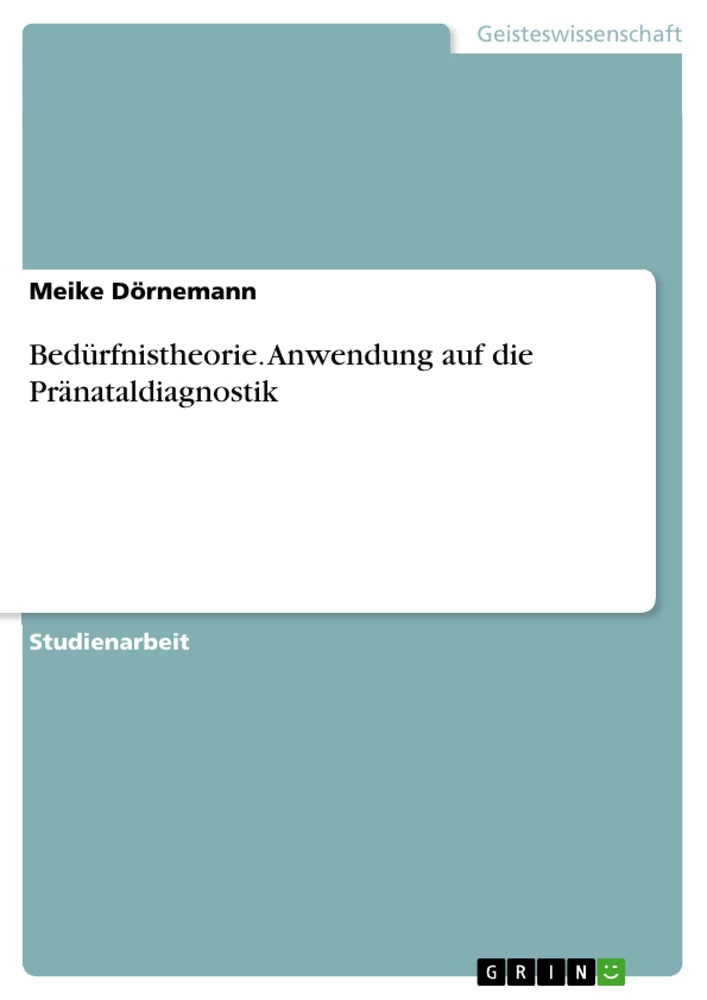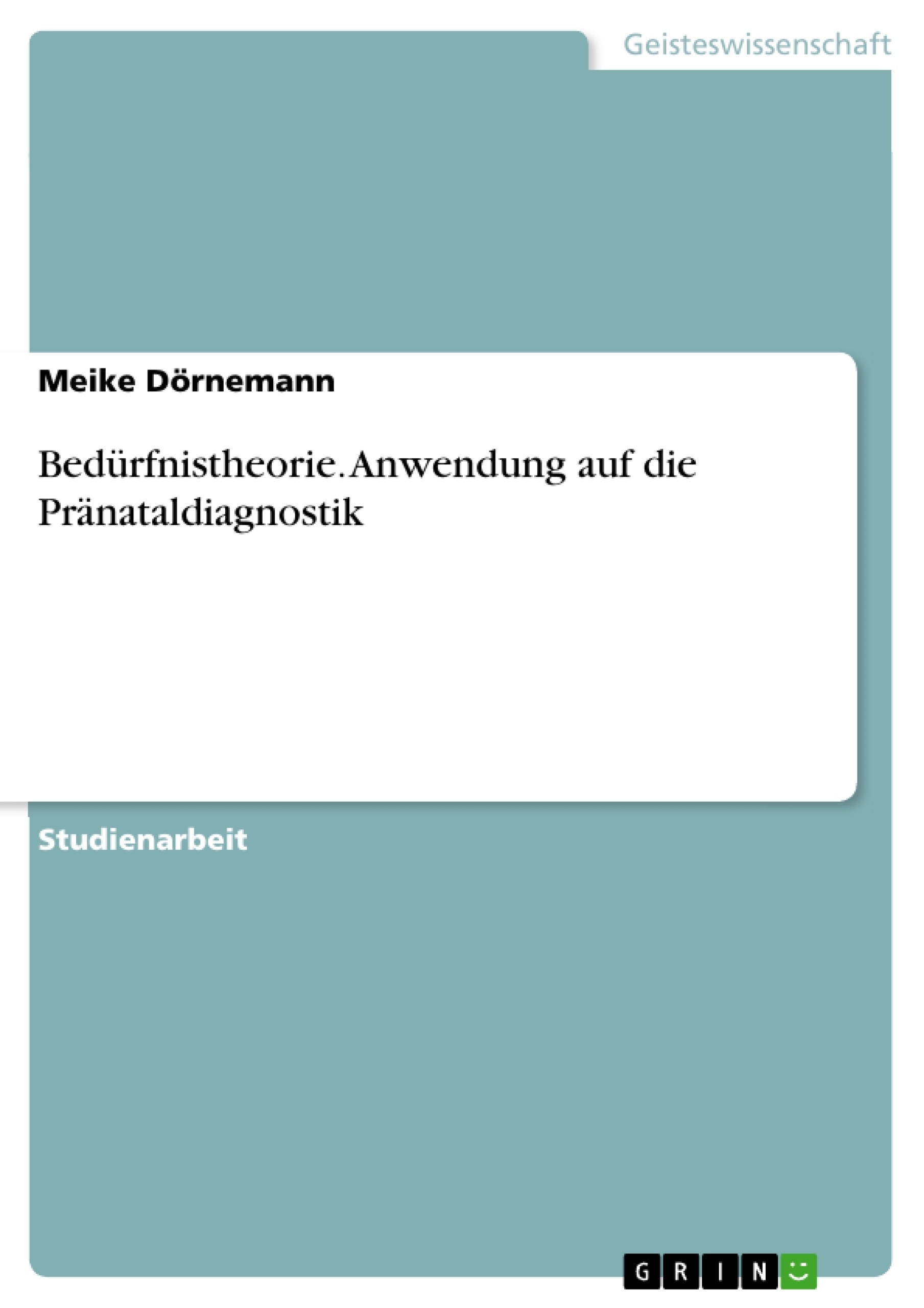Was ist ein Bedürfnis? Welche verschiedenen Formen gibt es? Wie kommen sie zustande und sind Bedürfnisse die Motivatoren die Entwicklungen vorantreiben oder passen sich Bedürfnisse den Neuerungen und deren Gegebenheiten an? Im Fokus soll hierbei die Entwicklung der schnelle Fortschritt der Pränataldiagnostik stehen.
Die Klärung der Fragestellung wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht. So soll sowohl der Fortschritt der Pränataldiagnostik dargelegt werden um die eventuelle Anpassung der Bedürfnisse ersichtlich zu machen, als auch die Auffassung von Eltern, Ärzten Historikern, Philosophen und Vertretern aus Kirche und dem Bereich der Ethik vorgestellt werden um die Haltung und die Motivation die mit dem Bedürfnis nach Klärung oder dem Sicherheitsverständnis einhergeht zu verdeutlichen.
Der Gesellschaftliche Aspekt der Verantwortung gegenüber selbiger, die Rolle der Eltern und ihre Autonomie der Entscheidungsfindung sowie ein steigendes Verlangen nach Perfektion spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Der Frage nach der Bedeutung und dem Einfluss von Bedürfnissen, sowie nach der Rolle der Macht deren Ausübung, soll aus einer psychologischen und auch sozialwissenschaftlichen Sichtweise versucht werden nachzugehen. Was zuerst da war, das Huhn oder das Ei lässt sich bekanntermaßen nie eindeutig und zu Aller Zufriedenheit klären!
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung und formuliertes Ziel der Pränataldiagnostik
- Bedeutung der Pränataldiagnostik
- Die Sichtweise von werdenden Eltern und Medizinern
- Differenzierte Perspektiven auf die Pränataldiagnostik
- Was ist ein Bedürfnis?
- Bedürfnishierarchie nach Maslow
- Bedürfnisse bei Marianne Gronemeyer
- Transfer auf der Pränataldiagnostik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept des Bedürfnisses im Kontext der Entwicklung der Pränataldiagnostik. Sie beleuchtet die verschiedenen Auffassungen zum Nutzen und den Folgen der Pränataldiagnostik aus verschiedenen Perspektiven (werdende Eltern, Mediziner, ethische und religiöse Vertreter). Die Arbeit fragt nach der Bedeutung von Bedürfnissen als Motivatoren für den Fortschritt und die Anpassung an neue Technologien.
- Entwicklung und Ziele der Pränataldiagnostik
- Differenzierte Perspektiven auf den Nutzen der Pränataldiagnostik
- Das Konzept des Bedürfnisses und dessen Rolle im Kontext der Pränataldiagnostik
- Die Bedeutung von gesellschaftlicher Verantwortung und individueller Autonomie
- Das Streben nach Perfektion im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: die Bedeutung des Bedürfnisses im Kontext der rasanten Entwicklung der Pränataldiagnostik. Nietzsches Zitat über Bedürfnisse als Wirkung des Entstandenen wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Motivatoren hinter dem Fortschritt der Pränataldiagnostik und der Anpassung der Bedürfnisse an die neuen Möglichkeiten genutzt. Die Arbeit betrachtet die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln, einschließlich der Perspektiven von Eltern, Ärzten, Historikern, Philosophen und Vertretern aus Kirche und Ethik, um die Haltungen und Motivationen hinter dem Wunsch nach Klärung und Sicherheit zu beleuchten.
Entwicklung und formuliertes Ziel der Pränataldiagnostik: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Pränataldiagnostik, beginnend mit traditionellen Methoden bis hin zu modernen, invasiven und nicht-invasiven Verfahren. Es zeigt den rasanten Fortschritt der Technologie und die damit einhergehende Zunahme der Inanspruchnahme von Pränataldiagnostik, auch unabhängig vom Alter der Schwangeren. Das formulierte Ziel der Pränataldiagnostik wird als Entdeckung von Fehlbildungen und Objektivierung der Ängste schwangerer Frauen dargestellt.
Bedeutung der Pränataldiagnostik: Dieses Kapitel beleuchtet die kontroversen Diskussionen um den Nutzen und die ethischen Implikationen der Pränataldiagnostik. Es werden unterschiedliche Perspektiven von Ethikkommissionen, Ärzteverbänden, Gesellschaftforschern und Vertretern der Kirche präsentiert, die den Nutzen der Pränataldiagnostik unterschiedlich bewerten. Die unterschiedlichen Auffassungen von werdenden Eltern und Medizinern zum Ziel und Nutzen der Pränataldiagnostik werden herausgestellt.
Was ist ein Bedürfnis?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Verständnis des Bedürfnisses. Es werden unterschiedliche Bedürfnishierarchien, wie die von Maslow, und verschiedene Ansätze zum Verständnis von Bedürfnissen vorgestellt. Dieses Kapitel legt die Grundlage für die spätere Anwendung der Bedürfniskonzepte auf den Kontext der Pränataldiagnostik.
Transfer auf der Pränataldiagnostik: (Anmerkung: Es fehlt der Textinhalt zu diesem Kapitel, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Pränataldiagnostik, Bedürfnis, Entwicklung, Ethik, Selbstbestimmung, Perfektion, Gesellschaft, Medizin, Eltern, Behinderung, Risiko, Ultraschall, invasive Verfahren, nicht-invasive Verfahren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Pränataldiagnostik und Bedürfnisse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Bedürfnissen im Kontext der Entwicklung und Anwendung der Pränataldiagnostik. Sie analysiert verschiedene Perspektiven auf den Nutzen und die Folgen der Pränataldiagnostik, einschließlich der Sichtweisen werdender Eltern, Mediziner, ethischer und religiöser Vertreter. Ein zentrales Thema ist die Frage, inwieweit Bedürfnisse den Fortschritt und die Anpassung an neue Technologien in diesem Bereich motivieren.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Pränataldiagnostik, die unterschiedlichen Perspektiven auf ihren Nutzen, verschiedene Theorien zum Verständnis von Bedürfnissen (z.B. Maslows Bedürfnishierarchie), die ethischen Implikationen der Pränataldiagnostik, die Bedeutung von gesellschaftlicher Verantwortung und individueller Autonomie, sowie das Streben nach Perfektion im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik.
Welche Perspektiven werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Perspektiven werdender Eltern, Mediziner, Ethiker, Religionsvertreter, Historiker und Philosophen, um ein umfassendes Bild der Haltungen und Motivationen im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik zu zeichnen. Die unterschiedlichen Auffassungen zum Nutzen und den ethischen Implikationen der Pränataldiagnostik werden detailliert dargestellt.
Wie wird das Konzept des Bedürfnisses in die Analyse einbezogen?
Das Konzept des Bedürfnisses bildet einen zentralen Bestandteil der Analyse. Es werden verschiedene Theorien und Ansätze zum Verständnis von Bedürfnissen vorgestellt, um diese dann auf den Kontext der Pränataldiagnostik anzuwenden. Die Arbeit untersucht, welche Bedürfnisse die Entwicklung und Anwendung der Pränataldiagnostik vorantreiben und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Entwicklung und formuliertes Ziel der Pränataldiagnostik, Bedeutung der Pränataldiagnostik, Was ist ein Bedürfnis?, und Transfer auf die Pränataldiagnostik. Die Kapitel geben einen Überblick über die historische Entwicklung, ethische und gesellschaftliche Aspekte sowie theoretische Grundlagen zum Verständnis von Bedürfnissen. Leider fehlt der Textinhalt zum letzten Kapitel "Transfer auf die Pränataldiagnostik".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Pränataldiagnostik, Bedürfnis, Entwicklung, Ethik, Selbstbestimmung, Perfektion, Gesellschaft, Medizin, Eltern, Behinderung, Risiko, Ultraschall, invasive Verfahren, nicht-invasive Verfahren.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept des Bedürfnisses im Kontext der Pränataldiagnostik zu untersuchen und die verschiedenen Perspektiven und ethischen Implikationen dieser Technologie zu beleuchten. Sie will ein tieferes Verständnis der Motivatoren hinter der Entwicklung und Anwendung der Pränataldiagnostik schaffen.
- Quote paper
- Meike Dörnemann (Author), 2016, Bedürfnistheorie. Anwendung auf die Pränataldiagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350560