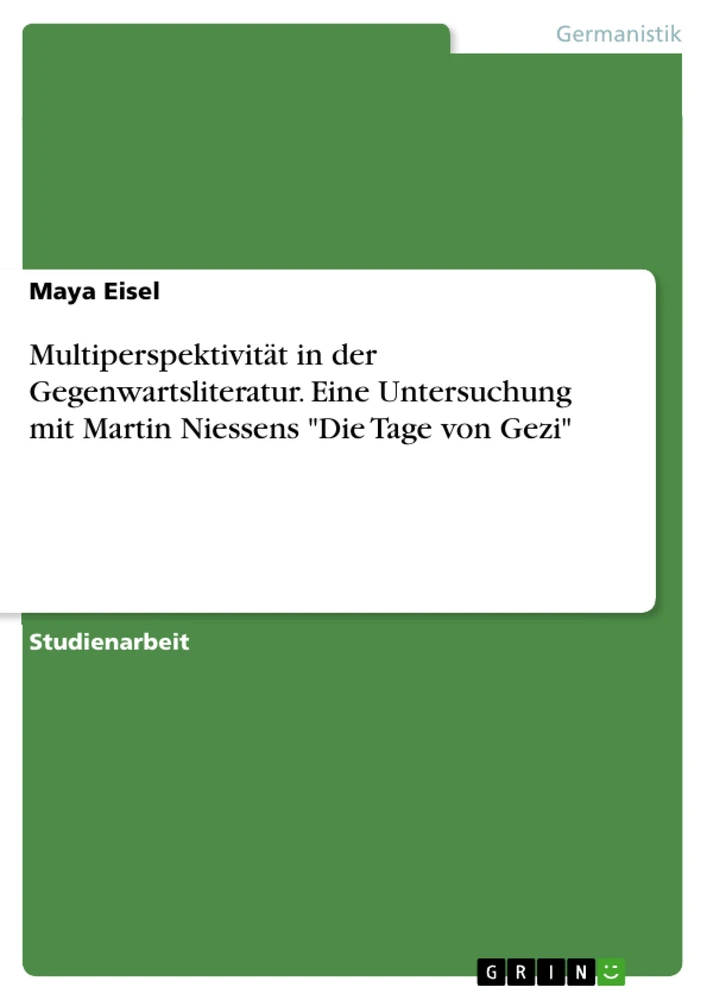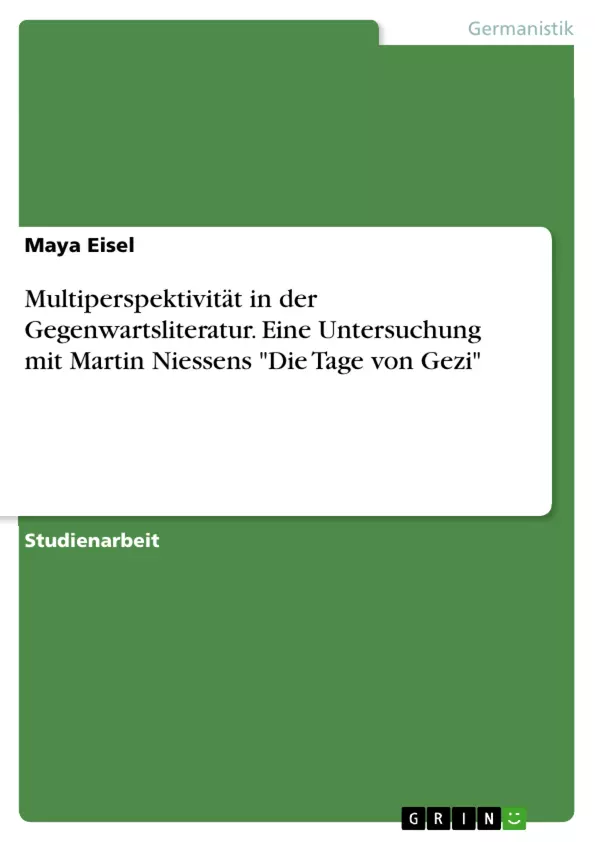Was genau ist überhaupt Multiperspektivität bezogen auf die Literaturwissenschaft? Bedeutet Multiperspektivität lediglich, dass mehrere Figuren nebeneinander als Erzähler existent sind? „Wer jedoch in der Forschungsliteratur nachsehen möchte, was es mit dem multiperspektivischen Erzählen genau auf sich hat, wird keine klaren Antworten finden“. So kommt es bereits bei der Definition von Multiperspektivität zu Unklarheiten und einer Vielzahl an Fragen.
Hinzu kommt die schwierige Frage, was denn Multiperspektivität überhaupt für den Rezipienten bedeutet. Ist er dazu befähigt, die für ihn geltende Wahrheit herauszuarbeiten oder wird diese durch den Text vorgegeben, sodass es nur den Anschein erweckt als hätte der Rezipient beliebig viel Spielraum in seiner eigenen Interpretation? Auf diese Fragen möchte die vorliegende Arbeit trotz oder gerade wegen der begrifflichen Unklarheiten in der Forschungsliteratur Antworten finden und somit für ein klareres Verständnis von Multiperspektivität sorgen.
Dazu werden zunächst unterschiedliche Definitionen und die daraus resultierenden definitorischen Probleme herausgearbeitet. Nach der Aufstellung erster Ansätze hinsichtlich der Bedeutung von multiperspektivischem Erzählen für den Rezipienten, werden diese kritischer betrachtet und ausgeweitet. Dies geschieht durch das Vorstellen von unterschiedlichen Typen und Erscheinungsformen von Multiperspektivität und die daraus resultierende Bedeutung für den Leser des multiperspektivischen Textes. Dieser Aspekt leitet bereits zu der Wirkung und der Funktion von Multiperspektivität über. Die erschlossenen, theoretischen Erkenntnisse werden nun praktisch auf den Beispielroman "Die Tage von Gezi" von Martin Niessen angewendet. Aus Gründen des Umfangs an theoretischen Erkenntnissen dient dieser lediglich als kurze Veranschaulichung.
Die vorliegende Arbeit ist stark literaturgestützt, sodass der Großteil der Erkenntnisse auf dem Buch Multiperspektivisches Erzählen: zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. Bis 20. Jahrhunderts, welches von Vera und Ansgar Nünning verfasst wurde, basiert. Das Werk behandelt alle für diese Arbeit wichtigen Aspekte und bedient sich dabei an den Aussagen weiterer unterschiedlicher Autoren, auf dessen Literatur sich meine Arbeit außerdem zum Teil stützt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Multiperspektivität
- Eine Definition und definitorische Probleme
- Bedeutung von Multiperspektivität für den Rezipienten
- Unterschiedliche Typen und Erscheinungsformen
- Wirkung und Funktion
- Ein Romanbezug: Martin Niessen – Die Tage von Gezi
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Multiperspektivität in der Literaturwissenschaft. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Multiperspektivität zu entwickeln und dabei insbesondere die Bedeutung für den Rezipienten herauszuarbeiten.
- Definition und Abgrenzung von Multiperspektivität
- Rolle des Rezipienten und der Interpretation
- Analyse verschiedener Typen und Erscheinungsformen
- Wirkung und Funktion von Multiperspektivität in Texten
- Anwendung der Theorie am Beispielroman "Die Tage von Gezi" von Martin Niessen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Multiperspektivität ein und beleuchtet die begrifflichen Unklarheiten in der Forschungsliteratur. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: Welche Bedeutung hat Multiperspektivität für den Rezipienten?
Kapitel 2 beschäftigt sich ausführlich mit der Definition und Abgrenzung von Multiperspektivität. Es werden definitorische Probleme aufgezeigt und verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs vorgestellt, unter Berücksichtigung von Erzählern, Fokalisierungsinstanzen und Reflektorfiguren. Anschließend wird die Bedeutung von Multiperspektivität für den Rezipienten untersucht, wobei die Leerstellentheorie von Wolfgang Iser sowie die Kritik von Matthias Buschmann beleuchtet werden.
Kapitel 2.3 analysiert unterschiedliche Typen und Erscheinungsformen multiperspektivischen Erzählens, sowohl formal als auch diskursnarratologisch. Es werden drei Grundformen vorgestellt und anhand von vier jeweils unterschiedlichen Kriterien weiter differenziert. Dabei werden sowohl die semantische als auch die paradigmatische Dimension des multiperspektivischen Erzählens betrachtet.
In Kapitel 2.4 werden die Wirkung und Funktion von Multiperspektivität untersucht. Es werden verschiedene Gründe beleuchtet, warum ein Autor unterschiedliche Perspektiven in seinen Texten verwendet. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Funktionen von Multiperspektivität aufgezeigt, z.B. die spannungserzeugende, die didaktische und die epistemologische Funktion.
Kapitel 3 wendet die theoretischen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln auf den Roman "Die Tage von Gezi" von Martin Niessen an. Es wird eine Einordnung des Romans in die Typologie multiperspektivischen Erzählens vorgenommen und anschließend die einzelnen Perspektiven anhand eines ausgewählten Kapitels genauer untersucht.
Schlüsselwörter
Multiperspektivität, Erzählperspektive, Fokalisierung, Reflektorfigur, Rezeption, Leerstellen, Interpretation, Typologie, Erscheinungsformen, Wirkung, Funktion, Romanbezug, "Die Tage von Gezi"
- Citar trabajo
- Maya Eisel (Autor), 2015, Multiperspektivität in der Gegenwartsliteratur. Eine Untersuchung mit Martin Niessens "Die Tage von Gezi", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350869