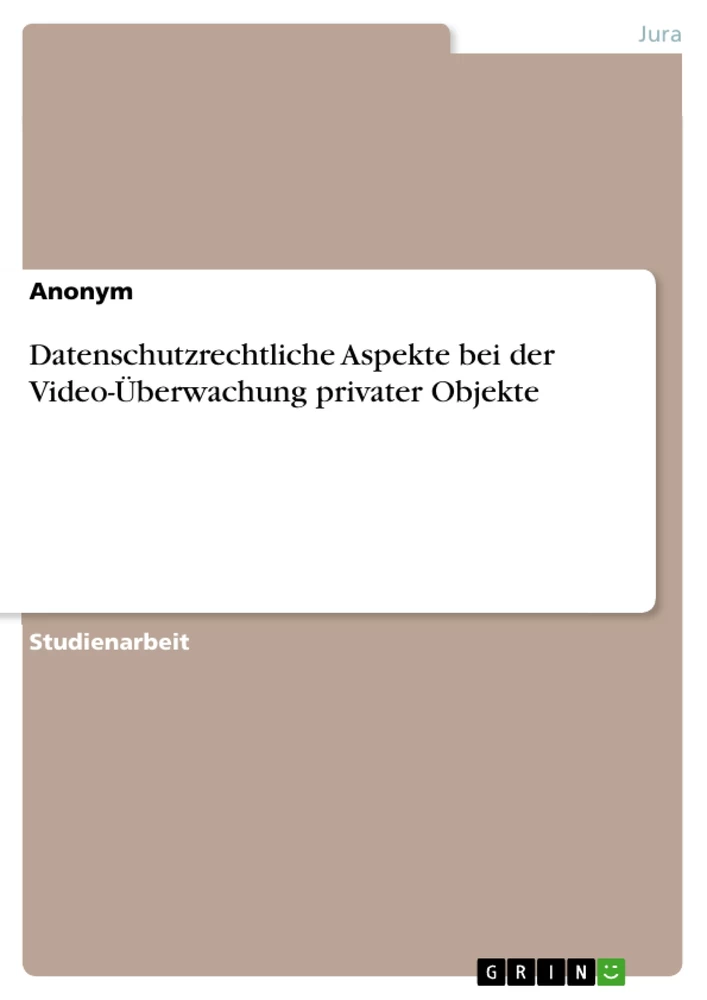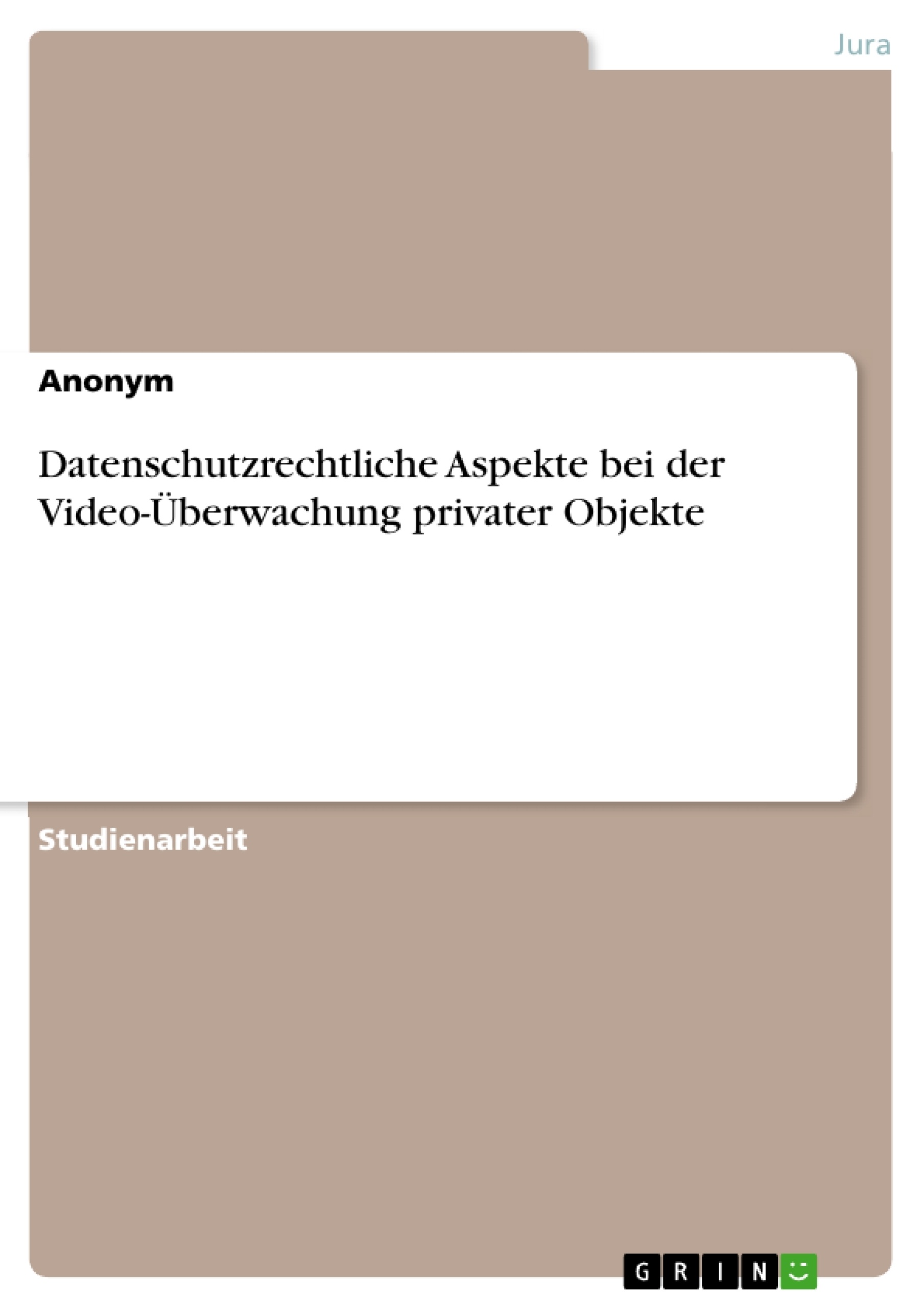Videoüberwachung findet zunehmend Anwendung bei privaten Unternehmen und Privatpersonen. Der Einsatz von Videotechnik beschränkt sich jedoch nicht nur auf deren Nutzung als Sicherheitstechnik. Sie findet auch Einsatz zur Belustigung, zum Zweck der Werbung, im Bereich der Bildung oder bei der Kommunikation. Angesichts der leistungsfähiger werdender Systeme und sinkender Preise nimmt die Versuchung, derartiger Systeme einzusetzen, weiter zu.
Videoüberwachung greift in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Personen ein, deren Bilder erhoben, aufgezeichnet, übertragen und ausgewertet werden. Daher stellt sich die Frage: Worauf muss ein privates Unternehmen oder eine Privatperson datenschutzrechtlich achten?
Bis zum 23. Mai 2001 gab es keine modernen gesetzlichen Regelungen zur Videoüberwachung im privaten Bereich. Nach einigem Zögern wurde schließlich der § 6b in den Entwurf der BDSG-Novelle aufgenommen. Diese trat am 23. Mai 2001 mit den sonstigen Normen zur Anpassung an das europäische Recht und an die technische Entwicklung in Kraft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Öffentlich zugängliche Räume
- Beobachtung
- Zweckbestimmung
- Wahrung des Hausrechts
- Erfüllung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke
- Interessenabwägung
- Kenntlichmachung
- Zweckbestimmung
- Löschungspflicht
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die datenschutzrechtlichen Aspekte der Videoüberwachung privater Objekte. Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Bilddaten im Zusammenhang mit Videoüberwachungssystemen beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Abwägung der Interessen von Personen, die von der Überwachung betroffen sind, mit den Interessen des Verantwortlichen, der die Überwachung durchführt.
- Öffentlich zugängliche Räume vs. private Bereiche
- Zweckbestimmung und Verhältnismässigkeit der Videoüberwachung
- Interessenabwägung zwischen Datenschutz und Sicherheitsbedürfnissen
- Kenntlichmachungspflicht und Transparenz
- Löschungspflicht für Videoaufzeichnungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die zunehmende Verbreitung von Videoüberwachung im privaten Bereich dar und beleuchtet die rechtliche Relevanz des Themas im Kontext des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
- Das Kapitel "Öffentlich zugängliche Räume" analysiert den Begriff der öffentlichen Zugänglichkeit im Rahmen der Videoüberwachung und unterscheidet zwischen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, und solchen, die nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sind.
- Das Kapitel "Beobachtung" befasst sich mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Videoüberwachung im Hinblick auf Zweckbestimmung, Verhältnismässigkeit und Interessenabwägung.
- Die Löschungspflicht wird in einem separaten Kapitel beleuchtet und ihre Bedeutung für den Schutz von Persönlichkeitsrechten erläutert.
Schlüsselwörter
Datenschutzrecht, Videoüberwachung, privates Objekt, öffentlicher Raum, Zweckbestimmung, Interessenabwägung, Verhältnismässigkeit, Kennzeichnungspflicht, Löschungspflicht, BDSG, Persönlichkeitsrecht, Rechtssicherheit.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist Videoüberwachung im privaten Bereich zulässig?
Sie ist zulässig zur Wahrung des Hausrechts oder bei berechtigten Interessen für konkret festgelegte Zwecke, sofern keine schutzwürdigen Interessen der Betroffenen überwiegen.
Was besagt § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)?
Dieser Paragraph regelt die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen und die Anforderungen an Transparenz und Datensparsamkeit.
Besteht eine Pflicht zur Kennzeichnung der Videoüberwachung?
Ja, der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle müssen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hinweisschilder) erkennbar gemacht werden.
Wie lange dürfen Videoaufzeichnungen gespeichert werden?
Daten müssen unverzüglich gelöscht werden, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.
Was gilt als „öffentlich zugänglicher Raum“?
Dazu zählen Räume, die nach ihrer Bestimmung für jedermann oder einen durch allgemeine Merkmale bestimmten Personenkreis offenstehen, wie etwa Verkaufsräume oder Parkplätze.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Datenschutzrechtliche Aspekte bei der Video-Überwachung privater Objekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350896