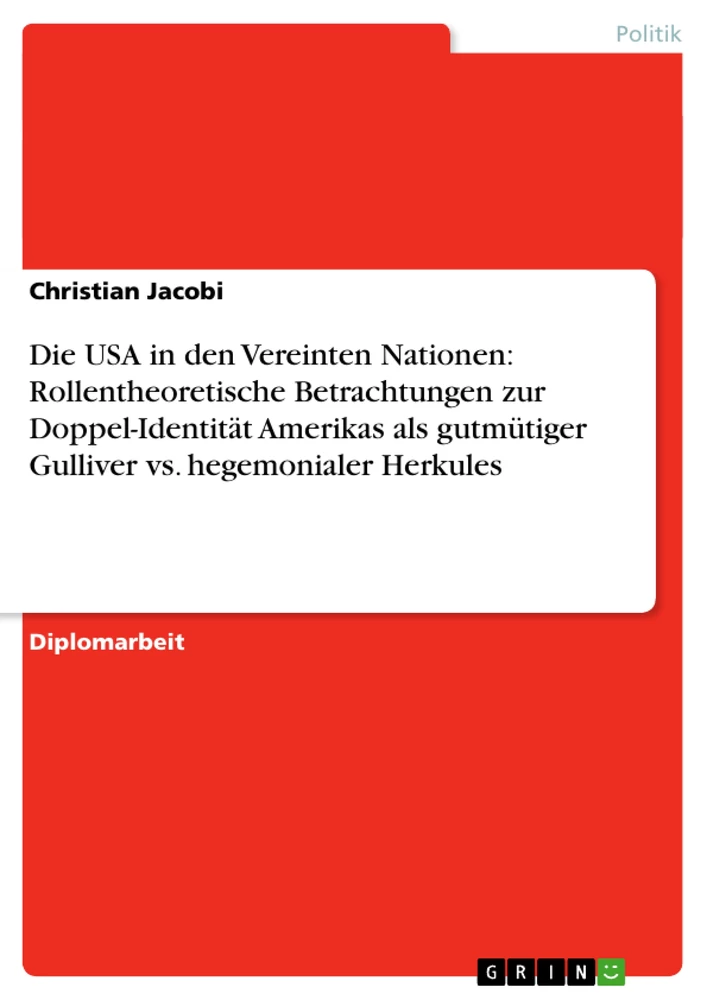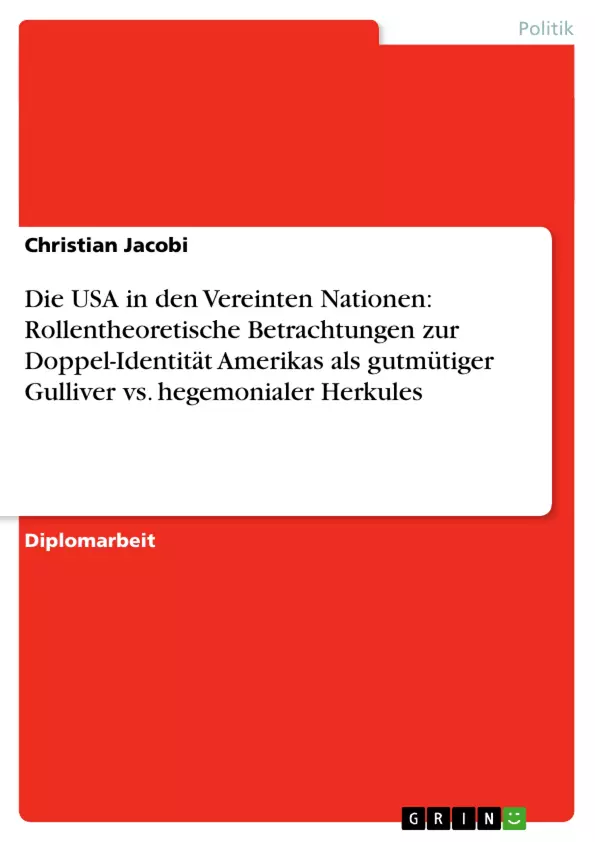[...] In einem ersten Punkt kann hierbei auf die offensichtliche historische und physischgeographische
Verflechtung hingewiesen werden, die die USA und die UN ganz automatisch
eng miteinander verbindet: die USA sind Gründungsmitglied der UN, während sich die UNZentrale
zugleich auf dem Staatsterritorium der USA befindet, was der Organisation auf der
einen Seite mit Blick auf die beträchtlichen Machtmittel Amerikas im Bereich von Diplomatie
und Militär erhöhte Glaubwürdigkeit, auf der anderen Seite jedoch im Laufe der vergangenen Jahrzehnte bei vielen Gelegenheiten auch Vorwürfe bezüglich mehr oder weniger deutlich
festgestellter amerikanischer Einflußnahme eingebracht hat.
Zweitens ergibt sich mit Blick auf die oben bereits angesprochene große Bedeutung
des Einwanderungsfaktors eine sozio-historische Symbolik, was New York als den Sitz der
UN betrifft. So wie die Stadt über die vergangenen Jahrhunderte zum Schmelztiegel und zum
zumeist friedlichen Ort des Zusammenlebens für Einwanderer mit verschiedenster ethnischer
und religiöser Herkunft geworden ist, sollte auch die UN-Organisation die Völker dieser Welt
zur friedlichen Regelung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten zusammenführen.
Drittens sollte, eng mit dem vorangegangenen Gedanken verbunden, auf die ideelle
und verbale Symbolik bzw. auf die konzeptionelle Kongruenz hingewiesen werden, welche
jeweils in der Namens- bzw. Mottogebung der USA und der UN mit Blick auf die durch
vereintes Handeln zu gewinnende Stärke Ausdruck finden soll. So wie mit dem deutlichen
Bezug auf das Vereintsein in der Namensgebung „United Nations“ auf die Stärke und die
besseren Problemlösungskapazitäten hingewiesen wird, die durch ein gemeinsames Handeln
der Völker erzielt werden könnten, findet sich ein ähnliches Konzept in der amerikanischen
Staatsmotto-Formel E pluribus unum. Der amtierende UN-Generalsekretär Kofi Annan weist
zudem darauf hin, daß einige der zentralsten Werte, für die die UN stünde, sehr deutlich mit
amerikanischen kongruieren, wenn er feststellt, daß „values such as tolerance and equal rights
[are also] America’s own founding values” (2000: 28). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenstellung und Relevanz der vorliegenden Untersuchung
- Vorgehensweise
- Übersicht über Forschungsstand und verwendete Forschungsliteratur
- Rollentheorie in der Außenpolitikanalyse
- Grundlegendes zur Rollentheorie und zu außenpolitikbezogenen rollen-theoretischen Untersuchungen
- Rollentheoretische Überlegungen bei der Bewertung der Beziehung der USA zu den Vereinten Nationen
- Wesentliche Grundlinien und Bestimmungsfaktoren amerikanischer politischer Kultur und Außenpolitik
- Amerika zwischen Isolationismus und Internationalismus, Unilateralismus und Multilateralismus
- Ideologisch-moralische Grundlinien amerikanischer politischer Kultur und Außenpolitik
- Politisch-institutionelle Eigenarten amerikanischer Außenpolitik
- Die USA in den Vereinten Nationen: Gutmütiger Gulliver vs. hegemonialer Herkules
- Rollenbekenntnis: Amerika in der Rolle des wohlwollenden Schöpfers bei der Gründung der Vereinten Nationen
- Rollenkonflikt: Entfremdung und Spannungen im Verhältnis der USA zu den Vereinten Nationen
- Streitpunkt Repräsentation
- Streitpunkt Souveränität und Legitimität
- Streitpunkt Effizienz
- Die öffentliche Meinung und die amerikanische UN-Mitgliedschaft
- Rolle rückwärts: Vom „unipolaren Moment“ zur multilateralen Epoche?
- Rollensimultanität: Amerikanische UN-Politik unter neokonservativer Lenkung
- Amerikanische Weltpolitik und die USA in der UN im 21. Jahrhundert: Ausblick und Prognose
- Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis der Vereinigten Staaten zu den Vereinten Nationen unter rollentheoretischen Gesichtspunkten. Die Untersuchung zielt darauf ab, die Doppel-Identität Amerikas als „gutmütiger Gulliver“ und „hegemonialer Herkules“ in Bezug auf die UN zu beleuchten und die Spannungen zwischen diesen beiden Rollen zu analysieren.
- Die Rolle der USA bei der Gründung der Vereinten Nationen und die Bedeutung der Organisation für die amerikanische Außenpolitik
- Die Entwicklung des Verhältnisses der USA zur UN im Laufe der Zeit, insbesondere seit dem Ende des Kalten Krieges
- Die zentralen Konfliktpunkte im Verhältnis der USA zur UN: Repräsentation, Souveränität, Legitimität und Effizienz
- Die Bedeutung der öffentlichen Meinung in den USA für die UN-Mitgliedschaft
- Die Zukunft der amerikanisch-UN-Beziehung im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Themenstellung und Relevanz der Arbeit vor. Sie erläutert die Herausforderungen der internationalen Ordnung nach dem Ende des Kalten Krieges und die Bedeutung der USA und der UN als zentrale Akteure in dieser neuen Weltordnung.
- Kapitel 2 bietet eine Einführung in die Rollentheorie als Instrument zur Analyse von Außenpolitik und untersucht die Rolle der USA in der UN aus dieser theoretischen Perspektive.
- Kapitel 3 beleuchtet die wesentlichen Grundlinien und Bestimmungsfaktoren amerikanischer politischer Kultur und Außenpolitik, insbesondere die Spannungen zwischen Isolationismus und Internationalismus sowie Unilateralismus und Multilateralismus.
- Kapitel 4 analysiert die Rolle der USA in der UN im Detail. Es geht auf die Rolle des „wohlwollenden Schöpfers“ bei der Gründung der UN ein und beleuchtet die zunehmenden Spannungen und Konflikte im Verhältnis der USA zur Organisation.
- Kapitel 5 widmet sich der amerikanischen Weltpolitik und der Rolle der USA in der UN im 21. Jahrhundert. Es gibt einen Ausblick und Prognose für die Zukunft des Verhältnisses zwischen den USA und der UN.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Rollentheorie, Außenpolitik, amerikanische Außenpolitik, Vereinte Nationen, UN-Mitgliedschaft, internationale Ordnung, Hegemonie, Multilateralismus, Unilateralismus, Repräsentation, Souveränität, Legitimität, Effizienz, öffentliche Meinung, „gutmütiger Gulliver“, „hegemonialer Herkules“. Die Arbeit analysiert die Rolle der USA in der UN im Kontext der internationalen Beziehungen und untersucht die Herausforderungen, Chancen und Konflikte, die sich aus dem Verhältnis der USA zur UN ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Doppel-Identität der USA in der UN?
Die USA agieren einerseits als „gutmütiger Gulliver“ (wohlwollender Schöpfer und Multilateralist) und andererseits als „hegemonialer Herkules“ (unilateral handelnde Supermacht), was zu ständigen Rollenkonflikten führt.
Warum ist der Sitz der UN in New York symbolisch wichtig?
New York gilt als Schmelztiegel der Kulturen. Dieser sozio-historische Hintergrund spiegelt das Ideal der UN wider, Völker friedlich zusammenzuführen, verknüpft die Organisation aber auch physisch eng mit den USA.
Welche Streitpunkte gibt es zwischen den USA und den Vereinten Nationen?
Zentrale Konfliktfelder sind die nationale Souveränität, die Legitimität internationaler Entscheidungen, die Effizienz der UN-Bürokratie und die Frage der gerechten Repräsentation.
Was versteht man unter dem „unipolaren Moment“?
Es beschreibt die Phase nach dem Kalten Krieg, in der die USA als einzige Supermacht dominierten und ihr Verhältnis zum Multilateralismus der UN neu definierten.
Wie beeinflusst die öffentliche Meinung in den USA die UN-Politik?
Die amerikanische UN-Politik ist stark von innenpolitischen Strömungen geprägt, wobei zwischen isolationistischen Tendenzen und dem Wunsch nach internationaler Führung abgewogen werden muss.
- Quote paper
- Christian Jacobi (Author), 2003, Die USA in den Vereinten Nationen: Rollentheoretische Betrachtungen zur Doppel-Identität Amerikas als gutmütiger Gulliver vs. hegemonialer Herkules, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35092