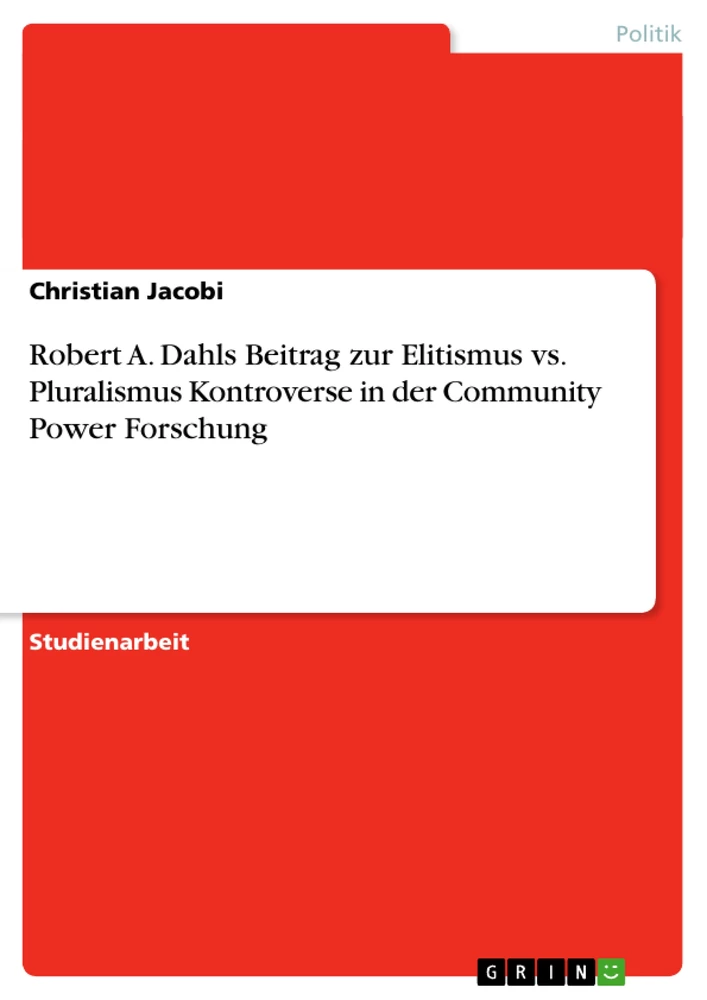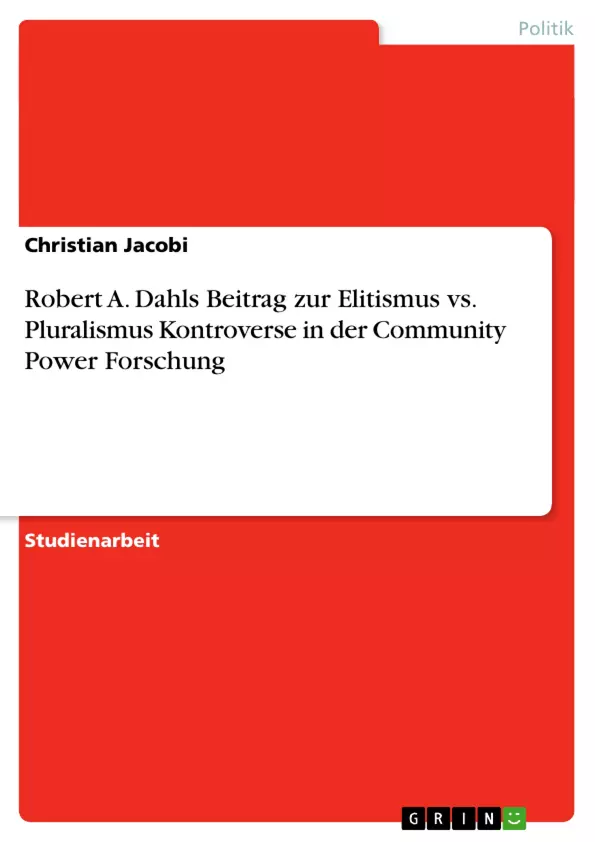[...] Doch wer sind eigentlich die Träger
politischer Macht und von welch einer Macht- und Einflußstruktur dieser politischen bzw.
administrativen Eliten muß auf nationaler bzw. lokaler Ebene ausgegangen werden? Gestalten
sich die Macht- und Einflußstrukturen im Berliner Bundestag oft als hoch komplex und aus
der Ferne nur schwer überschaubar, so bietet die Kommunalpolitik in Gemeinderäten bessere
Möglichkeiten für eine erkenntnisbringende Machtstruktur-Analyse.
Die Politikwissenschaft begann sich aus diesem Grund schon vor einigen Jahrzehnten im
Rahmen einer demokratietheoretischen Debatte intensiv für das politische System der
Gemeinde zu interessieren. Ausgehend von den USA machte es sich die sogenannte
Community Power Forschung zur Aufgabe zu ergründen, welche Machtstrukturen in
kommunalen Gemeinwesen anzutreffen sind. Zur Beantwortung dieser demokratietheoretisch
bedeutsamen Fragestellung haben zwei verschieden argumentierende Theorie-Schulen jeweils
die Bedeutung der These der Prädominanz starrer Machteliten bzw. die These einer
pluralistischer Machtverteilung hervorgehoben.
Die vorliegende Arbeit will zum einen das Spannungsfeld aufzeigen, in dem sich die
Community Power Forschung zwischen elitistischen und pluralistischen Ansätzen befunden
hat. Vor diesem Hintergrund soll zum zweiten dargestellt werden, daß der bekannte USPolitikwissenschaftler
Robert A. Dahl zwangsläufig zu einer ablehnenden Haltung der von
den sogenannten Elitisten formulierten Thesen zur lokalen Machtstruktur kommen mußte und
daß Dahl mit seinen Beiträgen die Community Power Forschung entscheidend bereichert hat.
Im folgenden zweiten Kapitel sollen der Gegenstandsbereich der Community Power
Forschung und die Position der Elitisten erläutert werden, um im Hauptteil der Arbeit die
Kritik Dahls am Modell einer herrschenden Elite in kommunalpolitischen Machtstrukturen
genauer charakterisieren zu können. Das vierte Kapitel will mittels einiger Beobachtungen
des Autors die vorangegangenen abstrakten Überlegungen durch einen kurzen Diskurs zu den
Machtstrukturen im Freiburger Rathaus ergänzen und auf einige Geme inde-Macht Aspekte
aufmerksam machen, die nach Meinung des Autors einer (noch) eingehenderen
wissenschaftlichen Untersuchung zugeführt werden könnten. Einige Schlussbetrachtungen
greifen zum Ende noch einmal kurz die zentralen Problemstellungen dieser Arbeit auf.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Community Power als Gegenstandsbereich demokratietheoretischer Betrachtungen
- 2.1. Ziele und wichtige Vertreter der frühen Community Power Forschung in den USA und Deutschland
- 2.2. Position und Forschungsmethodik der Elitisten in der Community Power Debatte
- III. Robert A. Dahls Beitrag zur Elitismus vs. Pluralismus Kontroverse in der Community Power Forschung
- 3.1. Dahls Verortung als demokratietheoretischer Pluralist
- 3.2. Dahls Machtbegriff und seine Kritik an der Position der Elitisten
- 3.3. Die New Haven Studie als Antwort der Pluralisten: Dahls Ziele und Forschungsmethodik
- 3.4. Community Power und Probleme bürgerlicher Kompetenz und Partizipation
- IV. Wenn Dahl über Freiburg geschrieben hätte: Community Power im Freiburger Rathaus
- V. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Robert A. Dahls Beitrag zur Debatte zwischen Elitismus und Pluralismus in der Community Power Forschung. Sie beleuchtet Dahls Kritik an elitistischen Thesen zur lokalen Machtstruktur und analysiert seine Forschungsmethodik im Kontext seiner pluralistischen Position. Zusätzlich wird ein kurzer Blick auf die Machtstrukturen im Freiburger Rathaus geworfen.
- Community Power Forschung: Elitismus vs. Pluralismus
- Robert A. Dahls pluralistische Demokratietheorie
- Dahls Kritik an der Elitisten-These
- Dahls Forschungsmethodik (New Haven Studie)
- Machtstrukturen in der Kommunalpolitik (am Beispiel Freiburg)
Zusammenfassung der Kapitel
II. Community Power als Gegenstandsbereich demokratietheoretischer Betrachtungen: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext der Community Power Forschung, die in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg entstand. Angestoßen durch kritische Auseinandersetzungen mit dem amerikanischen Gesellschaftssystem, rückte die Gemeinde als Untersuchungsgegenstand in den Fokus. Die Forschung befasste sich mit der Frage nach den Machtstrukturen in Gemeinden und führte zu einer kontroversen Debatte zwischen pluralistischen und elitistischen Ansätzen. Der romantisierende Blick auf die Gemeinde als "Demokratie-Paradigma" wird kritisch hinterfragt. Die Methodologie der Community Power Forschung und die unterschiedlichen Befunde werden als Ausgangspunkt für die folgende Auseinandersetzung mit Dahls Arbeit eingeführt.
III. Robert A. Dahls Beitrag zur Elitismus vs. Pluralismus Kontroverse in der Community Power Forschung: Dieses Kapitel widmet sich Dahls Beitrag zur Community Power Debatte. Es verortet ihn als pluralistischen Demokratietheoretiker und erläutert seinen Machtbegriff sowie seine Kritik an den elitistischen Thesen. Schlüssel ist die New Haven Studie, in der Dahl seine Forschungsmethodik und seine Analyse der Machtstrukturen in New Haven präsentiert. Das Kapitel untersucht auch die von Dahl angesprochenen Probleme bürgerlicher Kompetenz und Partizipation im Kontext der lokalen Machtverhältnisse. Der Vergleich mit den elitistischen Ansätzen bildet den Kern des Kapitels.
IV. Wenn Dahl über Freiburg geschrieben hätte: Community Power im Freiburger Rathaus: Dieses Kapitel dient als kurze, anregend gemeinte Erweiterung der vorangegangenen theoretischen Überlegungen. Es befasst sich mit den Machtstrukturen im Freiburger Rathaus, um die abstrakten Konzepte der Community Power Forschung zu illustrieren und auf mögliche Forschungslücken hinzuweisen. Der Autor präsentiert hier eigene Beobachtungen und regt weitere wissenschaftliche Untersuchungen zu spezifischen Gemeinde-Macht-Aspekten an, ohne eine umfassende Analyse der Freiburger Machtstrukturen durchzuführen.
Schlüsselwörter
Community Power Forschung, Elitismus, Pluralismus, Robert A. Dahl, Demokratietheorie, Machtstrukturen, Kommunalpolitik, Partizipation, New Haven Studie, Bürgerliche Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Community Power im Spiegel von Robert A. Dahls Pluralistischer Demokratietheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Robert A. Dahls Beitrag zur Debatte zwischen Elitismus und Pluralismus in der Community Power Forschung. Sie untersucht Dahls Kritik an elitistischen Thesen zur lokalen Machtstruktur, seine pluralistische Forschungsmethodik (am Beispiel der New Haven Studie) und die Probleme bürgerlicher Kompetenz und Partizipation. Zusätzlich enthält sie eine kurze Betrachtung der Machtstrukturen im Freiburger Rathaus als illustrierendes Beispiel.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Community Power Forschung, den Vergleich von Elitismus und Pluralismus, Robert A. Dahls pluralistische Demokratietheorie, seine Kritik an elitistischen Ansätzen, seine Forschungsmethodik (insbesondere die New Haven Studie) und Machtstrukturen in der Kommunalpolitik (exemplarisch am Beispiel Freiburg).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Community Power Forschung und der Kontroverse zwischen Elitisten und Pluralisten, ein Kapitel zu Dahls Beitrag zur Debatte, ein Kapitel mit einer kurzen Betrachtung der Machtstrukturen im Freiburger Rathaus und abschließende Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Was wird im Kapitel II ("Community Power als Gegenstandsbereich demokratietheoretischer Betrachtungen") behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext der Community Power Forschung in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beleuchtet die kontroverse Debatte zwischen pluralistischen und elitistischen Ansätzen und deren unterschiedliche Methodologien, wobei der romantisierende Blick auf die Gemeinde als "Demokratie-Paradigma" kritisch hinterfragt wird.
Was ist der Inhalt von Kapitel III ("Robert A. Dahls Beitrag zur Elitismus vs. Pluralismus Kontroverse in der Community Power Forschung")?
Kapitel III analysiert Dahls pluralistische Demokratietheorie, seinen Machtbegriff und seine Kritik an elitistischen Thesen. Die New Haven Studie wird als zentrales Beispiel seiner Forschungsmethodik und seiner Analyse der Machtstrukturen vorgestellt. Probleme bürgerlicher Kompetenz und Partizipation im Kontext lokaler Machtverhältnisse werden ebenfalls diskutiert.
Was ist die Bedeutung von Kapitel IV ("Wenn Dahl über Freiburg geschrieben hätte: Community Power im Freiburger Rathaus")?
Dieses Kapitel dient als ergänzende Illustration der theoretischen Überlegungen. Es bietet eine kurze Betrachtung der Machtstrukturen im Freiburger Rathaus, um die Konzepte der Community Power Forschung zu verdeutlichen und auf mögliche Forschungslücken hinzuweisen. Es handelt sich um eigene Beobachtungen des Autors und regt zu weiterer Forschung an, ohne eine umfassende Analyse der Freiburger Machtstrukturen zu liefern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Community Power Forschung, Elitismus, Pluralismus, Robert A. Dahl, Demokratietheorie, Machtstrukturen, Kommunalpolitik, Partizipation, New Haven Studie, Bürgerliche Kompetenz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende, die sich mit Demokratietheorie, Community Power Forschung, Machtstrukturen in Kommunalpolitik und vergleichenden politischen Studien beschäftigen.
Welche Forschungsfrage wird in dieser Arbeit beantwortet?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie hat Robert A. Dahl zur Debatte zwischen Elitismus und Pluralismus in der Community Power Forschung beigetragen, und welche Bedeutung haben seine Methoden und Erkenntnisse für das Verständnis lokaler Machtstrukturen?
- Quote paper
- Christian Jacobi (Author), 2002, Robert A. Dahls Beitrag zur Elitismus vs. Pluralismus Kontroverse in der Community Power Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35097