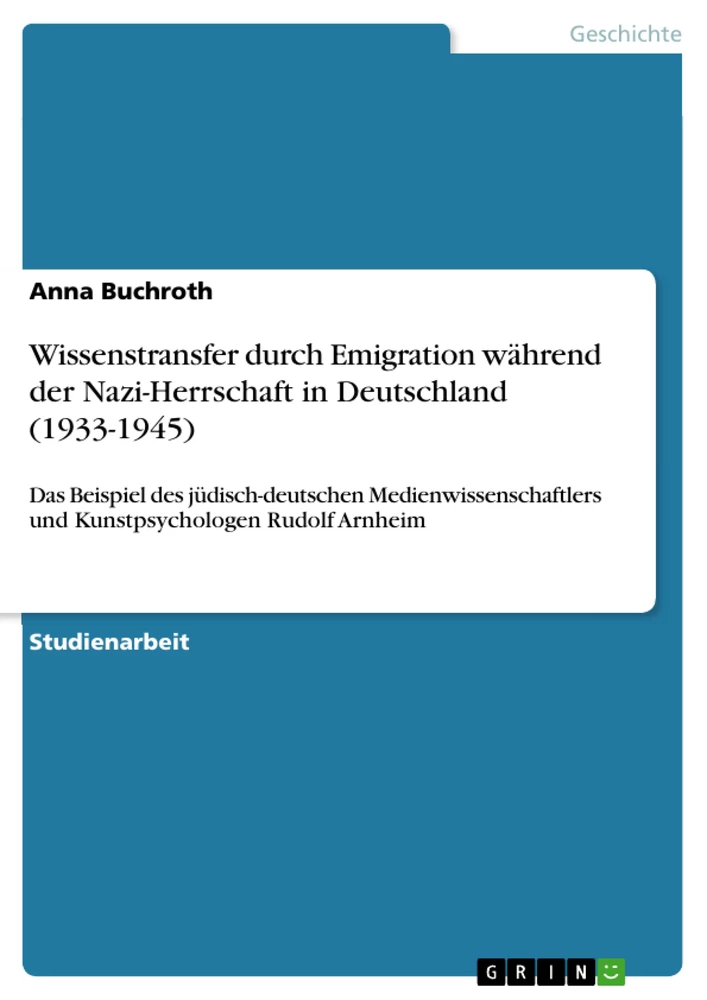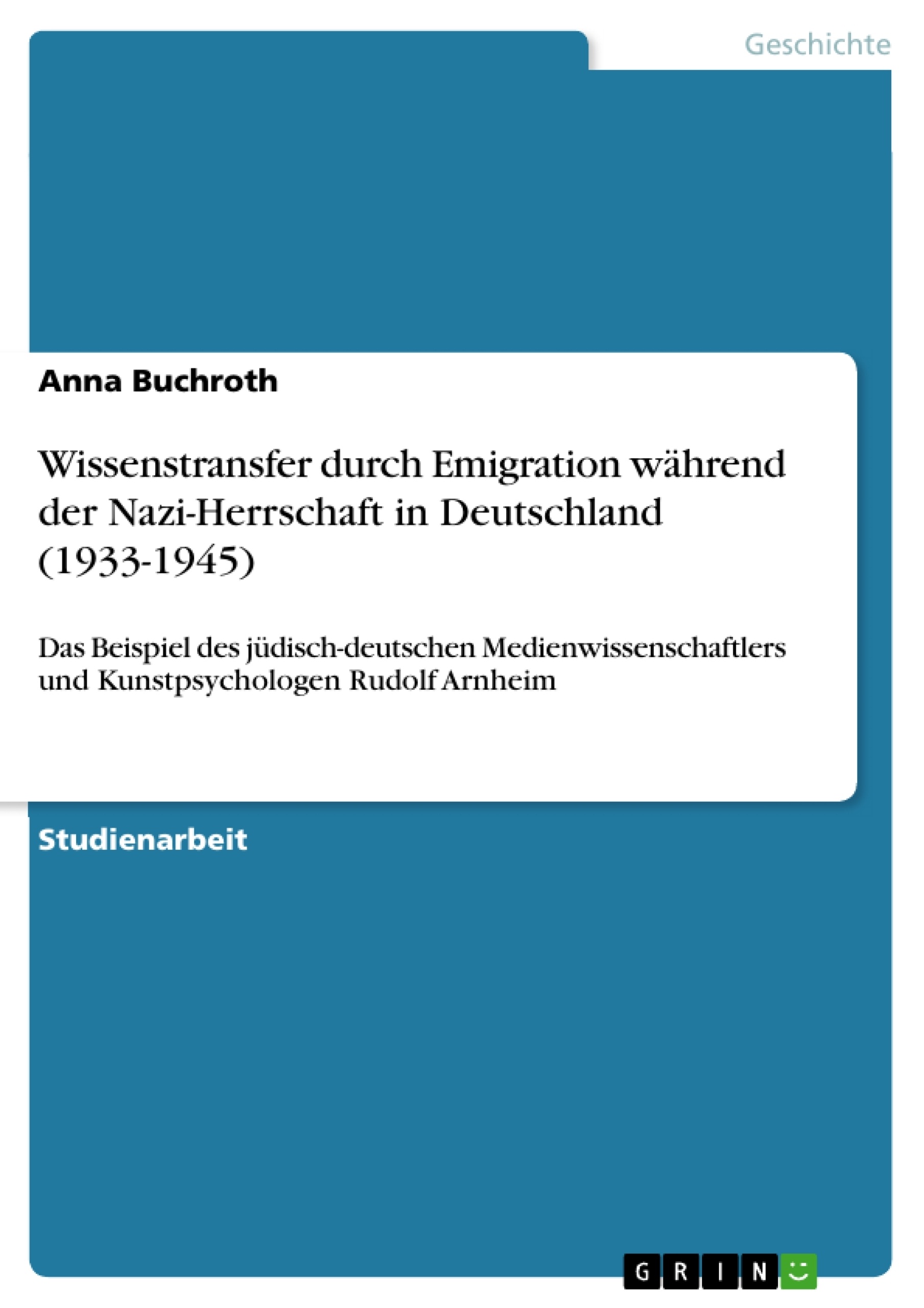Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den Umständen, die zur Emigration des deutsch-jüdischen Kunstpsychologen Rudolf Arnheim in die USA führten. Anlass für seine Migration war die Naziherrschaft in Deutschland zwischen 1933-1945, der er zu entkommen versuchte. In diesem Kontext kann von einer „erzwungenen Migration“ gesprochen werden.
Das erste Kapitel stellt die Ausgangslage dar. Es geht zunächst um Rudolf Arnheims Zeit in Deutschland, bevor er beschließt Deutschland zu verlassen. Hier soll untersucht werden, inwieweit sein familiärer Hintergrund und seine Qualifikationen ihm dabei helfen, sich in einem anderen Land zu integrieren. Von Interesse ist die Frage, welche günstigen Voraussetzungen Rudolf Arnheim mit in das neue Land brachte, die ihm möglicherweise dort weiterhalfen.
Die Emigration von Rudolf Arnheim führte nicht auf direktem Wege in die USA, sondern verlief über verschiedene Zwischenstationen. Die Bedeutung der verschiedenen Zwischenstationen in Bezug auf seine späteren beruflichen Chancen in den USA sollen einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Dies erklärt die strukturelle Untergliederung der Arbeit in die Länder, die im Rückblick Zwischenstationen auf seinem Weg in die Vereinigten Staaten darstellten.
Im vierten Kapitel sollen die theoretischen Konzepte des „Brain Drain“, „Brain Gain“ und „Brain Circulation“ in Bezug auf das Wirken Rudolf Arnheims hin untersucht und angewandt werden. Es geht darum, zu erkunden, wie weitreichend sein Werk war. Wurden seine Arbeiten nur innerhalb der USA als bedeutend wahrgenommen oder wurden sie auch in anderen Ländern rezipiert? Zu welchen möglichen Wechselwirkungen kam es als Reaktion auf sein Werk? Im Fazit sollen schließlich noch einmal alle bisherigen Erkenntnisse und Einsichten zusammengefasst und auf die ursprüngliche Fragestellung hin zurückgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeit in Deutschland (1904-1933)
- Emigration
- Italien (1933-1939)
- England (1939-1940)
- USA (1940-2007)
- Bedingungen der Emigration
- Faktoren der erfolgreichen Emigration
- „Brain Drain“, „Brain Gain“ oder „Brain Circulation“?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Umstände, die zur Emigration des deutsch-jüdischen Kunstpsychologen Rudolf Arnheim in die USA führten. Im Vordergrund steht die „erzwungene Migration“ aufgrund der Naziherrschaft in Deutschland. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Arnheims familiärem Hintergrund und seinen Qualifikationen für seine Integration in ein neues Land, sowie die Bedeutung von Zwischenstationen auf seinem Weg in die Vereinigten Staaten.
- Die Ausgangslage von Rudolf Arnheims Leben in Deutschland vor 1933
- Die Bedeutung von Arnheims familiärem Hintergrund und seinen Qualifikationen für seine Integration in ein neues Land
- Die Rolle von Zwischenstationen auf Arnheims Weg in die USA
- Die Anwendung von „Brain Drain“, „Brain Gain“ und „Brain Circulation“ auf Arnheims Wirken
- Die Rezeption von Arnheims Werk innerhalb und außerhalb der USA
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Ausgangslage von Rudolf Arnheims Leben in Deutschland vor 1933 dar. Es beleuchtet seine familiäre Herkunft, seine akademische Laufbahn und seine frühen Schriften. Kapitel 2 befasst sich mit der Bedeutung von Arnheims familiärem Hintergrund und seinen Qualifikationen für seine Integration in ein neues Land. Es analysiert, welche Voraussetzungen ihm bei der Emigration halfen. Kapitel 3 widmet sich den verschiedenen Zwischenstationen auf Arnheims Weg in die USA und deren Bedeutung für seine späteren beruflichen Chancen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Emigration des deutsch-jüdischen Kunstpsychologen Rudolf Arnheim in die USA im Kontext der Naziherrschaft. Die Schlüsselwörter sind: Emigration, „erzwungene Migration“, Kunstpsychologie, „Brain Drain“, „Brain Gain“, „Brain Circulation“, Integration, Zwischenstationen, Rezeption, Werk.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Rudolf Arnheim?
Rudolf Arnheim war ein bedeutender deutsch-jüdischer Kunstpsychologe, der aufgrund der Naziherrschaft aus Deutschland emigrieren musste.
Über welche Stationen verlief Arnheims Emigration?
Seine Flucht führte ihn von Deutschland über Italien (1933-1939) und England (1939-1940) schließlich in die USA.
Was bedeuten "Brain Drain" und "Brain Gain" in diesem Kontext?
"Brain Drain" bezeichnet den Verlust von Intellektuellen für Deutschland, während "Brain Gain" den Wissensgewinn für die Aufnahmeländer, insbesondere die USA, beschreibt.
Welche Faktoren halfen Arnheim bei seiner Integration?
Sein familiärer Hintergrund, seine hohe akademische Qualifikation und seine bereits in Deutschland veröffentlichten Schriften waren wichtige Voraussetzungen.
War Arnheims Werk nur in den USA bedeutend?
Nein, die Arbeit untersucht auch die internationale Rezeption seines Werks und die Wechselwirkungen (Brain Circulation), die durch seine Arbeiten weltweit entstanden.
Warum wird von "erzwungener Migration" gesprochen?
Weil Arnheim Deutschland nicht freiwillig verließ, sondern aufgrund der lebensbedrohlichen Verfolgung durch das NS-Regime fliehen musste.
- Quote paper
- Anna Buchroth (Author), 2013, Wissenstransfer durch Emigration während der Nazi-Herrschaft in Deutschland (1933-1945), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351092