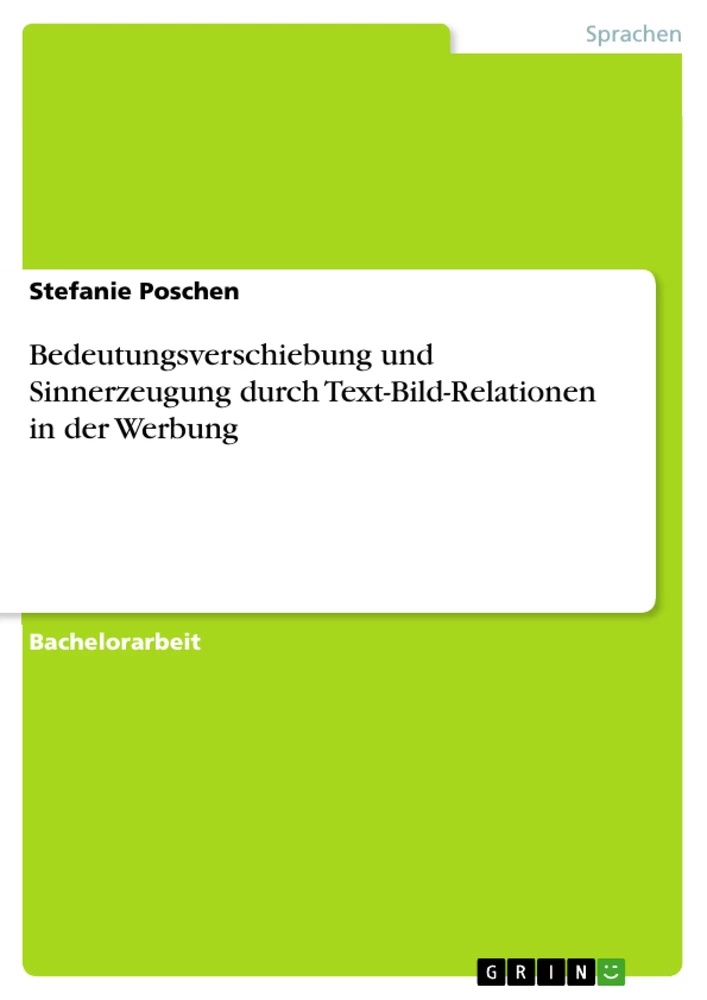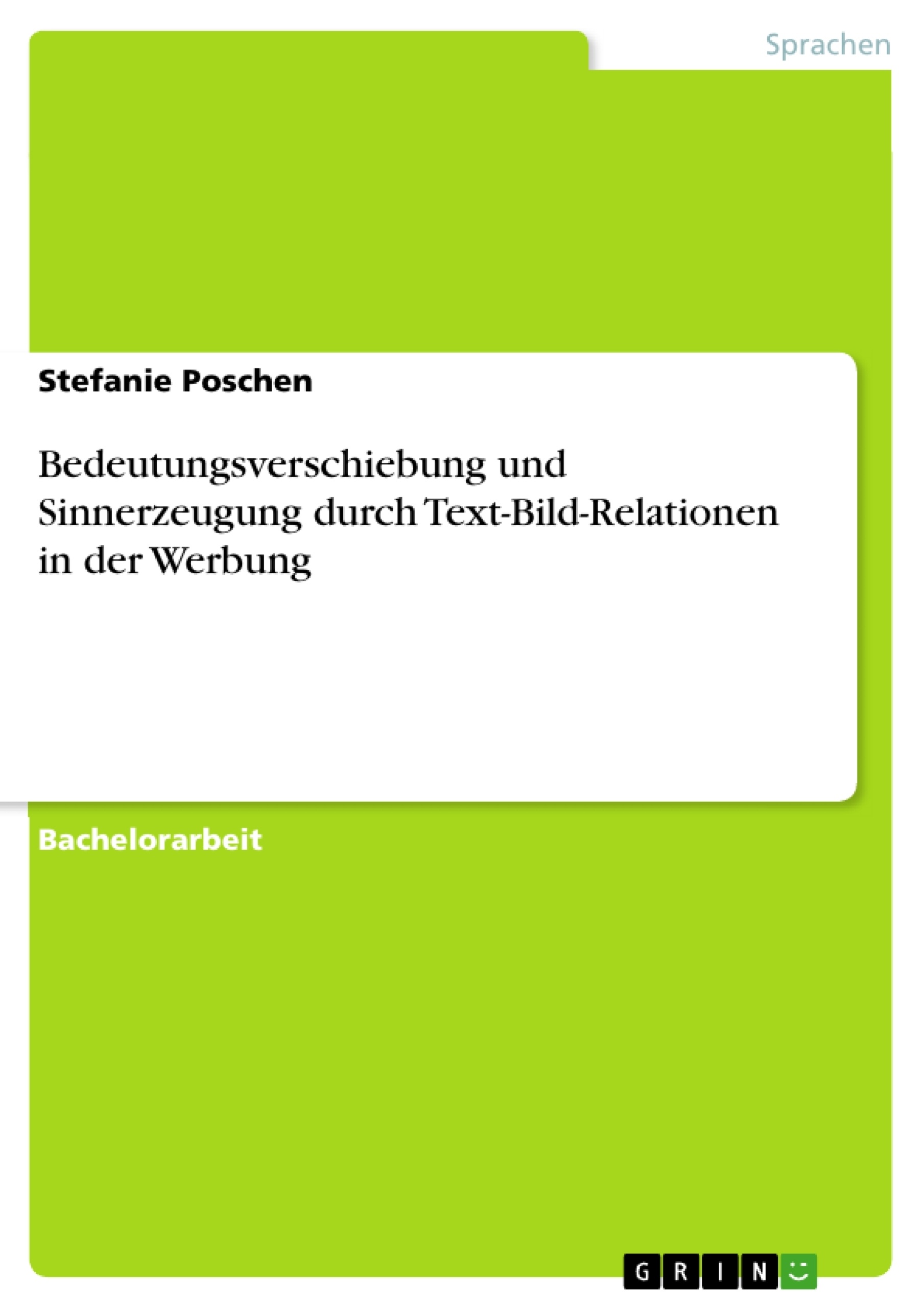„[...]
visible language
is only the tip of the iceberg
of invisible meaning construction
that goes on as we think and talk.“ (Fauconnier 1997: 1).
Sprachgebrauch und Sprachverstehen lässt sich anhand der Metapher des Eisberges gut verdeutlichen: sie zeigt, dass ein sprachliches Zeichen allein nicht ausreicht, um Bedeutung umfassend zu beschreiben – es ist lediglich die Spitze des Eisberges. Die Bedeutungskonstruktion hingegen findet im Verborgenen statt und umfasst viel mehr, als die lexikalische Bedeutung des sichtbaren oder hörbaren Sprachzeichens bietet. Hintergrundwissen, Weltwissen und Kontext spielen für die Konstruktion von Bedeutung eine wichtige Rolle und verlangen dem Rezipienten oftmals anspruchsvolle kognitive Leistungen ab.
Insbesondere in der Werbekommunikation ragt die Spitze des Eisberges nur geringfügig aus dem Meer hervor, da meist nur wenige sprachliche Zeichen realisiert werden und die Werbebotschaft oft unterdeterminiert ist (vgl. Ziem 2012: 73). Der Rezipient steht vor der Aufgabe, anhand der gegebenen Zeichen und seines Hintergrundwissens unter Berücksichtigung des Kontextes die Bedeutung zu erschließen.
Neben den sprachlichen Zeichen sind ebenfalls die bildlichen Zeichen in der Werbung von großer Bedeutung, da beide Zeichenkodes miteinander in Beziehung treten (vgl. Stöckl 2011; 2012). Sprache-Bild-Relationen spielen bei der Bedeutungskonstruktion in der Werbung somit eine wichtige Rolle. Des Weiteren wird bei der Rezeption von Werbung der Betrachter oft durch pointierte Werbeaussagen überrascht (vgl. Ziem 2006: 47). Dies geschieht vor allem, wenn eine aufgebaute Bedeutung durch weitere Informationen – sei es durch Bild- oder Sprachzeichen – verschoben und neu interpretiert wird (vgl. ebd.). Da solch eine Bedeutungsverschiebung in der Werbung ein attraktives Mittel zur Erzeugung von Witz und Überraschung darstellt (vgl. ebd.), soll sie ebenfalls in dieser Ausarbeitung Beachtung finden.
Alexander Ziem hat die Bedeutungsverschiebung und Bedeutungskonstruktion in Werbung untersucht und anhand der Frame-Semantik und mit Hilfe von Fauconniers und Turners Blending-Theorie überzeugend dargestellt, wie in der Werbung Sinn erzeugt wird (vgl. Ziem 2012; 2006). Bis heute haben an Ziems Ausarbeitung kaum Sprachwissenschaftler angeknüpft oder seine Untersuchungen weitergeführt. Diesbezüglich ist es besonders interessant sich näher mit Ziems Ausführungen auseinanderzusetzen und diese gegebenenfalls zu erweitern.
Ziel dieser Ausarbeitung (…)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Werbung: eine Einführung
- 2.1 Was sind die Bausteine einer Werbeanzeige?
- 2.2 Die Rezeption und der Adressatenkreis von Werbung
- 3. Eine Einführung in die Frame-Semantik und die Blending-Theorie
- 3.1 Die Frame-Semantik
- 3.1.1 Die Ursprünge der Frame-Semantik nach Charles J. Fillmore
- 3.1.2 Frames: slots, fillers und default values
- 3.1.3 Bedeutungsverschiebung
- 3.2 Die Blending-Theorie
- 3.2.1 Mentale Räume, Blending und emergente Strukturen
- 3.2.2 Blending in Werbeanzeigen
- 3.3 Die zwei Bedeutungs-Theorien und ihre Potenziale
- 4. Semantische und semiotische Betrachtungsaspekte
- 4.1 Frame-Verschiebung und Sinnerzeugung
- 4.1.1 Wie Werbung durch Frame-Verschiebung und Blending Sinn ergibt
- 4.1.2 Ziems heuristischer Leitfaden zur semantischen Analyse von Werbung
- 4.2 Semiotische Aspekte einer Werbeanalyse
- 4.2.1 Text-Bild-Relationen in der Werbung
- 4.2.2 Das Ausdruckspotenzial von Sprache und Bild
- 4.2.3 Kontextuelles Verstehen von Bildern
- 4.3 Eine semiotische Werbeanalyse
- 4.3.1 Semiotische Grundprozesse
- 4.3.2 Intermodale Kohärenz
- 4.3.3 Textstrukturen und Narration
- 4.4 Verknüpfungsmuster von Sprache und Bild
- 4.4.1 Das räumlich-syntaktische Muster
- 4.4.2 Das informationsbezogene Muster
- 4.4.3 Das rhetorisch-semantische Muster
- 4.5 Der Verstehensprozess von multimodaler Werbung mit Bedeutungsverschiebung
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung zielt darauf ab, die Bedeutungsverschiebung und Sinnerzeugung durch Text-Bild-Relationen in der Werbung zu beschreiben und zu überprüfen, ob sich die angewandten Theorien für dieses Vorhaben eignen. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse von komplexen Werbebotschaften, in denen Sprache und Bild zusammenwirken, um eine Botschaft zu vermitteln.
- Frame-Semantik und Blending-Theorie als Werkzeuge zur Analyse von Bedeutungsverschiebung in der Werbung
- Semiotische Analyse von Text-Bild-Relationen und deren Rolle bei der Bedeutungskonstruktion
- Methodische Integration von semantischen und semiotischen Analyseaspekten für ein umfassenderes Verständnis von Werbebotschaften
- Verstehen des Prozesses der Bedeutungsverschiebung und Sinnerzeugung durch Text-Bild-Relationen in multimodaler Werbung
- Anwendung der Analysemethoden auf konkrete Beispiele aus der Werbepraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bedeutungsverschiebung und Sinnerzeugung in der Werbung ein, wobei der Fokus auf der Rolle von Text-Bild-Relationen liegt. Kapitel 2 bietet eine Einführung in die wichtigsten Bestandteile einer Werbeanzeige und beleuchtet die Rezeptionsbedingungen und den Adressatenkreis von Werbung. Kapitel 3 skizziert die Grundzüge der Frame-Semantik und der Blending-Theorie, wobei wichtige Begriffe geklärt werden. Kapitel 4 befasst sich mit semantischen und semiotischen Betrachtungsaspekten, wobei die Text-Bild-Relationen in der Werbung im Vordergrund stehen. Dieses Kapitel analysiert die Verknüpfungsmuster von Sprache und Bild sowie den Verstehensprozess von multimodaler Werbung mit Bedeutungsverschiebung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Bedeutungsverschiebung, Sinnerzeugung, Text-Bild-Relationen, Frame-Semantik, Blending-Theorie, semiotische Analyse, Werbebotschaften, Multimodalität, Bedeutungskonstruktion, Rezeption, Adressatenkreis.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird in der Werbung durch Text und Bild Bedeutung erzeugt?
Bedeutung entsteht oft durch das Zusammenspiel beider Kodes, wobei kognitive Prozesse wie Frame-Verschiebung und Blending genutzt werden, um beim Rezipienten Sinn zu stiften.
Was ist die Blending-Theorie im Kontext der Werbeanalyse?
Die Blending-Theorie (nach Fauconnier und Turner) beschreibt, wie verschiedene mentale Räume kombiniert werden, um neue, emergente Bedeutungsstrukturen zu schaffen, die oft überraschend oder witzig wirken.
Welche Rolle spielt die Frame-Semantik bei der Interpretation von Werbung?
Frames sind Wissensstrukturen (mit Slots und Fillern), die uns helfen, Informationen einzuordnen. Werbung nutzt oft „Frame-Verschiebungen“, um Erwartungen zu brechen und Aufmerksamkeit zu generieren.
Was versteht man unter „intermodaler Kohärenz“?
Intermodale Kohärenz bezeichnet den inhaltlichen Zusammenhang zwischen verschiedenen Zeichenmodalitäten, in diesem Fall zwischen dem geschriebenen Text und dem gezeigten Bild in einer Anzeige.
Warum ist Weltwissen für das Verständnis von Werbung wichtig?
Da Werbebotschaften oft unterdeterminiert sind (wenig Sprache, viel Bild), muss der Rezipient sein Hintergrund- und Weltwissen nutzen, um die „Spitze des Eisbergs“ der Bedeutung zu vervollständigen.
- Quote paper
- Stefanie Poschen (Author), 2016, Bedeutungsverschiebung und Sinnerzeugung durch Text-Bild-Relationen in der Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351147