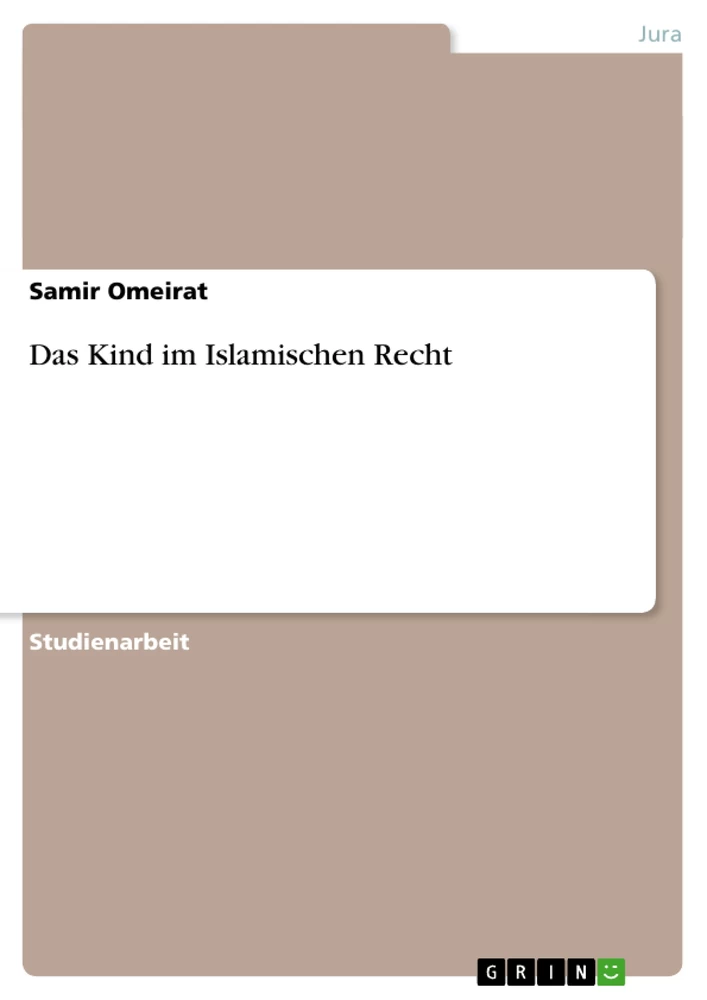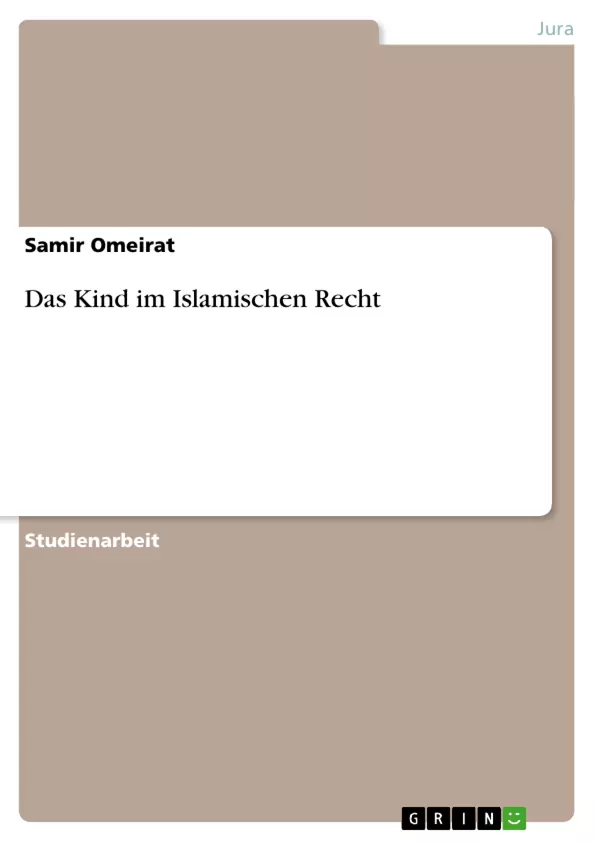Das Kind im Islamischen Recht
von: Samir Omeirat
6. Fachsemester
Gliederung
A. Islamisches Familienrecht und seine Bedeutung für das deutsche internationale Privatrecht 1
B. Islamisches Recht im Allgemeinen 1
I. Islamisches Recht als religiöses Recht 1
II. Rechtsschulen des islamischen Rechts 2
1. Sunnitische Rechtsschulen 2
a) Die malikitische Rechtsschule 2
b) Die hanafitische Rechtsschule 3
c) Die schafiitische Rechtsschule 3
d) Die hanbalitische Rechtsschule 3
2. Schiitische Rechtsschulen 3
III. Rechtsquellen des islamischen Rechts 4
1. Der Koran 4
2. Die Sunna 4
3. Ijma 5
4. Qiyas 5
5. Ijtihad 6
6. Urf 6
C. Das Kind im islamischen Recht 6
I. Abstammung 6
1. Mutterschaft 7
2. Vaterschaft 8
a) Vermutungsfristen der legitimen Vaterschaft 8
b) Legitimation durch nachträgliche Ehe 9
c) Bekenntnis der Vaterschaft 9
II. Die Annahme als Kind 11
III. Elterliche Sorge 11
1. Elterliche Sorge bei einem legitimen Kind 11
a) Die Hadanah 12
aa) Länge der Hadanah 12
bb) Gründe für den Entzug der Hadanah 13
cc) Übertragung der Hadanah auf eine andere Person 14
b) Die Walaya 15
aa) Personensorgerechtlicher Teil der Walaya 15
bb) Vermögenssorgerechtlicher Teil der Walaya 16
(1) Befugnisse des testamentarisch einberufenen Vermögenssorgeberechtigten 16
(2) Befugnisse des gerichtlich einberufenen Vermögenssorgeberechtigten 17
cc) Beendigung und Entzug der Walaya 17
2. Elterliche Sorge nach vollzogener Scheidung 18
3. Elterliche Sorge bei illegitimen Kindern 18
IV. Unterhaltspflichten gegenüber dem Kind 19
1. Die Unterhaltspflicht im Allgemeinen 19
2. Unterhalt für legitime Kinder 20
3. Unterhalt für illegitime Kinder 21
V. Die Geschäftsfähigkeit 21
1. 1. Stufe: Zeitraum von der Vollendung der Geburt bis zum Erreichen des Alters der Unterscheidungsfähigkeit 22
2. 2. Stufe: Zeitraum vom Alter der Unterscheidungsfähigkeit bis zum Erreichen des Alters der Mündigkeit in in persönlichen Angelegenheiten 22
3. 3. Stufe: Zeitraum vom Alter der Mündigkeit in persönlichen Angelegenheiten bis zur Volljährigkeit in Vermögensangelegenheiten 23
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Islamisches Familienrecht und seine Bedeutung für das deutsche internationale Privatrecht
- Islamisches Recht im Allgemeinen
- Islamisches Recht als religiöses Recht
- Rechtsschulen des islamischen Rechts
- Sunnitische Rechtsschulen
- Schiitische Rechtsschulen
- Rechtsquellen des islamischen Rechts
- Der Koran
- Die Sunna
- Ijma
- Qiyas
- Ijtihad
- Urf
- Das Kind im islamischen Recht
- Abstammung
- Mutterschaft
- Vaterschaft
- Vermutungsfristen der legitimen Vaterschaft
- Legitimation durch nachträgliche Ehe
- Bekenntnis der Vaterschaft
- Die Annahme als Kind
- Elterliche Sorge
- Elterliche Sorge bei einem legitimen Kind
- Elterliche Sorge nach vollzogener Scheidung
- Elterliche Sorge bei illegitimen Kindern
- Unterhaltspflichten gegenüber dem Kind
- Die Unterhaltspflicht im Allgemeinen
- Unterhalt für legitime Kinder
- Unterhalt für illegitime Kinder
- Die Geschäftsfähigkeit
- Abstammung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema des Kindes im islamischen Recht. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Kinder im islamischen Rechtssystem zu beleuchten und deren Bedeutung für das deutsche internationale Privatrecht zu analysieren. Dabei werden verschiedene Aspekte des islamischen Familienrechts im Hinblick auf das Kind behandelt, wie beispielsweise die Abstammung, die Elterliche Sorge und die Unterhaltspflicht.
- Islamisches Familienrecht und seine Bedeutung im internationalen Kontext
- Rechtliche Stellung des Kindes im islamischen Recht
- Regulierung von Abstammung, Elterlicher Sorge und Unterhaltspflicht
- Vergleich des islamischen Rechts mit dem deutschen Rechtssystem
- Aktuelle Herausforderungen im Bereich des internationalen Kindschaftsrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit widmet sich dem islamischen Familienrecht und dessen Bedeutung für das deutsche internationale Privatrecht. Dabei werden die grundlegenden Prinzipien des islamischen Familienrechts erläutert und die Relevanz für die Rechtsanwendung im internationalen Kontext beleuchtet.
Im zweiten Teil wird ein Überblick über das islamische Recht im Allgemeinen gegeben. Hierbei werden die verschiedenen Rechtsschulen des islamischen Rechts vorgestellt und die wichtigsten Rechtsquellen erläutert. Der Fokus liegt dabei auf den grundlegenden Prinzipien und deren Relevanz für das Familienrecht.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit dem Kind im islamischen Recht. Die Kapitel befassen sich mit der Abstammung, der Elterlichen Sorge und den Unterhaltspflichten gegenüber dem Kind. Die verschiedenen rechtlichen Regelungen für legitime und illegitime Kinder werden aufgezeigt und die Bedeutung des jeweiligen Rechtskreises für die Familie beleuchtet.
Schlüsselwörter
Islamisches Recht, Familienrecht, Kind, Abstammung, Elterliche Sorge, Unterhalt, Rechtsschulen, Rechtsquellen, Internationales Privatrecht, Kindeswohl, Vergleichendes Recht, Familienstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das islamische Familienrecht für das deutsche Recht?
Es spielt eine wichtige Rolle im internationalen Privatrecht, wenn Rechtsfälle mit Bezug zu islamisch geprägten Ländern vor deutschen Gerichten verhandelt werden.
Wie wird die Vaterschaft im islamischen Recht festgestellt?
Die Vaterschaft kann durch Vermutungsfristen in der Ehe, ein Bekenntnis des Vaters oder in bestimmten Fällen durch eine nachträgliche Ehe legitimiert werden.
Was versteht man unter „Hadanah“ und „Walaya“?
Hadanah bezeichnet das Personensorgerecht (oft bei der Mutter), während Walaya die rechtliche Vertretung und Vermögenssorge (traditionell beim Vater) umfasst.
Gibt es Unterschiede zwischen legitimen und illegitimen Kindern?
Ja, das islamische Recht unterscheidet deutlich bei Unterhaltspflichten und Erbansprüchen zwischen Kindern, die innerhalb oder außerhalb einer rechtmäßigen Ehe geboren wurden.
Wann erreicht ein Kind im islamischen Recht die Geschäftsfähigkeit?
Die Geschäftsfähigkeit entwickelt sich stufenweise: von der Geburt über das Alter der Unterscheidungsfähigkeit bis hin zur vollen Mündigkeit in Vermögensangelegenheiten.
- Quote paper
- Samir Omeirat (Author), 2002, Das Kind im Islamischen Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35120