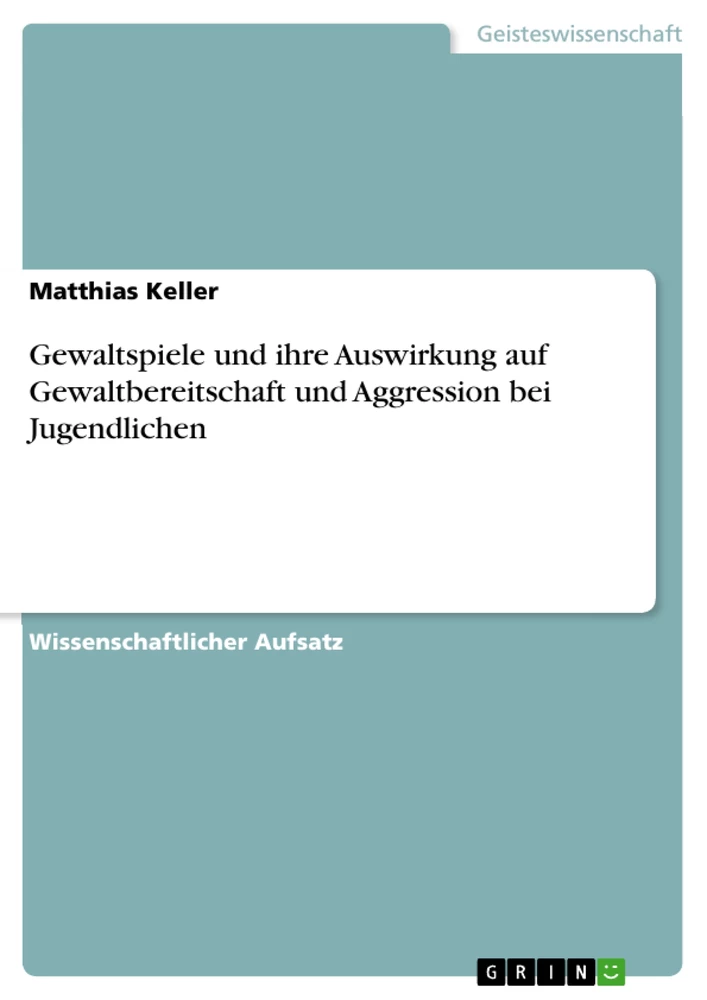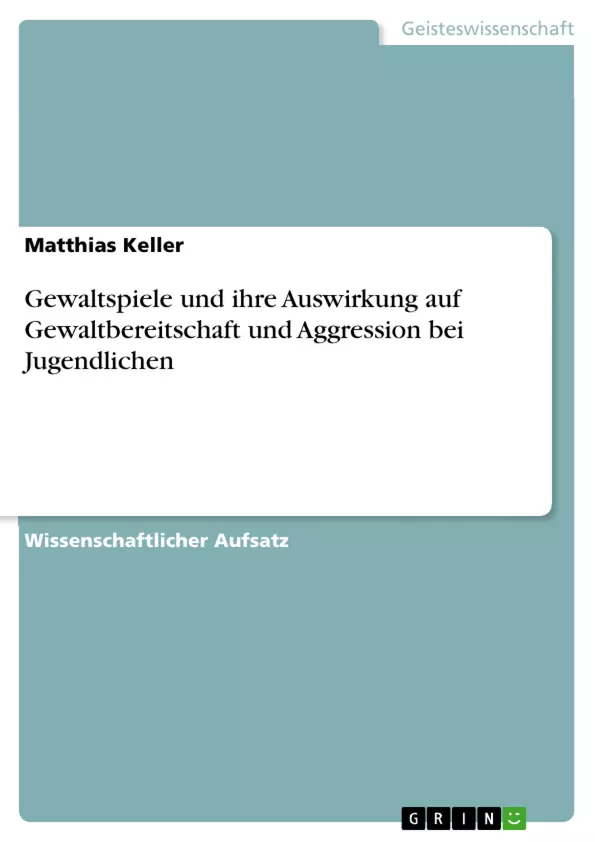In der heutigen Zeit sind Computer nicht mehr wegzudenken. Aus diesem Grund boomt auch die Computerspielentwicklung. Gemäß der JAMES-Studie besitzen rund 2/3 der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren einen eigenen Computer oder Laptop. Da sich die Technik der Komponenten eines Computers wie beispielsweise der Grafikkarte oder des Prozessors ständig stark weiterentwickelt, werden die Computerspiele grafisch immer besser und somit auch realitätsnaher.
Gemäß Anderson und Huesman erhöhen Gewaltdarstellungen in den Medien wie zum Beispiel Computerspiele mit gewalttätigem Inhalt mit großer Wahrscheinlichkeit kurz- sowie auch langfristig aggressives oder gewalttätiges Verhalten. Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit folgender Frage: Wie wirken sich Computerspiele mit gewalttätigem Inhalt auf die Jugend und deren Gewaltbereitschaft und Aggressionen aus?
Da sich diese Arbeit mit Computerspielen beschäftigt, spielen die Medienwissenschaften eine bestimmte Rolle. Die Psychologie ebenfalls eine wichtige Wissenschaftsdisziplin, welche in diese Arbeit miteinbezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema und Problemstellung
- Fragestellung
- Begründung der Auswahl von Theoriebezügen und Wissenschaftsdisziplinen
- Begriffsdefinitionen
- Gewalt
- Gewaltspiele
- Aggression
- Aggressivität
- Jugend
- Vorgehensweise für Literatur und statistische Quellen
- Zahlen und Fakten
- Lieblingsspiele
- Computerbesitz
- Computerspieler 2014
- Computerspieler 2012
- Gewalthaltige Computerspiele und Ihre Auswirkung
- Kurzfristige Wirkung
- Stimulationsthese
- Erregungsthese
- Das kurzfristige "General Affective Agression Modell"
- Langfristige Wirkung
- Die Habitualisierungsthese
- Die Kultivierungsthese
- Die sozial-kognitive Lerntheorie
- Das langfristige "General Affective Aggression Modell"
- Katharsis Theorie
- Diskussion und Reflektion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Arbeit untersucht die Auswirkungen von Computerspielen mit gewalttätigem Inhalt auf die Jugend und deren Gewaltbereitschaft sowie Aggression. Sie befasst sich mit der Frage, wie diese Spiele die Jugend beeinflussen und ob sie zu einer Steigerung von aggressiven Verhaltensweisen führen. Dabei werden verschiedene wissenschaftliche Theorien und Disziplinen, wie die Medienwissenschaften und die Psychologie, herangezogen.
- Einfluss von Gewaltspielen auf die Jugend
- Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewaltbereitschaft
- Theorien zur Wirkungsweise von Gewaltspielen
- Analyse von Statistiken und Studien zum Thema
- Diskussion der Erkenntnisse und deren Relevanz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema, die Problemstellung und die Fragestellung der Arbeit vor. Sie erläutert die Relevanz der gewählten Wissenschaftsdisziplinen und beschreibt die Vorgehensweise bei der Literatur- und Datenrecherche. Das Kapitel "Zahlen und Fakten" präsentiert Statistiken zum Computerbesitz und zum Spielverhalten von Jugendlichen in der Schweiz. Im Kapitel "Gewalthaltige Computerspiele und Ihre Auswirkung" werden verschiedene Theorien zur kurz- und langfristigen Wirkung von Gewaltspielen auf die Gewaltbereitschaft und Aggression der Jugend beleuchtet.
Schlüsselwörter
Gewaltspiele, Jugend, Aggression, Gewaltbereitschaft, Medienwissenschaften, Psychologie, Stimulationsthese, Erregungsthese, Habitualisierungsthese, Kultivierungsthese, sozial-kognitive Lerntheorie, "General Affective Aggression Modell", Katharsis Theorie, Computerspiele, Computerbesitz, Statistiken, Studien, Forschungsergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Erhöhen Gewaltspiele die Aggression bei Jugendlichen?
Wissenschaftliche Theorien wie die Habitualisierungsthese legen nahe, dass Gewaltdarstellungen in Medien sowohl kurz- als auch langfristig aggressives Verhalten fördern können.
Was besagt die Katharsis-Theorie im Kontext von Computerspielen?
Die Katharsis-Theorie behauptet (umstrittenerweise), dass das Ausleben von Aggressionen in einem Spiel zu einer Reduktion realer Aggressionen führt.
Was ist das "General Affective Aggression Modell"?
Dieses Modell erklärt, wie persönliche und situative Faktoren durch das Spielen von Gewaltspielen zu aggressivem Verhalten führen können.
Welche langfristigen Wirkungen haben Gewaltspiele laut Forschung?
Theorien wie die Kultivierungsthese und die sozial-kognitive Lerntheorie beschreiben eine Abstumpfung (Habitualisierung) und das Erlernen aggressiver Verhaltensmuster.
Wie viele Jugendliche besitzen laut Studien einen Computer?
Gemäß der JAMES-Studie besitzen etwa zwei Drittel der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren einen eigenen Computer oder Laptop.
- Quote paper
- Matthias Keller (Author), 2015, Gewaltspiele und ihre Auswirkung auf Gewaltbereitschaft und Aggression bei Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351241