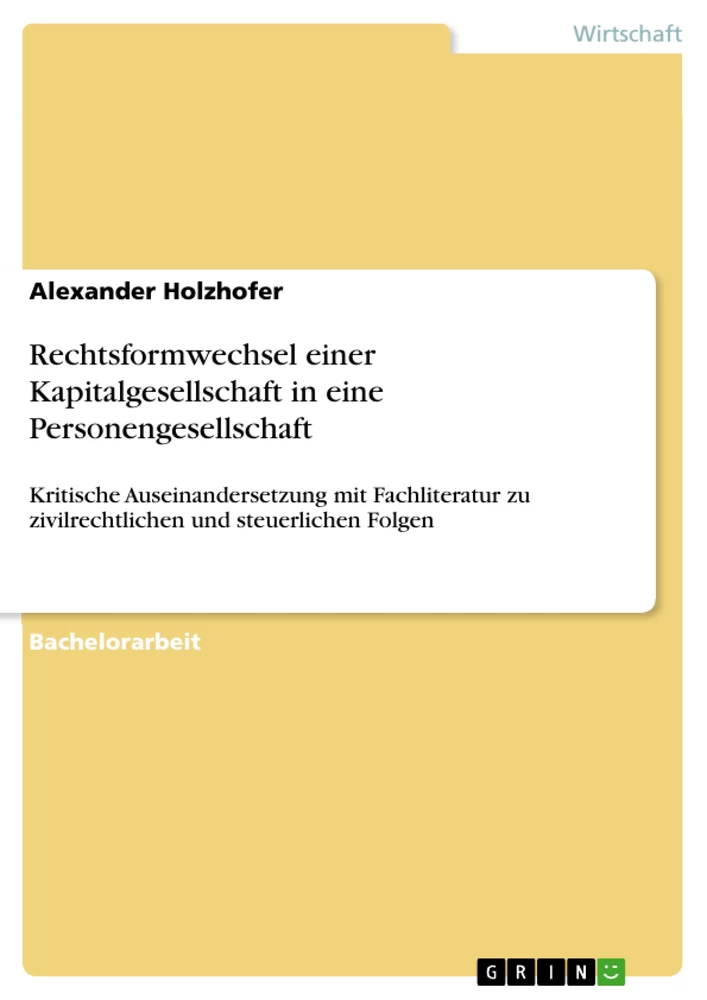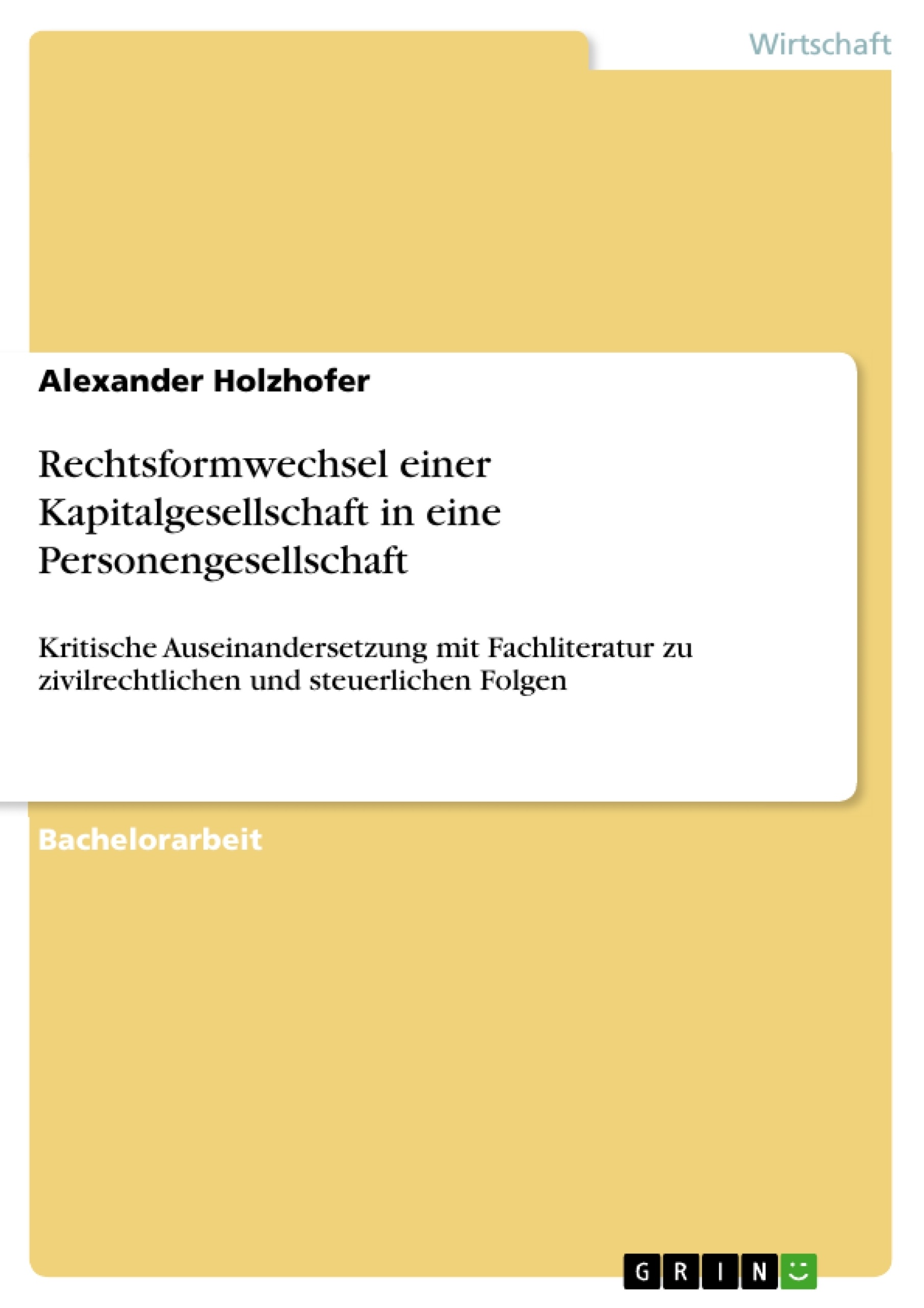Die Wahl der Rechtsform ist eine langfristige, wenngleich nicht unabänderliche Entscheidung. In Deutschland bietet das Zivilrecht eine Vielzahl an Rechtsformen, zwischen denen Unternehmen wählen können. Im Wesentlichen besteht die Wahl zwischen einem Einzelunternehmen, einer Personengesellschaft, einer Kapitalgesellschaft oder einer Mischform zwischen Personen- und Kapitalgesellschaft, wie beispielsweise die GmbH & Co. KG.
Unternehmen haben zumeist Hemmungen, ihre Rechtsform an die gegebenen Rahmenbedingungen ihres Unternehmens anzupassen. Dies ist den unübersichtlichen Folgen geschuldet, die sich aus einer Umwandlung ergeben können. Insbesondere die steuerlichen Folgen sind, abhängig von den Gegebenheiten, schwer durchschaubar.
Von der Problemstellung ausgehend, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, anhand einer Literaturanalyse zu ermitteln, wie sich eine Umwandlung, speziell der Rechtsformwechsel, vollzieht. Die Arbeit fokussiert sich dabei auf den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Das erste Kapitel bringt die Relevanz des Themas, die Zielsetzung und den im Folgenden kurz erläuterten Aufbau der Arbeit zum Ausdruck.
Das zweite Kapitel stellt die Kapitalgesellschaft und die Personengesellschaft in einem Rechtsformvergleich auf zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Ebene gegenüber. Des Weiteren werden die unterschiedlichen Motive, die zu einer Umwandlung einer Kapital- in eine Personengesellschaft führen, erörtert.
Im dritten Kapitel werden die beiden notwendigen Gesetze für eine Umwandlung vorgestellt sowie die einzelnen Möglichkeiten zur Änderung der Rechtsform dargestellt.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem zivilrechtlichen Formwechsel. Dabei werden explizit der Ablauf sowie die daraus resultierenden Rechtsfolgen aufgezeigt.
Im fünften Kapitel wird der Formwechsel aus steuerrechtlicher Sicht betrachtet. Untersucht werden insbesondere die Auswirkungen auf die übertragende Kapital-gesellschaft, die übernehmende Personengesellschaft sowie die Anteilsinhaber. Hierbei wird auf unterschiedliche Sachverhalte eingegangen, die die steuerlichen Folgen erheblich beeinflussen können. Das Kapitel endet mit einem Abschlussfall, der die steuerlichen Folgen veranschaulichen soll.
Die vorliegende Arbeit schließt in Kapitel sechs mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Rechtsformvergleich
- 2.1 Zivilrechtliche Grundlagen
- 2.1.1 Grundlagen zur Kapitalgesellschaft
- 2.1.2 Grundlagen zur Personengesellschaft
- 2.2 Steuerrechtliche Grundlagen
- 2.2.1 Besteuerung der Kapitalgesellschaft
- 2.2.1.1 Besteuerung auf Ebene der Körperschaft
- 2.2.1.2 Besteuerung auf Ebene der Anteilsinhaber
- 2.2.2 Besteuerung der Personengesellschaft
- 2.3 Steuerbelastungsvergleich
- 2.4 Motive der Umwandlung
- 2.4.1 Betriebswirtschaftliche Gründe
- 2.4.2 Steuerrechtliche Motive
- 3. Definition einer Umwandlung
- 3.1 Zivilrechtlicher Begriff einer Umwandlung
- 3.1.1 Möglichkeiten der Vermögensübertragung
- 3.1.2 Das Umwandlungsgesetz
- 3.1.2.1 Aufbau des UmwG
- 3.1.2.2 Umwandlungsarten nach dem UmwG
- 3.2 Steuerrechtlicher Begriff einer Umwandlung
- 3.2.1 Das Umwandlungssteuergesetz
- 3.2.2 Der Umwandlungssteuererlass
- 3.3 Verhältnis von UmwG zu UmwStG
- 4. Formwechsel aus zivilrechtlicher Sicht
- 4.1 Grundlagen
- 4.2 Der Ablauf des Formwechsels
- 4.2.1 Planungs- und Vorbereitungsphase
- 4.2.2 Beschlussphase
- 4.2.3 Vollzugsphase
- 4.3 Rechtsfolgen
- 5. Formwechsel aus steuerrechtlicher Sicht
- 5.1 Grundlagen
- 5.2 Rückwirkungsfunktion
- 5.2.1 Ausscheidende und eintretende Anteilsinhaber
- 5.2.2 Gewinnausschüttung
- 5.2.3 Zahlungen an Gesellschafter der umwandelnden Kapitalgesellschaft
- 5.2.4 Pensionszusagen an Gesellschafter der umwandelnden Kapitalgesellschaft
- 5.3 Steuerliche Folgen des übertragenden Rechtsträgers
- 5.3.1 Schlussbilanz
- 5.3.2 Übertragungsergebnis
- 5.4 Steuerliche Folgen des übernehmenden Rechtsträgers und Anteilsinhaber
- 5.4.1 Wertverknüpfung und Eintritt in die Rechtsstellung der Kapitalgesellschaft
- 5.4.2 Besteuerung des Vermögens
- 5.4.2.1 Vollausschüttungsfiktion
- 5.4.2.2 Ermittlung des Übernahmeergebnisses
- 5.4.2.3 Anschaffungs- und Einlagefiktion
- 5.4.2.4 Besteuerung des Übernahmeergebnisses
- 5.4.2.5 Übernahmefolgegewinn
- 5.4.3 Nebensteuern
- 5.5 Abschlussfall
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Rechtsformwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft. Ziel ist die kritische Auseinandersetzung der zivilrechtlichen und steuerlichen Folgen einer solchen Umwandlung. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede zwischen den Rechtsformen, die steuerlichen Implikationen und die Motive für einen solchen Wechsel.
- Zivilrechtliche Grundlagen des Rechtsformwechsels
- Steuerrechtliche Folgen der Umwandlung
- Vergleich der Besteuerung von Kapital- und Personengesellschaften
- Motive für den Rechtsformwechsel (betriebswirtschaftlich und steuerlich)
- Ablauf des Rechtsformwechsels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Rechtsformwechsels von einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie benennt die Relevanz des Themas im Kontext von unternehmerischen Entscheidungen und strategischer Planung.
2. Der Rechtsformvergleich: Dieses Kapitel vergleicht die zivilrechtlichen und steuerrechtlichen Grundlagen von Kapital- und Personengesellschaften. Es werden die Unterschiede in der Haftung, der Rechtsgestaltung und der Besteuerung detailliert dargestellt. Der Vergleich bildet die Grundlage für die spätere Analyse der Folgen des Rechtsformwechsels. Die Kapitel 2.1 und 2.2 legen die jeweiligen Grundlagen dar, während 2.3 einen direkten Vergleich der Steuerbelastung beider Rechtsformen ermöglicht. Abschließend beleuchtet Kapitel 2.4 die betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Motive, die einen Rechtsformwechsel auslösen können.
3. Definition einer Umwandlung: Dieses Kapitel präzisiert den zivilrechtlichen und steuerrechtlichen Begriff der Umwandlung. Es analysiert das Umwandlungsgesetz (UmwG) und das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) sowie deren Interaktion. Es beschreibt die verschiedenen Arten von Umwandlungen und deren rechtliche Relevanz. Der Fokus liegt auf der Klärung der terminologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den anschließenden Formwechsel.
4. Formwechsel aus zivilrechtlicher Sicht: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Rechtsformwechsel aus zivilrechtlicher Perspektive. Es beschreibt den Ablauf des Formwechsels in drei Phasen: Planung und Vorbereitung, Beschlussfassung und Vollzug. Die zivilrechtlichen Grundlagen und die damit verbundenen Rechtsfolgen werden detailliert erläutert, wobei der Schwerpunkt auf den rechtlichen Schritten und den damit verbundenen Konsequenzen liegt.
5. Formwechsel aus steuerrechtlicher Sicht: Dieses Kapitel analysiert die steuerlichen Folgen des Rechtsformwechsels. Es behandelt die Rückwirkungsfunktion, die steuerlichen Folgen für den übertragenden und den übernehmenden Rechtsträger sowie die Besteuerung des Vermögens. Besonderes Augenmerk liegt auf der Vollausschüttungsfiktion, der Ermittlung des Übernahmeergebnisses und der Anschaffungs- und Einlagefiktion. Der Abschlussfall dient zur Veranschaulichung der komplexen steuerlichen Aspekte.
Schlüsselwörter
Rechtsformwechsel, Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Umwandlungssteuerrecht, Umwandlungsgesetz, Zivilrecht, Steuerrecht, Steuerbelastung, Betriebswirtschaft, Haftung, Gesellschaftsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Rechtsformwechsel: Kapitalgesellschaft in Personengesellschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit analysiert den Rechtsformwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft. Sie untersucht die zivilrechtlichen und steuerlichen Folgen einer solchen Umwandlung, beleuchtet die Unterschiede zwischen den Rechtsformen, die steuerlichen Implikationen und die Motive für einen solchen Wechsel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: zivilrechtliche Grundlagen des Rechtsformwechsels, steuerrechtliche Folgen der Umwandlung, Vergleich der Besteuerung von Kapital- und Personengesellschaften, Motive für den Rechtsformwechsel (betriebswirtschaftlich und steuerlich) und den Ablauf des Rechtsformwechsels.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Rechtsformvergleich (inkl. zivil- und steuerrechtlicher Grundlagen sowie Steuerbelastungsvergleich und Motiven der Umwandlung), Definition einer Umwandlung (inkl. zivil- und steuerrechtlicher Begriffsbestimmung und dem Verhältnis von UmwG zu UmwStG), Formwechsel aus zivilrechtlicher Sicht (inkl. Ablaufphasen und Rechtsfolgen), Formwechsel aus steuerrechtlicher Sicht (inkl. Rückwirkungsfunktion, steuerlichen Folgen für den übertragenden und übernehmenden Rechtsträger und Nebensteuern) und Fazit.
Welche zivilrechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die zivilrechtlichen Grundlagen von Kapital- und Personengesellschaften, den zivilrechtlichen Begriff der Umwandlung, das Umwandlungsgesetz (UmwG), die verschiedenen Arten von Umwandlungen und den Ablauf des Formwechsels (Planung, Beschlussfassung, Vollzug) mit den jeweiligen Rechtsfolgen.
Welche steuerrechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die steuerrechtlichen Aspekte umfassen die steuerrechtlichen Grundlagen von Kapital- und Personengesellschaften, den steuerrechtlichen Begriff der Umwandlung, das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG), den Steuerbelastungsvergleich beider Rechtsformen, die steuerlichen Folgen des Rechtsformwechsels (inkl. Rückwirkungsfunktion, Folgen für den übertragenden und übernehmenden Rechtsträger, Vollausschüttungsfiktion, Ermittlung des Übernahmeergebnisses, Anschaffungs- und Einlagefiktion, Übernahmefolgegewinn und Nebensteuern).
Welche Motive für einen Rechtsformwechsel werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl betriebswirtschaftliche als auch steuerrechtliche Motive, die einen Rechtsformwechsel von einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft auslösen können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rechtsformwechsel, Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Umwandlungssteuerrecht, Umwandlungsgesetz, Zivilrecht, Steuerrecht, Steuerbelastung, Betriebswirtschaft, Haftung, Gesellschaftsrecht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit den zivilrechtlichen und steuerlichen Folgen eines Rechtsformwechsels von einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft ab.
- Citar trabajo
- Alexander Holzhofer (Autor), 2016, Rechtsformwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351274