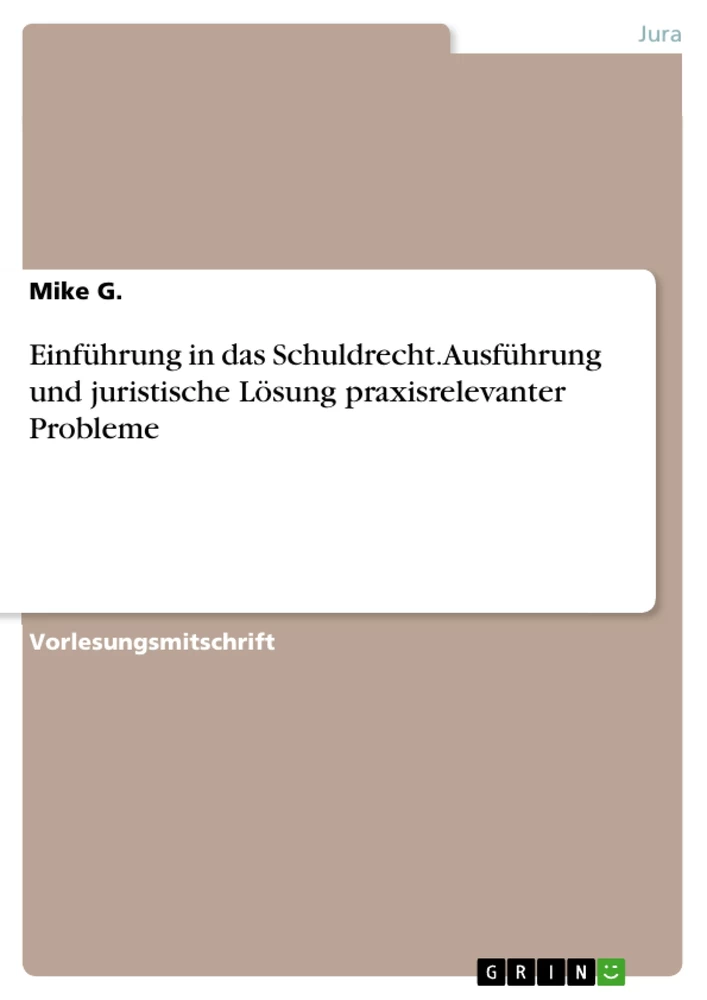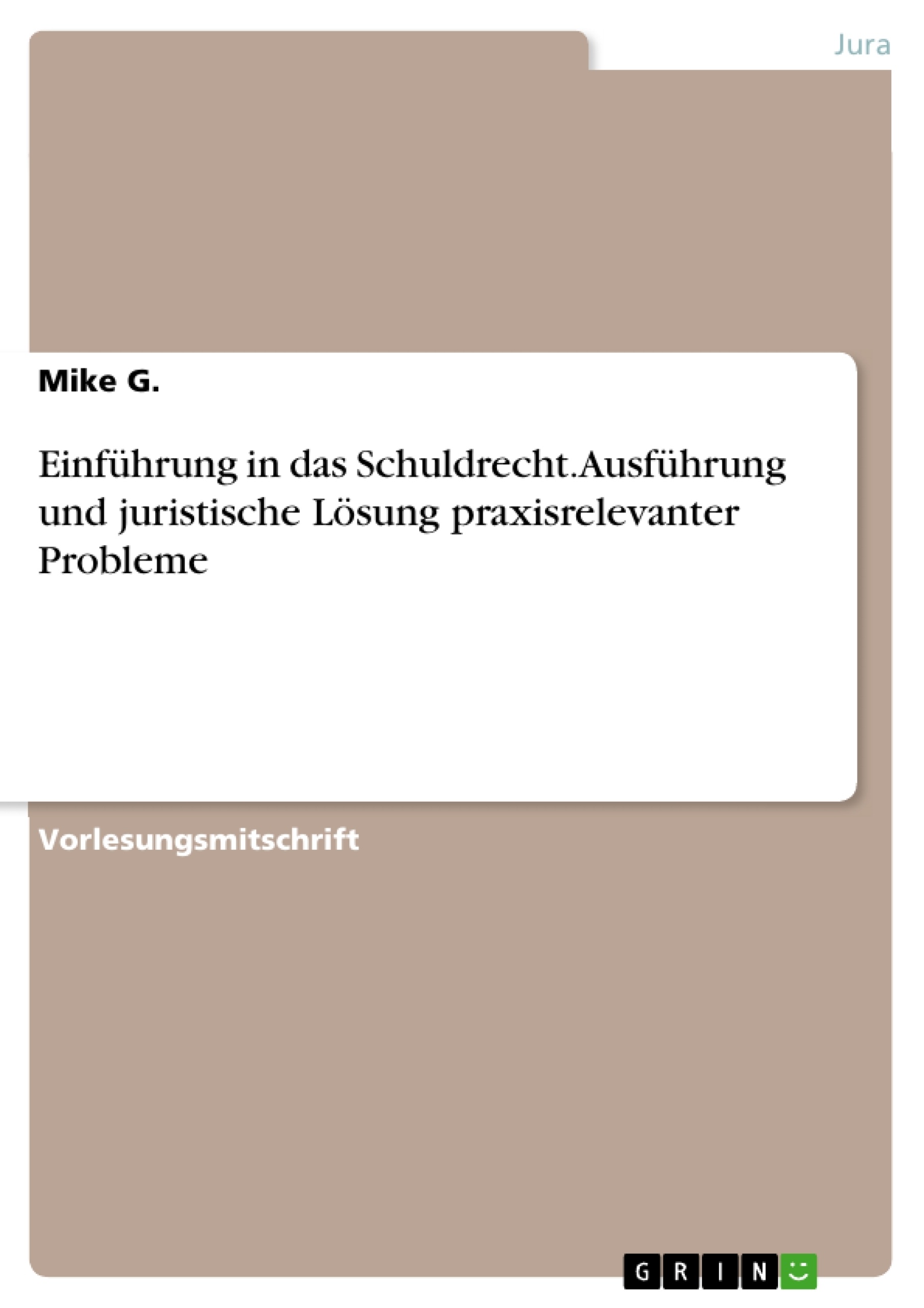Das deutsche Recht wird in der gesamten Welt für seine Genauigkeit gelobt, ist aber auch für seine Umständlichkeit bekannt. Belesenheit im deutschen Recht ist immer nur von Vorteil, deshalb werden in dieser Arbeit einige „Probleme“ des täglichen Lebens anhand des Schuldrechts aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) erörtert. Welche Rechte habe ich als Verbraucher? Worauf muss ich als Gewerbetreibender achten? Und darf mich mein Verkäufer wirklich derart behandeln?
Diese und noch viele andere Fragen sollen innerhalb dieses Textes geklärt werden. An einigen Stellen wird nicht sehr tief in die Materie eingetaucht, da es viel zu komplex für eine solche Zusammenfassung werden würde. Es wurden Probleme aufgegriffen, welche das BGB allgemeingültig löst und nicht unbedingt fallspezifisch (für jede Art von Verträgen unterschiedlich). Dieses Werk entstand ursprünglich anhand von Mitschriften der Schuldrechtsvorlesungen im Nebenfach Jura und wurden um einige Gedanken und Ausführungen aus der Sekundärliteratur sowie aus der jüngsten Geschichte erweitert. Es wird dem Leser erste Einblicke in das deutsche Rechtssystem gewähren und im Alltag von überaus hohem Nutzen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Europäisches Recht und anglo-amerikanisches Recht
- Entstehung des Rechts
- Das deutsche Rechtssystem
- Suchstrategie bei Anspruchsgrundlagen im BGB
- Schuldrecht
- Präjudiziensystem
- Vorgehensweise bei Betrachtung eines Falls
- Jus cogenz und dispositives Recht
- Nicht Zuordbares aus der ersten Vorlesung
- Nachtwächterstaat
- Steuerung des Marktverhaltens
- Grenzen der Privatautonomie
- Grundstruktur des bürgerlichen Rechts
- Rechtssubjekte
- Geschäftsfähigkeit
- Willenserklärung als Grundstein aller Verträge
- Verträge mit Lücken
- Auslegung von Rechtsnormen
- Objektiver Empfängerhorizont
- Bedeutung der Privatautonomie
- Entstehung Handelsrecht
- Invitatio ad offerendum
- Zitieren von Gesetzestexten
- Juristische Vorgehensweise im Fall des Druckfehlers
- Willensmängel // Unbewusstes Auseinanderfallen von Wille und Erklärung
- Anfechtung wegen Irrtum
- Arglistige Täuschung
- Willensmängel // Bewusstes Auseinanderfallen von Wille und Erklärung
- Wirksamkeit von Willenserklärungen
- Probleme bei empfangsbedürftigen Willensbekundungen unter Abwesenden
- Stellvertretung
- Neue Vorgehensweise bei Betrachtung von Fällen
- Zulässigkeit
- Eigene Willenserklärung
- Im fremden Namen
- Mit Vertretungsmacht
- Rechtsscheinvollmacht
- Vertreter handelt nicht im Rahmen der Vertretungsvollmacht
- Ausnahmen im Handelsrecht
- Haftung für Dritte
- Auf Grundlage eines Vertrags (gemäß § 280)
- Auf Grundlage des Deliktsrechts (gemäß § 831 I)
- Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz durch jus cogenz
- Schutzziel des deutschen Staates
- Schutz vor Überrumpelungseffekten durch Widerrufsrecht
- Rechtsfolge des Widerrufs
- Verbraucherschutz durch Informationspflichten für die Unternehmer
- Lieferung unbestellter Waren
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Rechtliche Vorschriften
- Drei Problemfelder bei AGBs
- Leistungsstörungen
- Drei Arten von Schadensersatz
- Diverse Anspruchsgrundlagen
- Vorschriften über den Verzug
- Unterschied Mahnung und Nachfrist
- Schadensersatz statt der gesamten Leistung
- Rücktritt vom Vertrag
- Schlechtleistung
- Ansprüche bei Schlechtleistung im Kaufrecht
- Unterschied Garantie und Mängelgewährleistung
- Gefahrenübergang nach § 446
- Ansprüche aus § 437
- Mangelfolgeschaden
- Beweisführung im deutschen Recht
- Trennung von Eigentums- und Vermögensschäden
- Vertragliche Ansprüche sind für Gläubiger lukrativer
- Sachmängelgewährleistung (Verbraucherschutz durch jus cogenz)
- Weiterfressender Mangel
- Produkthaftungsgesetz
- Eigentumsstörungen
- Kreditsicherung über Pfandrecht
- Wissensfragen Schuldrecht
- Antworten
- Übersicht Vorgehensweise bestimmter Fallgruppen
- Vorgehensweise Stellvertretung
- Vorgehensweise Verzug - Schadensersatz
- Vorgehensweise Schlechtleistung
- Vorgehensweise Widerruf
- Vorgehensweise Irrtum
- Vorgehensweise beschränkte Geschäftsfähigkeit
- Vorgehensweise Schadensersatz Eigentumsvorbehalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit erörtert ausgewählte Probleme des deutschen Schuldrechts aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), um dem Leser erste Einblicke in das deutsche Rechtssystem zu gewähren und im Alltag von Nutzen zu sein. Der Fokus liegt auf der verständlichen Erklärung rechtlicher Zusammenhänge und Strategien zur Lösung alltäglicher Rechtsprobleme.
- Grundlagen des deutschen Schuldrechts
- Vertragsabschluss und Willenserklärungen
- Stellvertretung und Haftung
- Verbraucherschutz und AGBs
- Leistungsstörungen und Schadensersatz
Zusammenfassung der Kapitel
Europäisches Recht und anglo-amerikanisches Recht: Dieser Abschnitt liefert eine kurze Einführung in die beiden großen Rechtssysteme des Okzidents, wobei die Unterschiede zwischen dem auf römischem Recht basierenden europäischen Recht und dem aus dem „case law“ hervorgegangenen anglo-amerikanischen Recht hervorgehoben werden. Die stetige Angleichung des deutschen Rechts an das römische Recht wird ebenfalls erwähnt.
Entstehung des Rechts: Hier wird die Notwendigkeit von Recht aufgrund menschlicher Konflikte erläutert. Es werden die zwei Arten der Konfliktlösung (mit und ohne Gewalt) sowie die Rolle der inneren Gerechtigkeitsempfindung im Rechtsfindungsprozess dargestellt. Die Aufgabe des Rechts, die gerechte Handlung in Konflikten zu identifizieren, wird betont.
Das deutsche Rechtssystem: Dieser Teil beschreibt die grundlegende Struktur des deutschen Rechtssystems, die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht und die Instanzenhierarchie der ordentlichen Gerichte. Die Zuständigkeiten von Amts- und Landesgerichten werden erläutert.
Suchstrategie bei Anspruchsgrundlagen im BGB: Der Abschnitt erläutert die systematische Struktur des BGB und gibt Hinweise zur effizienten Suche nach Anspruchsgrundlagen. Die verschiedenen Bücher des BGB (Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht) und ihre jeweiligen Schwerpunkte werden kurz vorgestellt.
Schuldrecht: Dieser Abschnitt beschreibt die Unterteilung des Schuldrechts in rechtsgeschäftliche und gesetzliche Schuldverhältnisse und erläutert die verschiedenen Arten gesetzlicher Schuldverhältnisse (Delikte, Geschäftsführung ohne Auftrag, Bereicherungsrecht).
Präjudiziensystem: Der Unterschied zwischen dem Präjudiziensystem im angloamerikanischen Raum und dem Verbot von Präjudizien im europäischen Recht wird erläutert. Die Rolle der Richter im deutschen Rechtssystem und die Bindung an Gesetze sowie die besondere Stellung des Bundesverfassungsgerichts werden diskutiert.
Vorgehensweise bei Betrachtung eines Falls: Dieser Abschnitt beschreibt eine systematische Vorgehensweise bei der rechtlichen Betrachtung eines Falls, von der Formulierung des Problems über die Suche nach der Anspruchsgrundlage bis hin zur Argumentation vor Gericht. Die Bedeutung der korrespondierenden Willenserklärungen wird hervorgehoben.
Jus cogenz und dispositives Recht: Der Unterschied zwischen zwingenden und abdingbaren Recht wird erläutert, und die Bedeutung dispositiver Normen zur Schaffung einer gerechten Grundordnung wird dargestellt. Die Grenzen des dispositiven Rechts (zwingendes Recht und gute Sitten) werden genannt.
Nicht Zuordbares aus der ersten Vorlesung: Dieser Abschnitt behandelt verschiedene Aspekte, darunter die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die Definition von Sachen im BGB, den Erwerb von Mobilien und Immobilien, sowie die grundlegende Idee des Nachtwächterstaates.
Nachtwächterstaat: Hier wird die Idee des Nachtwächterstaates und die Bedeutung der Privatautonomie (Vertragsfreiheit, Eigentumsfreiheit, Testierfreiheit) erläutert.
Steuerung des Marktverhaltens: Der Abschnitt beschreibt, wie der Staat durch Regulierung von Vertragsformen, Vertragsinhalten und Formvorschriften in das Marktgeschehen eingreift, um Ungleichgewichte auszugleichen und die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
Grenzen der Privatautonomie: Die Grenzen der Privatautonomie werden im Hinblick auf Verstöße gegen die guten Sitten (§ 138 BGB) und Gesetzesverstöße (§ 134 BGB) erläutert. Verschiedene Beispiele für sittenwidrige Verträge werden diskutiert (Knebelverträge, sittenwidrige Ratenkredite, Überschuldungsfallen).
Grundstruktur des bürgerlichen Rechts: Die Unterscheidung zwischen öffentlichem und Privatrecht und die Hierarchie der Rechtsnormen (Bundesrecht, BVerfG, EuGH) werden erläutert. Die Bedeutung von EU-Verordnungen und -Richtlinien für das deutsche Recht wird hervorgehoben.
Rechtssubjekte: Die verschiedenen Arten von Rechtssubjekten (natürliche Personen, juristische Personen, Mischformen) werden definiert.
Geschäftsfähigkeit: Die verschiedenen Stufen der Geschäftsfähigkeit (keine Geschäftsfähigkeit, beschränkte Geschäftsfähigkeit, volle Geschäftsfähigkeit) werden erläutert, sowie die Rechtsfolgen bei Verträgen mit Minderjährigen.
Willenserklärung als Grundstein aller Verträge: Dieser Abschnitt erklärt die Bedeutung von Wille und Erklärung bei der Abgabe von Willenserklärungen und erläutert den objektiven Empfängerhorizont anhand eines Beispiels (Trierer Weinauktion). Konkludente Willenserklärungen werden ebenfalls erwähnt.
Verträge mit Lücken: Die Problematik von Verträgen mit Lücken und die Methoden der Lückenfüllung (dispositives Recht, richterliche Vertragsergänzung, hypothetischer Parteiwille) werden besprochen.
Auslegung von Rechtsnormen: Die verschiedenen Methoden der Rechtsnormauslegung (Wortlautauslegung, systematische Auslegung, historische Auslegung, teleologische Auslegung) werden erläutert.
Objektiver Empfängerhorizont: Die Bedeutung des objektiven Empfängerhorizonts bei der Auslegung von Willenserklärungen wird betont.
Bedeutung der Privatautonomie: Die Bedeutung der Privatautonomie und der Vorrang expliziter Vereinbarungen vor dispositivem Recht wird erläutert.
Entstehung Handelsrecht: Die Entstehung des Handelsrechts aus der Lex Mercatoria im Mittelalter wird kurz dargestellt.
Invitatio ad offerendum: Der Unterschied zwischen einer Invitatio ad offerendum und einem bindenden Angebot wird erklärt, und die Bedeutung für den Vertragsabschluss wird hervorgehoben.
Zitieren von Gesetzestexten: Die korrekte Zitierweise von Gesetzestexten wird erläutert.
Juristische Vorgehensweise im Fall des Druckfehlers: Die juristische Vorgehensweise bei einem Fall mit einem Druckfehler auf einem Preisschild wird anhand der oben beschriebenen Schritte erläutert.
Willensmängel // Unbewusstes Auseinanderfallen von Wille und Erklärung: Dieser Abschnitt behandelt die Anfechtung von Willenserklärungen wegen Irrtums (§ 119 BGB) und die Rechtsfolgen, insbesondere die Rückwirkungsfiktion und den Vertrauensschaden.
Anfechtung wegen Irrtum: Die Anfechtung von Verträgen wegen Irrtums wird ausführlich besprochen, und die Grenzen der Anfechtung (Rechtsirrtum, Irrtum über den Wert) werden erläutert.
Arglistige Täuschung: Die Anfechtung von Verträgen wegen arglistiger Täuschung (§ 123 BGB) wird erläutert, und die Anfechtungsfristen werden genannt.
Willensmängel // Bewusstes Auseinanderfallen von Wille und Erklärung: Scherzerklärungen (§ 118 BGB) und Scheinerklärungen (§ 117 BGB) werden definiert und ihre Rechtsfolgen erläutert.
Wirksamkeit von Willenserklärungen: Die Unterscheidung zwischen empfangsbedürftigen und nicht-empfangsbedürftigen Willenserklärungen wird erläutert.
Probleme bei empfangsbedürftigen Willensbekundungen unter Abwesenden: Die Probleme des Zugangs von Willenserklärungen unter Abwesenden werden diskutiert, sowie die verschiedenen Zeitpunkte (Abgabe, Versand, Zugang, Kenntnisnahme). Die Bedeutung von § 130 BGB und die verschiedenen Arten der Zustellung (Einschreiben, Einwurfeinschreiben, Fax, E-Mail, Gerichtsvollzieher) werden erklärt.
Stellvertretung: Die verschiedenen Arten der Stellvertretung (Bote, Stellvertreter) und die Voraussetzungen für eine wirksame Stellvertretung werden erläutert. Das Offenkundigkeitsprinzip und seine Ausnahmen werden diskutiert.
Neue Vorgehensweise bei Betrachtung von Fällen: Eine neue Vorgehensweise bei der Betrachtung von Fällen mit Stellvertretung wird vorgestellt, die auf fünf Kriterien basiert (Zulässigkeit, eigene Willenserklärung, im fremden Namen, mit Vertretungsmacht, im Rahmen der Vertretungsmacht).
Zulässigkeit: Die Zulässigkeit der Stellvertretung wird erläutert, mit besonderem Fokus auf höchstpersönliche Geschäfte.
Eigene Willenserklärung: Die Unterscheidung zwischen Stellvertretung und Botenschaft wird erläutert.
Im fremden Namen: Das Offenkundigkeitsprinzip und seine Ausnahmen werden erläutert (offene und verdeckte Geschäfte).
Mit Vertretungsmacht: Die verschiedenen Arten der Vertretungsmacht (gesetzliche, rechtsgeschäftliche) und das Erlöschen der Vertretungsmacht werden erläutert.
Rechtsscheinvollmacht: Die verschiedenen Arten der Rechtsscheinvollmacht (Vertrauenstatbestand, Zurechnungstatbestand, Vollmachtsurkunde, Duldungsvollmacht, Anscheinsvollmacht) werden erläutert.
Vertreter handelt nicht im Rahmen der Vertretungsvollmacht: Die Rechtsfolgen, wenn ein Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt (falsus procurator), werden erläutert.
Ausnahmen im Handelsrecht: Die besonderen Regelungen im Handelsrecht für Prokuristen, Handlungsbevollmächtigte, Außenvertreter und Angestellte im Warenlager werden erläutert.
Haftung für Dritte: Die Haftung für Dritte wird auf Grundlage von Vertrag (§ 280 BGB) und Deliktsrecht (§ 831 BGB) erläutert.
Auf Grundlage eines Vertrags (gemäß § 280): Die Voraussetzungen für die Haftung auf Grundlage eines Vertrags werden erläutert (§ 280 BGB i.V.m. § 278 BGB).
Auf Grundlage des Deliktsrechts (gemäß § 831 I): Die Haftung für Verrichtungsgehilfen auf Grundlage des Deliktsrechts wird erläutert (§ 831 BGB).
Verbraucherschutz: Dieser Abschnitt behandelt den Verbraucherschutz im deutschen Recht.
Verbraucherschutz durch jus cogenz: Die Bedeutung des zwingenden Rechts für den Verbraucherschutz wird erläutert (z.B. Mängelgewährleistung nach § 475 BGB).
Schutzziel des deutschen Staates: Die Schutzziele des deutschen Staates im Verbraucherschutz (Vermeidung von Überrumpelungseffekten, Vermeidung von Informationsasymmetrie) werden genannt.
Schutz vor Überrumpelungseffekten durch Widerrufsrecht: Das Widerrufsrecht bei Verträgen außerhalb von Geschäftsräumen und Fernabsatzverträgen wird erläutert.
Rechtsfolge des Widerrufs: Die Rechtsfolgen des Widerrufs werden erläutert (§§ 355-357 BGB).
Verbraucherschutz durch Informationspflichten für die Unternehmer: Die Bedeutung von Informationspflichten für Unternehmer im Verbraucherschutz wird erläutert.
Lieferung unbestellter Waren: Die Rechtslage bei der Lieferung unbestellter Waren (§ 241a BGB) wird erläutert.
Allgemeine Geschäftsbedingungen: Die rechtlichen Vorschriften für Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) werden erläutert, sowie die Inhaltskontrolle und die Problemfelder bei AGBs.
Rechtliche Vorschriften: Die wichtigsten rechtlichen Vorschriften für AGBs werden genannt (§§ 305-310 BGB).
Drei Problemfelder bei AGBs: Die drei Hauptproblemfelder bei AGBs (Einbeziehung, kollidierende AGBs, Verbot der geltungserhaltenden Reduktion) werden besprochen.
Leistungsstörungen: Die verschiedenen Arten von Leistungsstörungen (Unmöglichkeit, Verzug, Schlechtleistung) und die Ansprüche des Gläubigers werden erläutert.
Drei Arten von Schadensersatz: Die drei Arten von Schadensersatz (neben der Leistung, statt der Leistung, statt der ganzen Leistung) werden erläutert.
Diverse Anspruchsgrundlagen: Die Anspruchsgrundlagen für Unmöglichkeit, Schlechtleistung und Verzug werden erläutert.
Vorschriften über den Verzug: Die Vorschriften über den Schuldnerverzug und die Ansprüche des Gläubigers werden erläutert (§§ 280, 286 BGB).
Unterschied Mahnung und Nachfrist: Der Unterschied zwischen Mahnung und Nachfrist wird erläutert.
Schadensersatz statt der gesamten Leistung: Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Schadensersatz statt der gesamten Leistung werden erläutert.
Rücktritt vom Vertrag: Die Voraussetzungen für den Rücktritt vom Vertrag werden erläutert (§ 323 BGB).
Schlechtleistung: Die Ansprüche des Käufers bei Schlechtleistung im Kaufrecht werden erläutert.
Ansprüche bei Schlechtleistung im Kaufrecht: Die Ansprüche des Käufers bei Schlechtleistung im Kaufrecht werden erläutert (§§ 437, 439 BGB).
Unterschied Garantie und Mängelgewährleistung: Der Unterschied zwischen Garantie und Mängelgewährleistung wird erläutert.
Gefahrenübergang nach § 446: Der Gefahrenübergang nach § 446 BGB wird erläutert.
Ansprüche aus § 437: Die verschiedenen Ansprüche aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz) werden erläutert.
Mangelfolgeschaden: Mangelfolgeschäden und deren rechtliche Behandlung werden besprochen.
Beweisführung im deutschen Recht: Die Grundsätze der Beweisführung im deutschen Recht (SAPUZ) werden erläutert.
Trennung von Eigentums- und Vermögensschäden: Die Unterscheidung zwischen Eigentums- und Vermögensschäden und ihre Bedeutung für den Schadensersatzanspruch werden erläutert.
Vertragliche Ansprüche sind für Gläubiger lukrativer: Die Vorteile vertraglichen Ansprüchen gegenüber außervertraglichen Ansprüchen werden erläutert.
Sachmängelgewährleistung (Verbraucherschutz durch jus cogenz): Die Sachmängelgewährleistung im Verbraucherschutz wird erläutert (§ 475 BGB).
Weiterfressender Mangel: Der weiterfressende Mangel wird als Rechtsprechungsergebnis erläutert.
Produkthaftungsgesetz: Das Produkthaftungsgesetz und seine Bedeutung für den Verbraucherschutz werden erklärt.
Eigentumsstörungen: Eigentumsstörungen und deren rechtliche Behandlung werden besprochen.
Kreditsicherung über Pfandrecht: Die Kreditsicherung durch Eigentumsvorbehalt wird erläutert.
Wissensfragen Schuldrecht & Antworten: Dieser Abschnitt enthält Wissensfragen zum Schuldrecht und deren Antworten.
Übersicht Vorgehensweise bestimmter Fallgruppen, Vorgehensweise Stellvertretung, Vorgehensweise Verzug - Schadensersatz, Vorgehensweise Schlechtleistung, Vorgehensweise Widerruf, Vorgehensweise Irrtum, Vorgehensweise beschränkte Geschäftsfähigkeit, Vorgehensweise Schadensersatz Eigentumsvorbehalt: Diese Abschnitte enthalten schematische Darstellungen der Vorgehensweise bei der Lösung verschiedener Fallgruppen im Schuldrecht.
Schlüsselwörter
Deutsches Schuldrecht, BGB, Anspruchsgrundlagen, Willenserklärung, Stellvertretung, Verbraucherschutz, AGBs, Leistungsstörungen, Schadensersatz, Irrtum, Geschäftsfähigkeit, Eigentumsvorbehalt, Produkthaftung, Mängelgewährleistung, Verzug, Schlechtleistung, Privatautonomie, Jus cogens, Dispositives Recht, Objektiver Empfängerhorizont, Rechtsscheinvollmacht, Offenkundigkeitsprinzip, Case Law.
Häufig gestellte Fragen zum Überblick über das deutsche Schuldrecht
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über ausgewählte Bereiche des deutschen Schuldrechts aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Er dient als Einführung in das deutsche Rechtssystem und soll dem Leser helfen, alltägliche Rechtsprobleme zu verstehen und zu lösen. Der Fokus liegt auf der verständlichen Erklärung rechtlicher Zusammenhänge und Strategien.
Welche Themen werden behandelt?
Der Text behandelt grundlegende Themen des Schuldrechts, darunter:
- Grundlagen des deutschen Schuldrechts und Vergleich zum anglo-amerikanischen Recht
- Vertragsabschluss und Willenserklärungen (inkl. Willensmängel wie Irrtum und Täuschung)
- Stellvertretung und die damit verbundene Haftung
- Verbraucherschutz und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Leistungsstörungen (Unmöglichkeit, Verzug, Schlechtleistung) und Schadensersatz
- Geschäftsfähigkeit und beschränkte Geschäftsfähigkeit
- Auslegung von Rechtsnormen und der objektive Empfängerhorizont
- Jus cogens und dispositives Recht
- Bedeutung der Privatautonomie und deren Grenzen
- Eigentumsstörungen und Kreditsicherung
- Produkthaftungsgesetz
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, Schlüsselwörter und strukturierte Vorgehensweisen zur Lösung bestimmter Fallgruppen (z.B. Stellvertretung, Verzug, Schlechtleistung, Widerruf, Irrtum).
Welche Rechtsgebiete werden im Detail behandelt?
Der Text behandelt detailliert das Schuldrecht des BGB, einschließlich des Vertragsrechts, der Stellvertretung, des Verbraucherschutzes, der AGBs, der Leistungsstörungen und des Schadensersatzes. Zusätzlich werden Grundlagen des deutschen Rechtssystems, des europäischen Rechts und des anglo-amerikanischen Rechts angesprochen.
Welche praktischen Anwendungsmöglichkeiten bietet der Text?
Der Text soll dem Leser helfen, alltägliche Rechtsprobleme zu verstehen und zu lösen. Durch die verständliche Erklärung rechtlicher Zusammenhänge und die strukturierten Vorgehensweisen zu verschiedenen Fallgruppen kann der Leser sein Wissen über das deutsche Schuldrecht verbessern und in der Praxis anwenden.
Welche Methodik wird zur Lösung von Fallbeispielen angewendet?
Der Text präsentiert eine systematische Vorgehensweise zur Lösung von Rechtsfällen, die Schritt für Schritt erklärt wird. Diese Methodik umfasst die Identifizierung des Problems, die Suche nach relevanten Anspruchsgrundlagen im BGB und die logische Argumentation.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text ist sowohl für Studenten als auch für alle anderen Personen geeignet, die sich einen ersten Überblick über das deutsche Schuldrecht verschaffen möchten. Vorkenntnisse im Recht sind nicht zwingend erforderlich.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe umfassen: Deutsches Schuldrecht, BGB, Anspruchsgrundlagen, Willenserklärung, Stellvertretung, Verbraucherschutz, AGBs, Leistungsstörungen, Schadensersatz, Irrtum, Geschäftsfähigkeit, Eigentumsvorbehalt, Produkthaftung, Mängelgewährleistung, Verzug, Schlechtleistung, Privatautonomie, Jus cogens, Dispositives Recht, Objektiver Empfängerhorizont, Rechtsscheinvollmacht, Offenkundigkeitsprinzip, Case Law.
- Arbeit zitieren
- Mike G. (Autor:in), 2016, Einführung in das Schuldrecht. Ausführung und juristische Lösung praxisrelevanter Probleme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351331