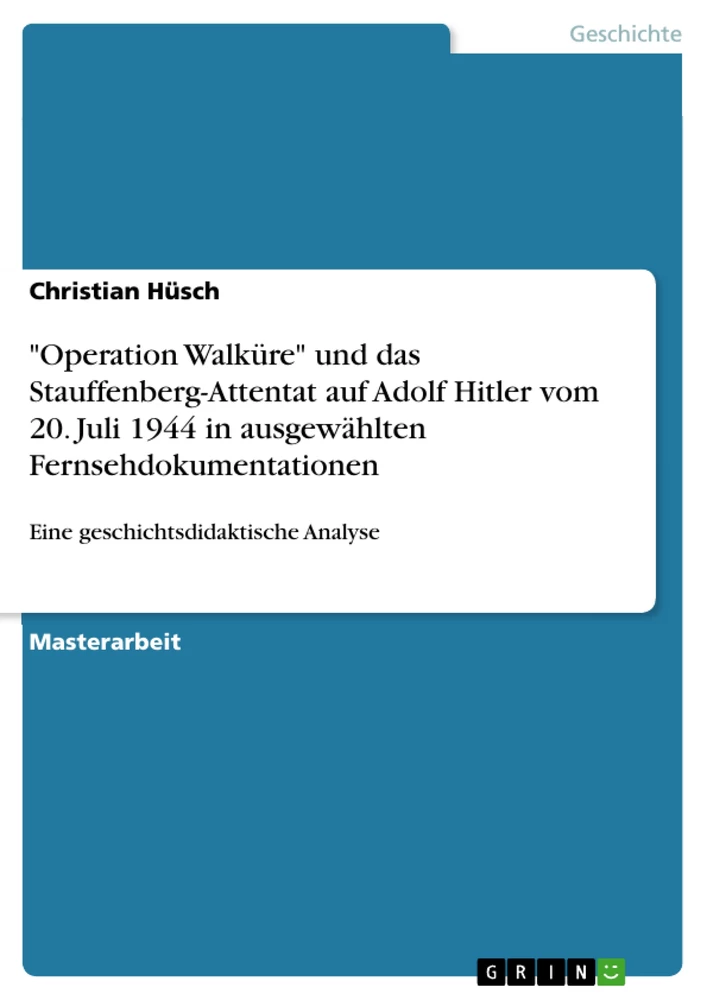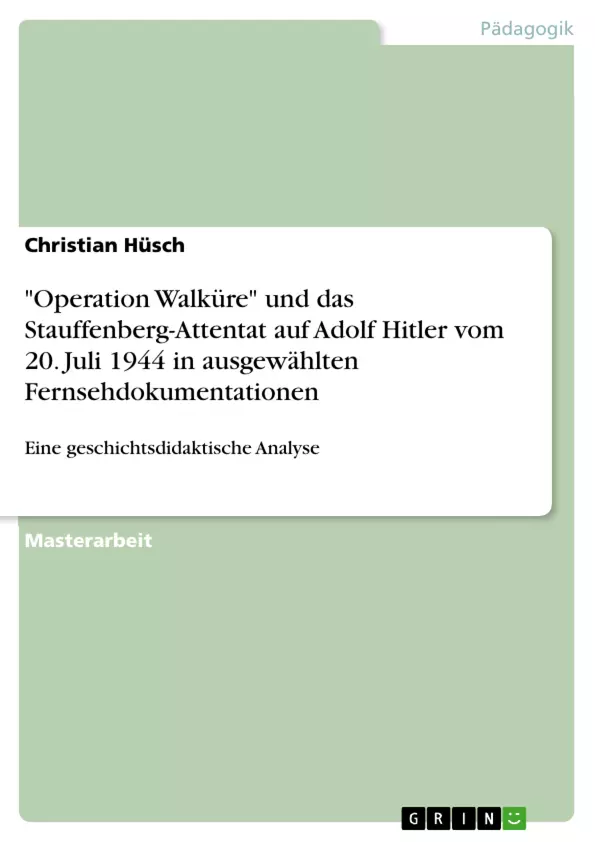Das Stauffenberg-Attentat auf Adolf Hitler und der daran anknüpfende Staatsstreichversuch vom 20. Juli 1944 sind auch heute noch fester Bestandteil der bundesdeutschen Erinnerungskultur. Als Ausdruck dieser Erinnerungskultur untersucht der Autor unter Einbeziehung des fernsehgeschichtlichen Hintergrundes Dokumentationen zum Thema. Welches Geschichtsbild offenbart sich in den jeweiligen Fernsehdokumentationen? Welche geschichtspolitischen Absichten und Gegenwartsinteressen spiegeln sich in den Produkten wider? Inwiefern sind die Produkte Ausdruck gegenwärtiger erinnerungskultureller Trends?
Zu Beginn der Arbeit steht ein methodisch-theoretischer Teil. Hier soll vor allem das der Arbeit zu Grunde liegende Konzept des „Geschichtsbildes“ in Abgrenzung zum „Geschichtsbewusstsein“ genauer erläutert werden. Auch die methodische Vorgehensweise wird im Anschluss dargelegt. Dem Teil der konkreten Analyse der Geschichtsbilder beider Dokumentationen ist zunächst der „historische Hintergrund“ vorangestellt. Hier soll zum einen die geschichtliche Entwicklung der Militäropposition bis zum 20. Juli 1944 nachverfolgt werden. Zum anderen besteht dieser Teil der Arbeit aus systematischen Kapiteln. Hier stehen die Motive der Verschwörer ebenso im Blick, wie die außen- und innenpolitischen Zukunftsvorstellungen, Normen und Werthaltungen der Widerständler.
Das Herzstück der Arbeit bildet Kapitel 4. Hier sollen beide Dokumentationen nacheinander im Hinblick auf das zu Grunde liegende Geschichtsbild analysiert werden. Dabei macht „Die Stunde der Offiziere“ den Anfang. Als gemeinsame Untersuchungskategorien beider Filme werden der narrative Aufbau, die Ziele und Motive der Verschwörer, die Person Stauffenbergs sowie die Hinrichtung und Opferdarstellung untersucht. In „Die Stunde der Offiziere“ erscheint die Personenkonstellation für die Deutung der Verschwörer wichtig. Im Gegensatz dazu kommen in „Operation Walküre“ noch sehr viele regimetreue Zeitzeugen zu Wort. Die sich aus der Analyse ergebenden unterschiedlichen Geschichtsbilder sollen im Anschluss interpretiert werden. Dabei soll vor allem deren Zeitgebundenheit herausgearbeitet werden.
Im Fazit werden die Ergebnisse schließlich zusammenfassend dargestellt, wobei herausgehoben werden soll, wie die Verschwörer zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Absichten dargestellt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Fundierung und methodische Vorgehensweise
- 2.1 Theoretische Fundierung und Präzisierung des Forschungsgegenstands
- 2.2 Methodische Vorgehensweise
- 3. Historischer Hintergrund
- 3.1 Der „national-konservative“ Widerstand bis zum 20. Juli 1944
- 3.1.1 Beck, Oster, Goerdeler und der Widerstand vor dem Zweiten Weltkrieg
- 3.1.2 Henning von Tresckow und das Widerstandszentrum in der Heeresgruppe Mitte
- 3.1.3 Der Beginn der Aktivitäten und erste Attentatsversuche
- 3.1.4 Die Heranziehung der „Walküre“-Alarmbefehle für die Umsturzplanungen
- 3.1.5 Innenpolitische Staatsstreichvorbereitungen und Zukunftsvorstellungen des Widerstandes
- 3.1.6 Außenpolitische Handlungsspielräume und Motive des Widerstands
- 3.1.7 Stauffenberg und der Weg bis zum 20. Juli 1944
- 3.2 Der 20. Juli 1944 – Attentat und Staatsstreich
- 3.2.1 Das Attentat in der Wolfsschanze
- 3.2.2 Das Auslösen von „Walküre“ in der Bendlerstraße
- 3.2.3 Die Umsetzung der Walküre-Befehle in Berlin und den Wehrkreisen
- 3.2.4 Der Zusammenbruch des Staatsstreichs in Berlin und der Bendlerstraße
- 3.1 Der „national-konservative“ Widerstand bis zum 20. Juli 1944
- 4. Analyse der Geschichtsbilder in Die Stunde der Offiziere und Operation Walküre
- 4.1 Die Stunde der Offiziere – Analyse des Geschichtsbildes
- 4.1.1 Einführende Informationen zu Die Stunde der Offiziere
- 4.1.2 Narrativer Aufbau
- 4.1.3 Die Motivlage der Verschwörer
- 4.1.4 Die Thematisierung der Verstrickung der Verschwörer in den Vernichtungskrieg
- 4.1.5 Stauffenberg als identifikatorischer Protagonist
- 4.1.6 Die Verschwörer und der 20. Juli 1944
- 4.1.7 Die Hinrichtung: Emotionaler Höhepunkt und Konstruktion eines Opferbildes
- 4.1.8 Interpretation und Bewertung des Geschichtsbildes – Zeitgebundenheit und Darstellungsabsicht
- 4.2 Operation Walküre – Analyse des Geschichtsbildes
- 4.2.1 Einführende Informationen zu Operation Walküre
- 4.2.2 Narrativer Aufbau und Offenlegung des Konstruktionscharakters als Mittel der Distanzerzeugung
- 4.2.3 Die Motivlage der Verschwörer
- 4.2.4 Die Ziele der Verschwörer - Westanlehnung, Rechtsstaatlichkeit und Antibolschewismus
- 4.2.5 Die Darstellung der Verschwörer durch Fremdzuschreibungen prekärer Zeitzeugen
- 4.2.6 Stauffenberg als politischer Visionär
- 4.2.7 Die Verschwörer als Opfer in Operation Walküre
- 4.2.8 Interpretation und Bewertung des Geschichtsbildes - Zeitgebundenheit und Darstellungsabsicht
- 4.1 Die Stunde der Offiziere – Analyse des Geschichtsbildes
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit analysiert die Darstellung des 20. Juli 1944 und der beteiligten Verschwörer in zwei ausgewählten Fernsehdokumentationen: „Operation Walküre“ und „Die Stunde der Offiziere“. Ziel ist es, die jeweiligen Geschichtsbilder zu untersuchen und deren Entstehungsbedingungen im Kontext der jeweiligen Entstehungszeit zu beleuchten. Die Arbeit fragt nach der Konstruktion von Narrativen, der Zuschreibung von Motiven und Charaktereigenschaften an die Verschwörer, und der kritischen Auseinandersetzung oder Heroisierung der Akteure.
- Konstruktion von Geschichtsbildern in Fernsehdokumentationen
- Analyse der Motivlage der Verschwörer
- Vergleich der Darstellungen in „Operation Walküre“ und „Die Stunde der Offiziere“
- Einfluss von Zeitgeist und Darstellungsabsicht auf die Geschichtsbilder
- Rezeption des 20. Juli in der deutschen Erinnerungskultur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die unterschiedlichen Rezeptionen des 20. Juli 1944 in der deutschen Geschichte, von der anfänglichen Stigmatisierung als Vaterlandsverrat bis zur späteren Heroisierung der Verschwörer. Sie betont die Widersprüchlichkeit dieser Deutungen und begründet die Auswahl von zwei Fernsehdokumentationen („Operation Walküre“ und „Die Stunde der Offiziere“) als Fallbeispiele für eine geschichtsdidaktische Analyse der Erinnerungskultur zum Attentat.
2. Theoretische Fundierung und methodische Vorgehensweise: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, präzisiert den Forschungsgegenstand und beschreibt die methodische Vorgehensweise bei der Analyse der beiden Dokumentationen. Es definiert den Begriff des Geschichtsbildes und skizziert die methodischen Schritte der Analyse.
3. Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den historischen Kontext des 20. Juli 1944. Es beschreibt den „national-konservativen“ Widerstand, die beteiligten Personen, ihre Motive, die Planung des Attentats, und den gescheiterten Staatsstreichversuch. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Strömungen und Zielen innerhalb des Widerstands und den komplexen politischen und militärischen Gegebenheiten.
4. Analyse der Geschichtsbilder in Die Stunde der Offiziere und Operation Walküre: Dieser zentrale Teil der Arbeit analysiert die Geschichtsbilder der beiden Fernsehdokumentationen. Für jede Dokumentation werden der narrative Aufbau, die Darstellung der Motive der Verschwörer, die Charakterisierung von Stauffenberg und die allgemeine Bewertung des Widerstands im Film untersucht. Die Analyse betrachtet auch die jeweiligen zeitgeschichtlichen und medialen Kontexte.
Schlüsselwörter
20. Juli 1944, Stauffenberg-Attentat, Operation Walküre, Die Stunde der Offiziere, Geschichtsbild, Fernsehdokumentation, Widerstand, Nationalsozialismus, Erinnerungskultur, Geschichtsdidaktik, Motivlage, Heroisierung, Zeitzeugen, Darstellung.
Häufig gestellte Fragen zu "Analyse der Geschichtsbilder in zwei Fernsehdokumentationen zum 20. Juli 1944"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Masterarbeit analysiert die Darstellung des 20. Juli 1944 und der beteiligten Verschwörer in den Fernsehdokumentationen „Operation Walküre“ und „Die Stunde der Offiziere“. Sie untersucht die jeweiligen Geschichtsbilder und deren Entstehungsbedingungen im Kontext ihrer Entstehungszeit.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Konstruktion von Narrativen, der Zuschreibung von Motiven und Charaktereigenschaften an die Verschwörer und der kritischen Auseinandersetzung oder Heroisierung der Akteure. Sie untersucht den Einfluss von Zeitgeist und Darstellungsabsicht auf die Geschichtsbilder und die Rezeption des 20. Juli in der deutschen Erinnerungskultur.
Welche Dokumentationen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Geschichtsbilder der beiden Fernsehdokumentationen „Operation Walküre“ und „Die Stunde der Offiziere“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Fundierung und methodische Vorgehensweise, Historischer Hintergrund, Analyse der Geschichtsbilder in den beiden Dokumentationen und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel ausführlich beschrieben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Konstruktion von Geschichtsbildern in Fernsehdokumentationen, Analyse der Motivlage der Verschwörer, Vergleich der Darstellungen in „Operation Walküre“ und „Die Stunde der Offiziere“, Einfluss von Zeitgeist und Darstellungsabsicht auf die Geschichtsbilder und Rezeption des 20. Juli in der deutschen Erinnerungskultur.
Welchen historischen Hintergrund beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Hintergrund des 20. Juli 1944 umfassend. Sie beschreibt den „national-konservativen“ Widerstand, die beteiligten Personen, ihre Motive, die Planung des Attentats und den gescheiterten Staatsstreichversuch. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Strömungen und Zielen innerhalb des Widerstands und den komplexen politischen und militärischen Gegebenheiten.
Wie wird die Analyse der Geschichtsbilder durchgeführt?
Die Analyse der Geschichtsbilder untersucht für jede Dokumentation den narrativen Aufbau, die Darstellung der Motive der Verschwörer, die Charakterisierung von Stauffenberg und die allgemeine Bewertung des Widerstands im Film. Die Analyse betrachtet auch die jeweiligen zeitgeschichtlichen und medialen Kontexte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: 20. Juli 1944, Stauffenberg-Attentat, Operation Walküre, Die Stunde der Offiziere, Geschichtsbild, Fernsehdokumentation, Widerstand, Nationalsozialismus, Erinnerungskultur, Geschichtsdidaktik, Motivlage, Heroisierung, Zeitzeugen, Darstellung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die jeweiligen Geschichtsbilder in den ausgewählten Fernsehdokumentationen zu untersuchen und deren Entstehungsbedingungen im Kontext der jeweiligen Entstehungszeit zu beleuchten.
- Quote paper
- Christian Hüsch (Author), 2016, "Operation Walküre" und das Stauffenberg-Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 in ausgewählten Fernsehdokumentationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351393