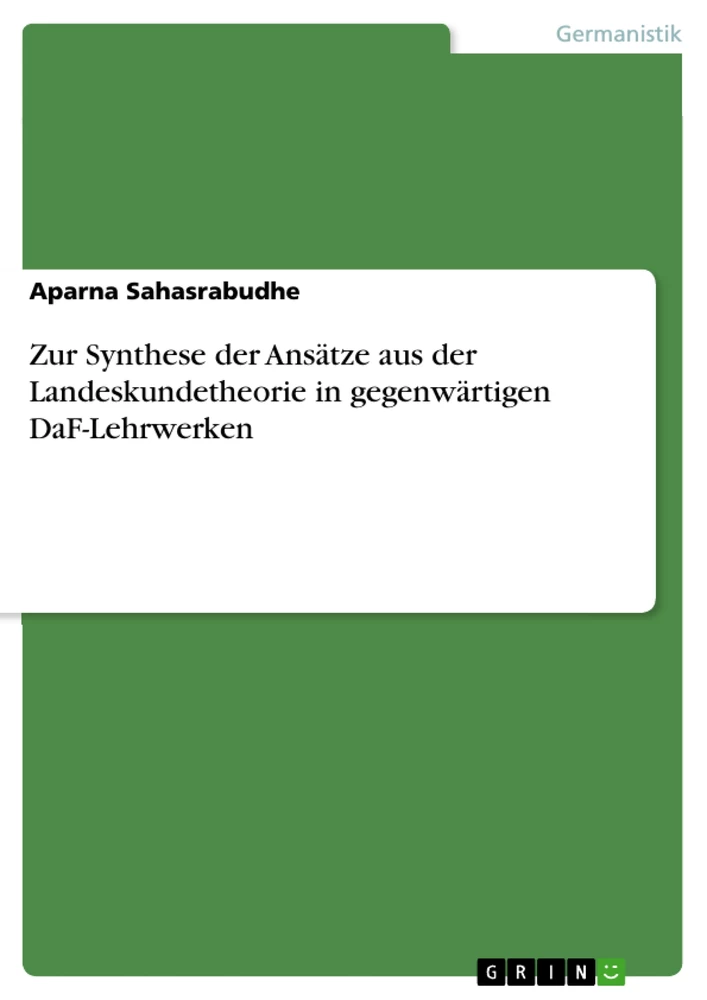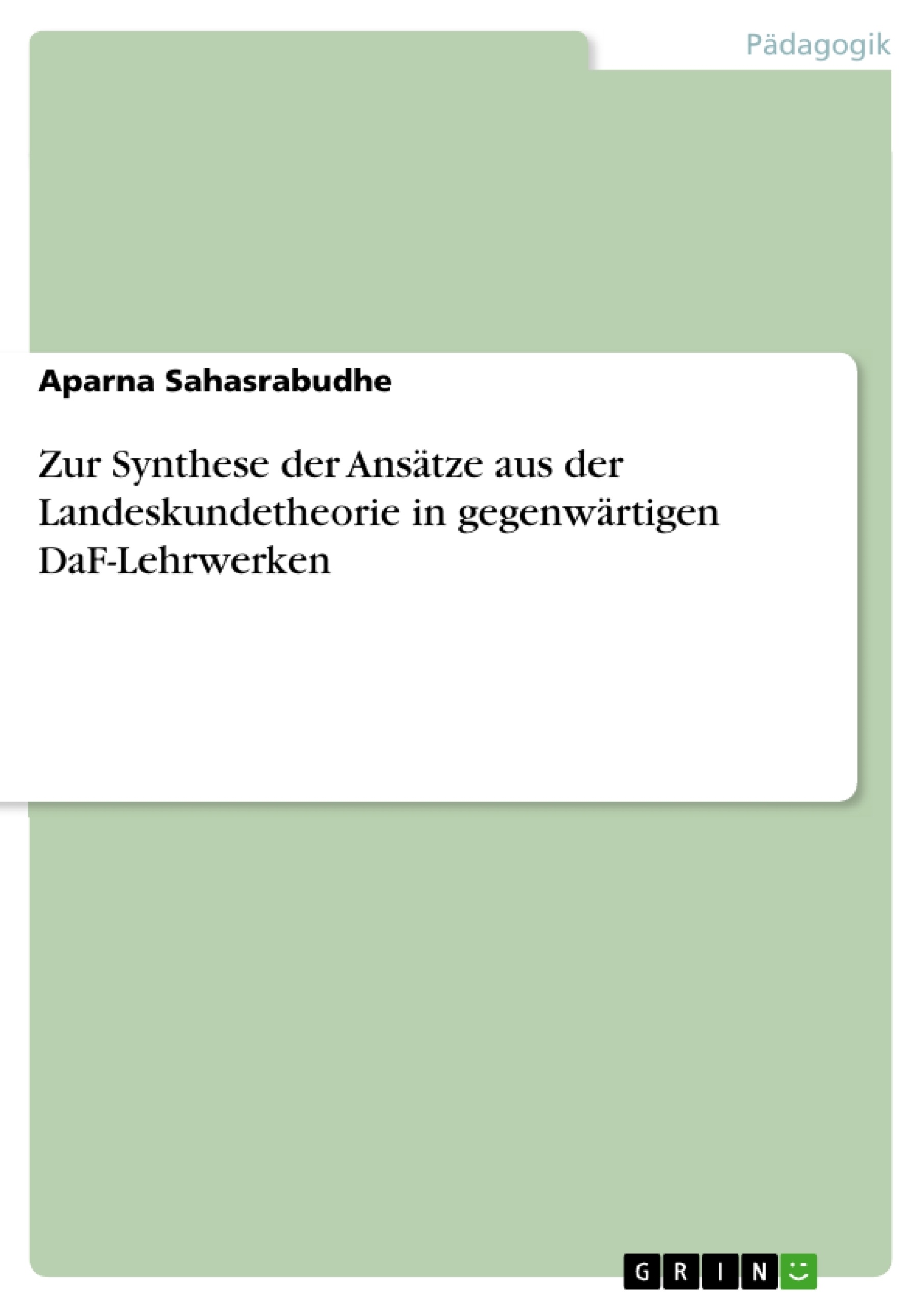Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Landeskunde im DaF-Fremdsprachenunterricht. Es gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte der Landeskunde und es wird über die Rolle der Landeskunde diskutiert. Unterschiedliche Ansätze in der Theorie der Landeskunde werden hier dargestellt. Anhand einiger Beispiele aus zwei DaF-Lehrwerken wird in diesem Beitrag gezeigt, wie unterschiedliche Ansätze der Landeskunde nebeneinander in diesen Lehrwerken vorkommen.
Zur Synthese der Ansätze aus der Landeskundetheorie in den gegenwärtigen DaF- Lehrwerken:
Aparna Sahasrabudhe
„Ein Unfach“ (Picht und S.J. Schmidt, 1980), „ ein umögliches Fach aus Deutschland“ (Gürttler / Steinfeld, 1990), „eine unendliche Geschichte“ (Paudrach, 1992) - all diese Bezeichnungen weisen auf ein einziges Fach, nämlich die Landeskunde hin.[1] Bereits von diesen Benennungen ist zu entnehmen, dass es schwer ist, den Begriff ,Landeskunde‘ zu definieren.
Bei diesem Beitrag geht es um die Landeskunde im Anfängerunterricht.
Landeskunde - Begriffsbestimmung:
Unter dem Begriff ,Landeskunde‘ versteht man
„...alle Bezüge auf die Gesellschaft(en), deren Sprache im Fremdsprachenunterricht gelernt wird.“[2]
Landeskunde ist ein umfangreicher Begriff und bezieht sich auf verschiedene Disziplinen.
„Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport, Geographie, aktuelle Politik, Geschichte, die Art und Weise wie Personen in deutschsprachigen Ländern miteinander kommunizieren, die sogenannten typischen Eigenschaften von Vertretern des deutschsprachigen Raums usw- all dies gehört zur - Landeskunde des deutschsprachigen Raums.“[3]
Darüber hinaus wird die Landeskunde im Fremdsprachenunterricht als ein Medium der Kulturvermittlung betrachtet. Das Spektrum der Kulturvermittlung umfasst die Alltagskultur, das kollektive kulturelle Gedächtnis und die individuelle kulturelle Prägung.[4] Diese inhaltliche Grenzenlosigkeit bereitet Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung der Landeskunde. Delmas / Vorderwülbecke definieren die Landeskunde als-
„ ... ein wissenschaftlich begründetes Herangehen an sorgfältig auszuwählende Informationen verschiedener relevanter Disziplinen, aus deren systematischer Zuordnung sich ein beziehungsreiches, zusammenhängendes System der Beschreibung , deutscher ‘ Wirklichkeit von jetzt und heute ablesen läßt.“[5]
Im Anfänger-Unterricht geht es eher um die Alltagskultur.
Geschichte der Landeskunde:
In der Geschichte hat die Landeskunde unterschiedlche Bennennungen wie z.B. ,Realienkunde‘, ,Kulturkunde‘, ,Deutschlandstudien‘ und ,Deutschlandkunde.‘[6] Seit 1949 wurde zwischen der BRD-Kulturkunde und der DDR-Landeskunde unterschieden.[7] Die eigentliche Aufwertung der Landeskunde in der BRD gab es in den 60er und 70 er Jahren durch die Bildungsreformen, die Studentenbewegung und mit der Neuorientierung der auswärtigen Kulturpolitik.[8] Die DDR-Landeskunde war durch die sozialistische Perspektive geprägt.[9] Das Interesse an der Landeskunde ist in den 90er Jahren durch den Fall der Berliner Mauer und durch die veränderten politischen und gesellschaftlichen Bedingungen gestiegen.[10] Im gegenwärtigen Landeskundeunterricht gibt es Integration aller deutschsprachigen Länder.
Landeskunde im Fremdsprachnunterricht:
Landeskunde ist ein integraler Teil des Fremdsprachenunterrichts. Zur Sprachvermittlung gehören neben der Vermittlung der Sprachzeichen, der Erarbeitung von Wortschatz und der Grammatikvermittlung sowie die Vermittlung der kulturspezifischen Hintergründe.[11]
„Da Sprache nicht ohne Inhalte gelernt werden kann, ist jeder Fremdsprachenunterricht von Anfang an zugleich Kultur- und Landeskunde. Das ist untrittig.“[12]
Im Sprachunterricht dient die Landeskunde als ein Rahmen der Spracherlernung und hilft bei der Erweiterung und Erarbeitung des Wortschatzes, beim Grammatikerwerb und bei der Förderung der Sprachfertigkeiten.
Die Landeskunde erfüllt im DaF-Unterricht vielfältige Funktionen:
- Landeskunde ist die Informationsquelle und vermittelt die Information über die deutschsprachigen Länder.
- Landeskunde zielt auf die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz ab.
- Landeskunde bietet die Möglichkeit des Vergleichs zwischen der eigenen und der fremden Kultur. Dies führt zum besseren Verständins der eigenen Kultur.
- Landeskunde trägt auch zum Abbau der Stereotype und Vorurteile bei.
- Landeskunde fördert Toleranz und trägt zur Völkerveständigung bei.
Ansätze in der Theorie der Landeskunde:
In der Fachtheorie findet man verschiedene Ansätze der Landeskundevermittlung.
Bis zu den 80 er Jahren des 20. Jahrhunderts findet man drei dominiernde Ansätze der Landeskundevermittlung. Die drei Ansätze, nämlich der kognitive, der kommunikative und der interkulturelle Ansatz, sind chronologisch und systematisch geordnet.[13] Seit den 90er Jahren findet man weitere Ansätze nämlich die integrative Landeskunde, die erlebte und erlebbare Landeskunde und der kulturwissenschaftliche Ansatz.
Der kognitive Ansatz: (50er / 60er Jahre)
Beim kognitiven Ansatz liegt der Schwerpunkt auf der Faktenvermittlung. Erdmenger / Istel definieren die kognitive Landeskunde wie folgt:
„Die kognitive Landeskunde umfasst Kenntnisse aller Gebiete der Zielkultur, mit denen der Lernende in seinen zukünftigen Rollen wahrscheinlich in Berührung kommt. ... Der kognitive Bereich erstreckt sich somit vom Wissen über die Gegebenheiten des alltäglichen Lebens im jeweiligen Land bis hin zu einer Kenntnis vielschichtiger Erscheinungen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft.“ [14]
Zu den Themenbereichen der kognitiven Landeskunde gehören die Themen der sogenannten „hohen“ Kultur.[15] Das Lernziel dieses Ansatzes ist nicht sprachbezogen sondern eher die Förderung der landeskundlichen Kenntnisse.[16]
Die Landeskunde wird bei diesem Ansatz in Form von additiven Texten vermittelt. Zu den Präsentationsformen gehören u.a. Sachtexte, Grafiken, Schaubilder und Statistiken. Die Vermittlung der landeskundlichen Information ist sachlich und kann daher trocken sein.
Der kommunikative Ansatz: (70er Jahre)
Die Landeskunde bei dem kommunikativen Ansatz ist immanent und in den Sprachunterricht integriert.
Pauldrach beschreibt die Landeskunde im kommunikativen Ansatz wie folgt:
„Die Landeskunde im kommunikativen Fremdsprachenunterricht ist sowohl informations- als auch handlungsbezogen konzipiert und soll in beiden Fällen vor allem das Gelingen sprachlicher Handlungen im Alltag und das Verstehen alltagskultureller Phänomene unterstützen.“[17]
Laut diesem Ansatz wird also das landeskundliche Wissen als eine Voraussetzung für die Kommunikation betrachtet. Die kommunikative Kompetenz und Handlungsfähigkeit in der Zielsprache und Zielkultur gelten als die Hauptziele von diesem Ansatz.[18] Bei diesem Ansatz liegt der Schwerpunkt darauf, wie man sich im Zielsprachenland verständigen und zurechtfinden kann.[19]
Zu den Themen gehören Alltagsthemen wie z.B. Wohnen, Arbeiten, Essen und Trinken u.ä. Die Verwendung der authentischen und dialogischen Texte in alltäglichen Situationen ist ein Merkmal von diesem Ansatz.
Der interkulturelle Ansatz: (80er Jahre)
Die Landeskunde funktioniert nach diesem Ansatz als ein Medium für die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im Umgang mit der fremden Kultur. In den , ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht‘ sind die Ziele der interkulturellen Landeskunde wie folgt formuliert:
„Primäre Aufgabe der Landeskunde ist nicht die Information, sondern Sensibilisierung sowie die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im Umgang mit fremden Kulturen. Damit sollen fremdkulturelle Erscheinungen besser eingeschätzt, relativiert und in Bezug zur eigenen Realität gestellt werden. So können Vorurteile und Klischees sichtbar und abgebaut sowie eine kritische Toleranz entwickelt werden.”[20]
Der interkulturelle Vergleich gilt als die Methode, die zum besseren Verständnis der fremden aber auch der eigenen Kultur führen soll. Die Darbietungsformen bei diesem Ansatz sind authentische Texte, Filme, Lesetexte, Werbung, Gebrauchtexte und literarische Texte.[21]
Integrative Landeskunde: (90er Jahre)
Bei der integrativen Landeskunde ist eine dreifache Integration zu finden: erstens die Integration der Landeskunde in den Sprachunterricht, zweitens die Intergration der Informationen unterschiedlicher Bezugswissenschaften in den Sprachunterricht wie z.B. Politik, Geschichte, Geographie u.ä.[22] und drittens die Integration der eigenkulturellen Erfahrungen und Einstellungen der Lerner.[23] Bei diesem Ansatz findet man auch die Integration aller deutschsprachigen Ländern. Simon-Pelanda meint:
„Integartive Modelle bestimmen Landeskunde als Teil des Sprachprozesses als diejenigen soziokulturellen Bedingungen, unter denen die Lernenden der fremden Sprache und Kultur begegnen [...], diese Begenungen sind vor dem Hintergrund eigener Kultur- und Spracherfahrungen zu interpretieren und jeweils spezifisch zu erkunden.“[24]
Dieser Ansatz umfasst die Lernziele der früheren Ansätze d.h. des kognitiven, kommunikativen und interkulturellen Ansatzes. Die integrative Landeskunde geht davon aus, dass das Erreichen der Ziele des kommunikativen und kulturellen Lernens nur mit Hilfe von Sachkenntnissen möglich ist.[25] Das Tübinger Modell und das D-A-CH Konzept gelten als Beispiele von diesem Ansatz.
Die erlebte und erlebbare Landeskunde: (90er Jahre)
Die erlebte Landeskunde geht davon aus, dass die Landeskunde ,vor Ort‘ im Zielsprachenland erfahren wird.[26]
„Die Teilnehmer erkunden in authentischen Situationen Orte, Begriffe und Themen und werten die gewonnenen Erkenntnisse aus. Sie handeln also als Forschende, die in der anderen Kultur eigene Erfahrungen machen, diese zu ihrem jeweiligen Vorwissen und ihrer Vorerfahrung in Beziehung setzen, das selbst erarbeitete neue Wissen reflektieren und davon ausgehend die Konzequenzen für die eigene Unterrichtstätigkeit diskutieren.“[27]
Das Verfahren „Learning by doing“, die aktive Teilnahme der Lernenden, Eigentätigkeit, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Prozesshaftigkeit, Handlungsorientierung, Lernerautonomie, Projektunterricht gehören zu den Merkmalen dieses Ansatzes.[28] Die Lerner stehen bei diesem Ansatz im Zentrum. Es handelt sich um das Training und die Motivation der Lerner, selbständig weiter zu lernen. [29]
Wenn aber die Landeskunde im Heimatland der Lerner mittels der kulturellen Institutionen, authentischen Materialien wie z.B. Zeitschriften, Zeitungen, Internet u.ä. erlebt wird, spricht man von der ,erlebbaren Landeskunde‘. Hackl meint,
„Erlebbare Landeskunde nennen wir zur besseren Unterscheidung das Herstellen von Situationen, in denen ähnliche methodische Schritte wie in der Erlebten Landeskunde möglich sein sollen - jedoch außerhalb des Zielsprachenlandes / Hierher gehören verschiedene Formen von Simulationen, Inszenierungen, Planspielen, Literaturrecherchen u.a.“[30]
Die kulturwissenschaftliche Landeskunde: (seit dem Ende der 90er Jahre)
Seit dem Ende der 90er Jahre ist von dem kulturwissenschaftlichen Ansatz die Rede. Die kulturwissenschaftliche Landeskunde weist nicht nur auf eine objektiv bestehende und beschreibbare Welt und Wirklichkeit hin, sondern hat mit ,,... symbolischen Ordnungen und Sinnzuschreibungen und mit Prozessen eines diskursiven Aushandelns von Bedeutung zu tun.“[31]
Die kulturwissenschaftliche Landeskunde hängt im Fremdsprachnunterricht mit dem kulturellen Lernen zusammen und schließt Kultur als ein symbolisches System und auch Wahrnehmungs- und Verhaltenweisen (Mentalitäten) ein.[32]
Die Aufgabe der kulturwissenschaftlichen Landeskunde ist, die in der alltäglichen Kommunikation vorkommenden impliziten kulturellen Deutungsmuster explizit sichtbar und lernbar zu machen.[33] Der Kulturbegriff, der den kulturellen Deutungsmustern zugrunde liegt, ist nicht von Kultur als national definierte Gruppen von Menschen zu verstehen. Kulturelle Deutungsmuster bedeuten die Muster, die einem mit Sinn und Bedeutung zur Verfügung stehen und anhand dessen die Wirklichkeit interpretiert wird. Als Beispiel kann man hier die Mitglieder eines Fußball-Fanclubs nennen. Sie verfügen über einen gemeinsamen Fundus, obwohl sie unterschiedliche naionale, regionale und soziale Hintergründe haben. [34] Die kulturellen Deutungsmuster sind innerhalb von einer Gruppe als ,Wissensvorrat‘ vorhanden. Die Wirklichkeit wird anhand der vorhandenen Muster interpretiert.
Der kulturwisenschaftliche Ansatz ist ein Versuch der Verwissenschatlichung der Landeskunde. Dieser Ansatz ist eine Weiterentwicklung des interkulturellen Ansatzes und korrigiert die Schwachstellen dieses Ansatzes. Der interkulturelle Ansatz geht davon aus, dass es homogene, geschlossenen Kulturen gibt, aber der kulturwissenschaftliche Ansatz ist den hybriden Gesellschaften im postkolonialen Zeitalter gerecht.
Ansätze der Landeskundevermittlung in Lehrwerken:
Die Aufgabe der Landeskunde hat sich also im Laufe der Zeit verändert. Alle diese Veränderungen betonen jedoch, dass die Sprache als ein Teil der jeweiligen Kultur gelernt werden soll und dass Landeskunde ein Teil der Spracherlernung ist.
Nach den 90er Jahren, in der Post-Methoden-Phase, findet man aber eine sinnvolle Synthese aller oben erwähnten Ansätze in den DaF-Lehrwerken. Der Pluralismus der Ansätze ist hier das Leitprinzip. Das möchte ich anhand der Beispiele aus zwei aktuellen Lehrwerken, nämlich Studio d A1 und A2 und Netzwerk A1 illustrieren.
A. Studio D A1 und A2:
1. Der kognitive Ansatz:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Studio d AI S. 123
In diesem Beispiel handelt es sich um das landeskundliche Thema .Berufe'.Die Lieblingsberufe der deutschen Jugendlichen werden hier grafisch dargestellt. Die grafische Darstellung ist typisch für den kognitiven Ansatz. Die vermittelte Information ist faktisch und verallgemeinert.
2. Der kommunikative Ansatz:
Das landeskundliche Thema .Orientierung in der Stadt' kommt in dem Lehrwerk Studio d A1 Lehrwerk vor (Studio d A1 S. 129). Hier findet man die nötigen Redemittel für die Erkundigung nach dem Weg und für die Wegbeschreibung. Das Ziel des kommunikativen Ansatzes, nämlich das Gelingen sprachlicher Handlungen im Alltag, kommt in diesem Beispiel vor.
3. Der interkulturelle Ansatz:
In der 7. Lektion von dem Studio d A2 handelt es sich um das Thema ,Wohnen‘. Der Aspekt dieses Themas nämlich ,Wohnen auf dem Land und in der Stadt‘, gibt Anregungen zu einem interkulturellen Vergleich (S.114). Anhand einiger Leitpunkte soll man die Vor- und Nachteile von dem Wohnen auf dem Land / in der Stadt vergleichen. Die Aufgabe lautet: „Stadt oder Land? Vor- und Nachteile in Ihrem Land.“ Diese Aufgabe bietet auch Schreib- und Sprachanlässe an.
4. Die integrative Landeskunde:
Im Lehrwerk Studio d A2 wird die Informationen über Spezialitäten aus allen deutschsprachigen vermittelt (S.198 und 204). Bei diesen Spezialitäten geht es um die Sachertorte aus Österreich, Gummibärchen aus Deutschland und Rüblitorte aus der Schweiz. Die Integration der deutschsprachigen Länder ist typisch für die integrative Landeskunde. Die landeskundliche Information wird hier jeweils mit einem anderen Aspekt des Sprachunterrichts verbunden. Bei der österreichische Spezialität ,Sachertorte‘ gibt es die Verbindung der Landeskunde und der Lesefertigkeit. Bei den anderen Spezialitäten aus Deutschland bzw. aus der Schweiz findet man die Verbindung zwischen der Landeskunde und der Grammatik.
5. Die erlebbare Landeskunde:
Im Lehrwerk Studio d A1 gibt es eine Möglichkeit, durch die Stadt Berlin einen virtuellen Spaziergang zu machen (S. 133). Hier geht es um die erlebbare Landeskunde. Hier handelt es sich um die Projektarbeit. Anhand der gegebenen Internetadresse (www.visitberlin.de) sollen die Lerner die Stadt virtuell erleben.
Netzwerk A1:
Für die Synthese der Ansätze befinden sich folgende Beipiele im Lehrwerk Netzwerk A1:
1. Der kognitive Ansatz:
Es gibt ein Beispiel in diesem Lehrwerk, in dem es um das landeskundliche Thema ,Medien‘ geht (Netzwerk A1 Arbeitsbuch S. 93). Die Darstellungsform, nämlich ,Grafik‘ ist typisch für den kognitiven Ansatz. Bei dieser Grafik handelt es sich um die Nutzung von Facebook in Deutschland.
2. Der kommunikative Ansatz:
Im diesem Lehrwerk geht es um die Alltagssituation ,im Restaurant‘ (Netzwerk A1 S. 67). Hier findet man die Information über das landeskundliche Thema ,Essen und Trinken‘ bzw. Bestellen und Bezahlen im Restaurant nötigen Redemittel für die Kommunikation.
3. Der interkulturelle Ansatz:
Bei dem Aspekt ,Haustypen‘ des Themas ,Wohnen‘ findet man Anregungen zum interkulturellen Vergleich (Netzwerk A1 S. 92-93). Die üblichen Haustypen in Deutschland werden hier anhand von einigen Bildern dargestellt. Dann befindet sich die folgende Aufgabe: „Wie wohnt man bei Ihnen? Gibt es besondere Wohnungen oder Häuder? Bringen Sie Fotos mit und erzählen Sie.“ Die Haustypen können hier interkulturell verglichen werden.
4. Die integrative Landeskunde:
Es befindet sich in diesem Lehrwerk ein Landeskundequiz (Netzwerk A1 S. 142-143). Bei diesem Quiz findet man die Integration aller deutschsprachigen Länder. Die landeskundliche Information wird hier mit einem Lernspiel verbunden.
5. Der kulturwissenschaftliche Ansatz:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Netzwerk Al S. 58
Das kann als ein Beispiel für den kulturwissenschaftlichen Ansatz betrachtet werden. In diesem Beispiel geht um das Thema Pünktlichkeit/ Es wird viel über die Pünktlichkeit der Deutschen gesprochen. Aber dieses Beispiel vermittelt kein einheitliches sondern ein differenziertes Bild der deutschen Pünktlichkeit. Das individuelle Verständnis der Pünktlichkeit kann hier Vorkommen. In diesem Beispiel kommt die Hybridität in einer Gesellschaft und die mentalen Bereiche der Menschen vor.
Diese Beispiele aus den zwei Lehrwerken verdeutlichen, dass man in den gegenwärtigen DaF-Lehrwerken eine sinnvolle Verbindung unterschiedlicher landeskundlicher Ansätze bei der Landeskundevermittlung findet. Die Betonung des einen oder anderen landeskundlichen Ansatzes hängt von den konkreten Rahmenbedingungen und den Unterrichtszielen ab.35 Diese Synthese trägt dazu bei, dass der Sprachunterricht abwechselungsreich und interessant wird. Man hat die Möglichkeit, den passenden Ansatz für die Landeskundevermittlung auszuwählen. Der geeignete Ansatz steigert die Effektivität der Vermittlung der Information. Anhand dieser Ansätze können die kommunikative und interkulturelle Kompetenz gefördert werden. Man kann den Lenern die Möglichkeit anbieten, die Landeskunde zu erleben. Die Vorteile aller Ansätze führen zum effektiven Lernen der Fremdsprache.
Bibliographie:
ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht. In: Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 3, Okt. 1990, S. 60-61
Althaus, Hans-Joachim: Landeskunde. Anmerkungen zum Stand der Dinge. In: InfoDaF Nr. 1, 26 Jhg, Februar 1999, S. 25-36
Altmayer, Claus / Koreik, Uwe: .Geschichte und Konzepte einer Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache. In: Krumm / Fandrych / Hufeisen / Riemer: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch, 2. Halbband, De Gruyter Mouton, 2010, S. 1378-1391
Altmayer, Claus: „Kulturelle Deutungsmuster“ als Lerngegenstand. Zur kulturwissenschaftlichen Transformation der Landeskunde. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen, 35. Jhg. 2006. Hrsg. Von Claus Gnutzmann / frank G. Königs / Ekkehard Zöfgen. Narr Francke Attempto Verlag., GmbH + Co. KG. Tubingen, S. 44-59
Altmayer, Claus: Kultur als Hypertexte. Zu Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach Deutsch las Fremdsprache. Iudicium Verlag GmbH, München, 2004
Bauer, Hans-Ludwig: Landeskunde und interkulturelles Lernen- Polemik und Praxis.1. Teil In: Zielsprache Deutsch, 36. Jhg. 3, 2009, S. 3-21
Bettermann, Rainer: Sprachbezogene Landeskunde. In: Gerhard Helbig / Lutz Götz / Gert Henrici/ Hans-Jürgen Krumm (Hrsg): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch, 2. Halbband, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2001, S. 1215-1229
Biechele, Markus / Padros, Alicia: Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31. Langenscheidt, 2003. Goethe Institut Inter Nationes, München
Buttjes, D.: Landeskunde- Didaktik und landeskundliches Curriculum. In: Bausch/ Christ/ Krumm (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag, Tübingen, S. 112 - 119
Gürrtler, Karin / Steinfeld, Thomas: Landeskunde ein unmögliches Fach aus Deutschland. In: Info DaF, 17. Jhg. Nr. 3, 1990, Iudicium Verlag GmbH, München, S. 250 - 258
Hackl, Wolfgang: Informationsorientierte Landeskunde. In: Gerhard Helbig / Lutz Götz / Gert Henrici/ Hans-Jürgen Krumm (Hrsg): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch, 2. Halbband, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2001, S. 1204-1215
Holzäpfel, Silke: Integrative Landeskunde. Ein verstehen-oreintiertes Konzept. Kovač Verlag, 2000. (zugl. Dissertation Uni Augsburg, 1999) S. 13-70 / 89-98 / 104-109 http://www.idvnetz.org/Dateien/DACHL/altmayer DACH 2013.pdf
Hyun, Hee: DaF-Unterricht in Korea: ein Beitrag zum interkulturellen Lernen. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2010
Lüger, Heinz-Helmut: Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation. Fernstudienreihe, Langenscheidt, 1993
Lüsebrink, Hans-Jürgen: Kulturwissenschaftliche Landeskunde. In: Alois Wierlacher / Andrea Bogner (Hrsg.): Handbuch interkulturelle Germanistik. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH, Stuttgart, 2003, S. 487-493
Mog, Paul (in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Althaus) (Hrsg.): Die Deutschen in ihrer Welt: Tübinger Modell einer integrativen Landeskunde. Langenscheidt KG, Berlin, München 1992
Neuner, Gerhard: Fremde Welt und eigene Erfahrung- zum Wandel der Konzepte von Landeskunde für den fremdsprachlchen Deutschunterricht. In: Gerhard Neuner (Hrsg. Unter Mitarbeit von Monika Asche): Fremde Welt und eigene Wahrnehmung. Konzepte von Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. (eine Tagungsdokumentation). Unversität Gesamtschule Kassel, 1994, S. 14-39 (Kasseler Werkstattberichte zur Didaktik „Deutsch als Zweit- und Fremdsprache“, Heft 3)
Pauldrach, Andreas: Eine unendliche Geschichte. Anmerkungen zur Situation der Landeskunde in den 90er Jahren. In: Fremdsprache Deutsch. Zeitshchrift für Praxis des Deutschunterrichts. Heft 6, Juni 1992, S. 4-17
Rösler, Dietmar: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. J.B. Metzler, Stutgart, 2012
Veeck, Reiner / Linsmayer, Ludwig: Geschichte und Konzepte der Landeskunde. In: Gerhard Helbig / Lutz Götz / Gert Henrici/ Hans-Jürgen Krumm (Hrsg): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch, 2. Halbband, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2001, S. 1160-1168
Wörmer, Jörg: Landeskunde als Wissenschaft. In: JbDaF, 29 (Mediation und Vermittlung), 2003, Iudicium Verlag GmbH, München, S. 435-470
Yuan, Li: Integrative Landeskunde. Ein didaktisches Konzept für Deutsch als Fremdsprache in China am Beispiel des Einsatzes von Werbung. Iudicium Verlag GmbH, München, 2007
Zeuner, Ulrich: Landeskunde und interkulturelles Lernen: eine Einführung http://wwwpub.zih.tu- dresden.de/~uzeuner/studienplatz landeskunde/zeuner reader landeeskunde.pdf (Heruntergeladen am 15/11/2012)
Funk, Hermann / Kuhn, Christina u.a.: Studio d A1/A2 Deutsch als Fremdsprache Kurs- und Übungsbuch. Cornlesen Verlag, 2005 (Indische Auflage 2009)
Dengler, Stefanie / Rusch, Paul u.a.: Netzwerk A1 Kursbuch. Klett-Langenscheidt GmbH, München, 2013 (1. indische Auflage, 2015)
Dengler, Stefanie / Rusch, Paul u.a.: Netzwerk A1 Arbeitsbuch. Klett-Langenscheidt GmbH, München, 2013 (1. indische Auflage, 2015)
[...]
[1] Vgl. Althaus: S. 25, Gürttler / Steinfeld S. 250
[2] Buttjes,D.: S.112
[3] Rösler S. 95
[4] Vgl. Bauer, Hans-Ludwig S. 16
[5] Zit.n.Altmayer S. 18 Delmas, Hartmut / Voderwülbecke, Klaus: Landeskunde. In: Rolf Ehnert (Hrsg.): Einführung in das Studium des Faches Deutsch als Fremdsprache. Handreichungen für den Studienbeginn, 2. Aufl. Frankfurt a.m. u.a. 1989, S. 159 - 196
[6] Vgl. Yuan S: 25 / Holzäpfel S. 30 /Wörmer S.437
[7] Vgl. Neuner S. 18-19
[8] Vgl. Neuner S. 18-19 / Hackl S. 1209
[9] Vgl. Hackl S. 1207
[10] Vgl. Veeck / Linsmayer S. 1161
[11] Vgl. Lüger S. 27
[12] Zit.n. Althaus S. 26 Rösler, Dietmar: Deutsch als Fremdsprache (Sammlung Metzler 280) Stuttgart; Weimar; Metzler, 1994
[13] Vgl. Veeck / Linsmayer S. 1161, Yuan S. 31
[14] zit.n. Holzäpfel S. 61Erdmenger Manfred / Istel Hans-Wolf: Didaktik der Landeskunde. Max Hueber Verlag, 1973 S. 14
[15] Vgl. Rösler S. 200
[16] Vgl. Biechele / Padros S. 26, Zeuner S. 18
[17] Pauldrach S. 7
[18] Vgl. Hyun S. 43
[19] Vgl. Biechele / Padros S. 33
[20]. ABCD-Thesen S. 60
[21] Vgl. Yuan S. 42
[22] Vgl. Biechele / Padros S. 101
[23] Vgl. Yuan S. 108
[24] Ebd.
[25] Vgl. Mog S. 10
[26] Vgl. Yuan S. 61
[27]Ebd.
[28]Ebd.
[29]Vgl. Bichele / Padros S. 110
[30]Biechele / Padros: Didaktik der Landeskunde S. 110
[31] http://www.idvnetz.org/Dateien/DACHL/altmayer DACH 2013.pdf S. 16
[32] Vgl. Lüsebrink S. 488
[33] Vgl. Altmayer / Koreik S. 1382
[34] Vgl. Altmayer (2006) S. 52
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Zur Synthese der Ansätze aus der Landeskundetheorie in den gegenwärtigen DaF- Lehrwerken"?
Der Text untersucht, wie verschiedene Ansätze der Landeskunde in aktuellen Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Lehrwerken integriert werden. Er analysiert, wie kognitive, kommunikative, interkulturelle, integrative, erlebte/erlebbare und kulturwissenschaftliche Ansätze in Lehrwerken wie Studio d A1/A2 und Netzwerk A1 Anwendung finden.
Was versteht man unter "Landeskunde" im Kontext des DaF-Unterrichts?
Landeskunde umfasst alle Bezüge zu den Gesellschaften, deren Sprache im Fremdsprachenunterricht gelernt wird. Es beinhaltet Wissen über Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport, Geographie, aktuelle Politik, Geschichte und Kommunikationsweisen in deutschsprachigen Ländern. Landeskunde dient auch als Medium der Kulturvermittlung.
Welche historischen Entwicklungen hat die Landeskunde durchlaufen?
Die Landeskunde hatte im Laufe der Zeit unterschiedliche Bezeichnungen wie Realienkunde, Kulturkunde, Deutschlandstudien und Deutschlandkunde. Nach 1949 gab es eine Unterscheidung zwischen BRD-Kulturkunde und DDR-Landeskunde. Die Landeskunde erfuhr in den 60er und 70er Jahren in der BRD eine Aufwertung durch Bildungsreformen. In den 90er Jahren stieg das Interesse an der Landeskunde aufgrund des Mauerfalls und veränderter politischer Bedingungen.
Welche Funktionen erfüllt die Landeskunde im DaF-Unterricht?
Die Landeskunde dient als Informationsquelle über deutschsprachige Länder, zielt auf die Entwicklung interkultureller Kompetenz ab, ermöglicht den Vergleich zwischen eigener und fremder Kultur, trägt zum Abbau von Stereotypen und Vorurteilen bei und fördert Toleranz und Völkerverständigung.
Welche verschiedenen Ansätze zur Landeskundevermittlung werden im Text beschrieben?
Der Text beschreibt den kognitiven Ansatz (Faktenvermittlung), den kommunikativen Ansatz (Handlungsfähigkeit im Alltag), den interkulturellen Ansatz (Sensibilisierung für fremde Kulturen), die integrative Landeskunde (Integration verschiedener Bezugswissenschaften und Lernerfahrungen), die erlebte und erlebbare Landeskunde (Erfahrung vor Ort oder durch Simulationen) und den kulturwissenschaftlichen Ansatz (symbolische Ordnungen und Sinnzuschreibungen).
Was ist der kognitive Ansatz in der Landeskunde?
Der kognitive Ansatz konzentriert sich auf die Vermittlung von Fakten über die Zielkultur, einschließlich Kenntnisse über das alltägliche Leben, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Landeskunde wird durch Sachtexte, Grafiken und Statistiken vermittelt.
Wie unterscheidet sich der kommunikative Ansatz von anderen Ansätzen?
Der kommunikative Ansatz integriert Landeskunde in den Sprachunterricht und betrachtet landeskundliches Wissen als Voraussetzung für die Kommunikation. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie man sich im Zielsprachenland verständigen und zurechtfinden kann, mit Themen wie Wohnen, Arbeiten, Essen und Trinken.
Was beinhaltet der interkulturelle Ansatz?
Der interkulturelle Ansatz zielt auf die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im Umgang mit fremden Kulturen. Es geht darum, fremdkulturelle Erscheinungen besser einzuschätzen und Vorurteile abzubauen.
Was kennzeichnet die integrative Landeskunde?
Die integrative Landeskunde integriert die Landeskunde in den Sprachunterricht, Informationen aus verschiedenen Bezugswissenschaften und die eigenen kulturellen Erfahrungen der Lernenden. Sie berücksichtigt alle deutschsprachigen Länder und strebt eine Verbindung von Sachkenntnissen mit kommunikativen und kulturellen Lernzielen an.
Was bedeutet "erlebte und erlebbare Landeskunde"?
Die erlebte Landeskunde bezieht sich auf das Erfahren der Landeskunde "vor Ort" im Zielsprachenland. Die erlebbare Landeskunde hingegen bezieht sich auf das Herstellen von ähnlichen Situationen außerhalb des Zielsprachenlandes, beispielsweise durch Simulationen oder Internetrecherchen.
Was versteht man unter dem kulturwissenschaftlichen Ansatz in der Landeskunde?
Der kulturwissenschaftliche Ansatz betrachtet Kultur als ein System von symbolischen Ordnungen, Sinnzuschreibungen und Prozessen des Aushandelns von Bedeutung. Er zielt darauf ab, implizite kulturelle Deutungsmuster sichtbar und lernbar zu machen und korrigiert Schwachstellen des interkulturellen Ansatzes, indem er hybride Gesellschaften im postkolonialen Zeitalter berücksichtigt.
Wie werden die verschiedenen Ansätze in den Lehrwerken Studio d A1/A2 und Netzwerk A1 umgesetzt?
Die Lehrwerke nutzen eine Synthese der verschiedenen Ansätze. Studio d A1/A2 integriert kognitive Elemente (grafische Darstellungen von Fakten), kommunikative Elemente (Redemittel für Alltagssituationen), interkulturelle Vergleiche (Vor- und Nachteile des Wohnens auf dem Land/in der Stadt), integrative Elemente (Spezialitäten aus allen deutschsprachigen Ländern) und erlebbare Elemente (virtuelle Spaziergänge). Netzwerk A1 zeigt ähnliche Elemente, einschließlich eines Beispiels für den kulturwissenschaftlichen Ansatz (unterschiedliche Auffassungen von Pünktlichkeit).
Welche Schlussfolgerung zieht der Text bezüglich der Landeskundevermittlung in aktuellen DaF-Lehrwerken?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken eine sinnvolle Verbindung unterschiedlicher landeskundlicher Ansätze bei der Landeskundevermittlung zu finden ist. Die Synthese trägt dazu bei, dass der Sprachunterricht abwechselungsreich und interessant wird und die kommunikative und interkulturelle Kompetenz gefördert wird.
- Arbeit zitieren
- Aparna Sahasrabudhe (Autor:in), 2015, Zur Synthese der Ansätze aus der Landeskundetheorie in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351707