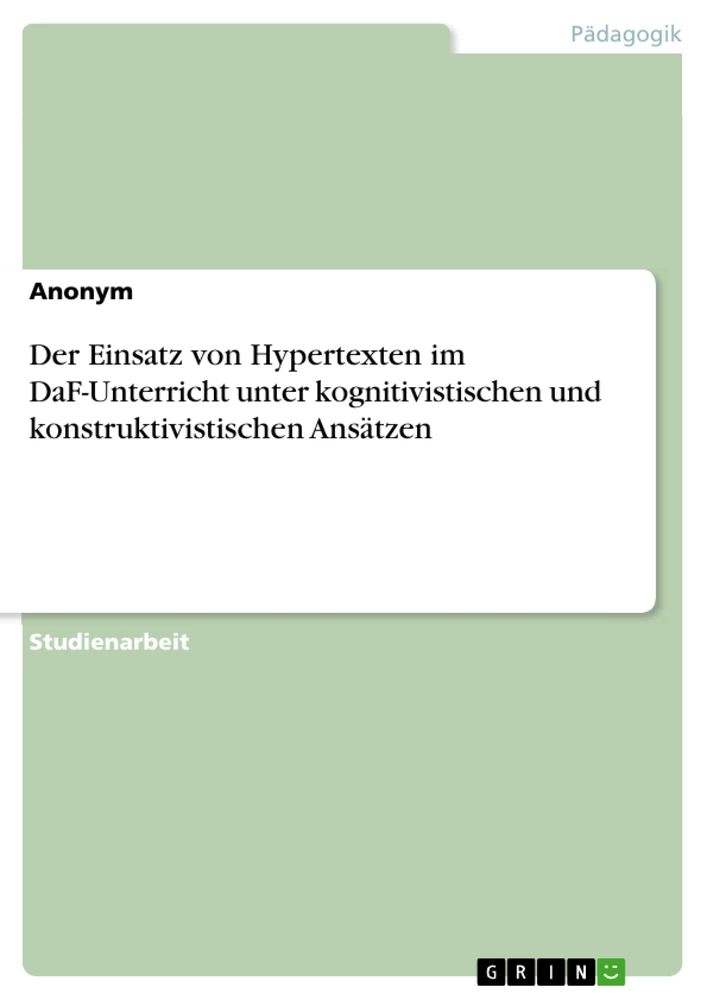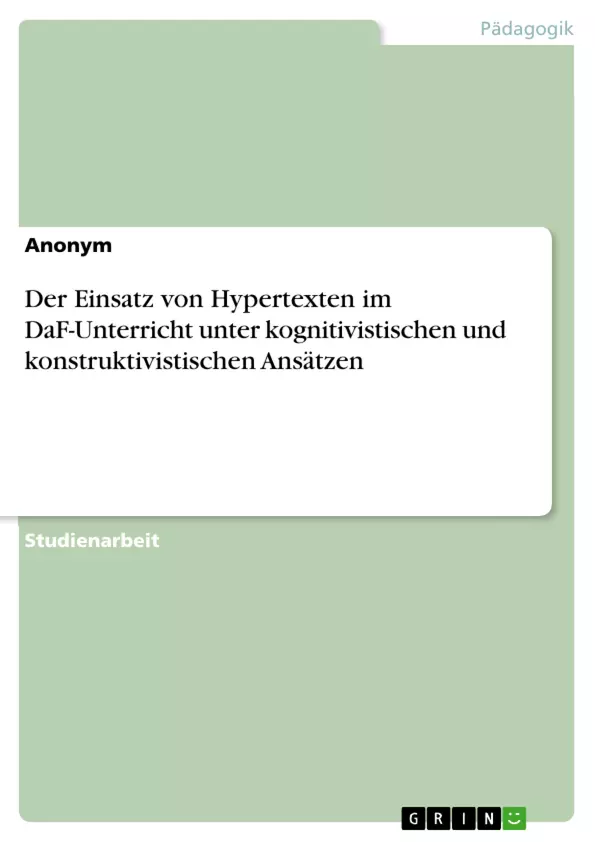Medien nehmen heutzutage einen immer größeren Teil der Lebenszeit der Menschen ein. Es wird immer häufiger versucht, elektronische Medien im Fremdsprachenunterricht anzuwenden. Der für die vorliegende Arbeit zentrale Begriff „Hypertext“ ist eng mit Begriffen wie Multimedia, Hypermedia, Internet usw. verbunden und übt heute eine große Faszination aus. Hypertexte können als elektronische Texte definiert werden, die Information nicht-linear präsentieren.
Die Wissensinhalte werden in selbständige Einheiten (Knoten) aufgegliedert, die durch Verweise miteinander verknüpft werden. In Hypertexten wird den Lesern weder eine Reihenfolge nahegelegt, in der er die Knoten aufrufen soll, noch werden die Beziehungen zwischen den einzelnen Knoten explizit gemacht. Mit der Entwicklung von Hypertexten werden die Anwendungsbereiche auch immer mehr ausgeweitet. Sie werden nicht mehr ausschließlich als effektive Wissensspeicher konzipiert, sondern auch in Lehr-/Lernsettings eingebunden. Vor dem Hintergrund der Vorstellung von Lernen als aktivem und konstruktivem Prozess sind Hypertexte besonders geeignet, diesen Aspekten von Lernen Rechnung zu tragen, weil sie Informationen nicht-linear präsentieren.
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Rolle von Hypertext im DaF-Unterricht. Dieser Beitrag möchte dazu dienen, neue Perspektiven zu eröffnen und Verbindungen zwischen dem Hypertext und kognitivistischen und konstruktivistischen Ansätzen hinsichtlich der Autonomie der Lernenden herauszufinden. Es stellen sich also die folgenden Fragen: Welche Rolle spielen Hypertexte im Fremdsprachenerwerb? Welche Folgen haben sie für den DaF-Unterricht? Welche Vorteile und Herausforderungen bringen Hypertexte mit sich?
Im Laufe der Arbeit wird versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. In den Kapiteln 2 und 3 wird das Hypertext-Konzept ausführlich mit ihren für den Lernkontext relevanten Merkmalen beschrieben. In den beiden folgenden Kapiteln 4 und 5 wird einen Überblick über verschiedenen Lernparadigmen gegeben, nämlich Kognitivismus und Konstruktivismus. In Kapitel 6 wird auf die Vorteile des Lernens mit Hypertexten eingegangen. In Kapitel 7 werden die Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Lernen mit Hypertexten vorgestellt und die Voraussetzungen und Bedingungen für das effktive Lernen mit Hypertexten diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 3. Ausgewählte Merkmale von Hypertexten
- .1
- .2
- .4
- 4. Kognitivistische Ansätze
- .6
- 5. Konstruktivistische Ansätze
- .9
- 6. Begründungsansätze für einen Einsatz von Hypertexten im DaF-Unterricht
- 7. Typische Probleme beim Lernen mit Hypertexten im DaF-Unterricht
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag untersucht die Rolle von Hypertext im DaF-Unterricht und zielt darauf ab, neue Perspektiven zu eröffnen sowie Verbindungen zwischen Hypertext und kognitivistischen und konstruktivistischen Ansätzen hinsichtlich der Autonomie der Lernenden zu erforschen. Die Arbeit befasst sich mit den Fragen, welche Rolle Hypertexte im Fremdsprachenerwerb spielen, welche Folgen sie für den DaF-Unterricht haben und welche Vorteile und Herausforderungen sie mit sich bringen.
- Die Bedeutung von Hypertext im Fremdsprachenerwerb
- Der Einfluss von Hypertexten auf den DaF-Unterricht
- Vorteile des Lernens mit Hypertexten
- Herausforderungen beim Lernen mit Hypertexten
- Kognitivistische und konstruktivistische Ansätze im Kontext des Hypertext-Einsatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 und 3 befassen sich mit dem Hypertext-Konzept und seinen für den Lernkontext relevanten Merkmalen. Kapitel 4 und 5 geben einen Überblick über die Lernparadigmen Kognitivismus und Konstruktivismus. Kapitel 6 beleuchtet die Vorteile des Lernens mit Hypertexten, während Kapitel 7 die Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Lernen mit Hypertexten sowie die Voraussetzungen und Bedingungen für effektives Lernen mit Hypertexten diskutiert.
Schlüsselwörter
Hypertext, DaF-Unterricht, Fremdsprachenerwerb, Kognitivismus, Konstruktivismus, Nicht-Linearität, Lernparadigmen, Vorteile, Herausforderungen, Autonomie der Lernenden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Hypertext im Kontext des Lernens?
Ein Hypertext ist ein elektronischer Text, der Informationen nicht-linear in Einheiten (Knoten) präsentiert, die durch Verweise (Links) miteinander verknüpft sind. Dies ermöglicht individuelle Lesepfade.
Wie unterstützt Hypertext den konstruktivistischen Lernansatz?
Da Lernen im Konstruktivismus als aktiver, selbstgesteuerter Prozess gesehen wird, bietet die nicht-lineare Struktur von Hypertexten den Lernenden die Möglichkeit, Wissen eigenständig zu verknüpfen und zu konstruieren.
Welche Vorteile bietet Hypertext im DaF-Unterricht?
Vorteile sind die Förderung der Lernerautonomie, der Zugang zu authentischen multimedialen Inhalten und die Möglichkeit, Informationen je nach individuellem Vorwissen und Interesse abzurufen.
Was sind die Herausforderungen beim Lernen mit Hypertexten?
Schüler können unter „Cognitive Overload“ leiden (kognitive Überlastung) oder die Orientierung verlieren („Lost in Hyperspace“), wenn die Struktur zu komplex oder die Navigationshilfe unzureichend ist.
Welche Rolle spielt die Lernerautonomie?
Hypertexte fordern von den Lernenden ein hohes Maß an Selbstregulation, da sie selbst entscheiden müssen, welche Informationen sie in welcher Reihenfolge bearbeiten, um ihr Lernziel zu erreichen.
Wie unterscheiden sich kognitivistische und konstruktivistische Ansätze hierbei?
Kognitivistische Ansätze fokussieren auf die Informationsverarbeitung im Gehirn, während konstruktivistische Ansätze die individuelle Bedeutungskonstruktion und die Interaktion mit dem Medium betonen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Der Einsatz von Hypertexten im DaF-Unterricht unter kognitivistischen und konstruktivistischen Ansätzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351852