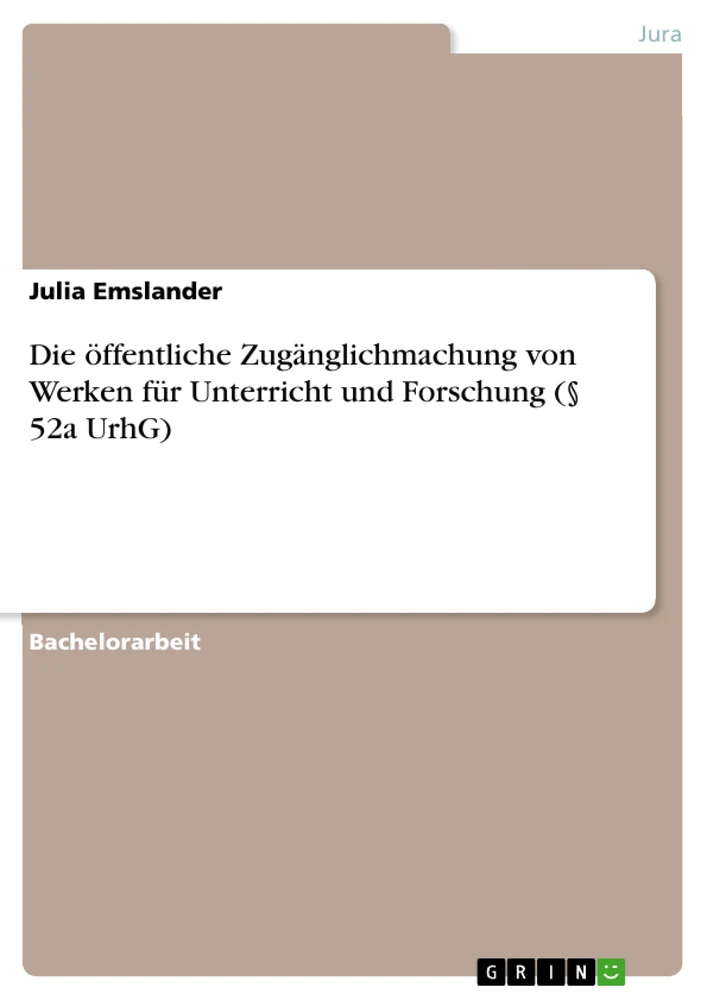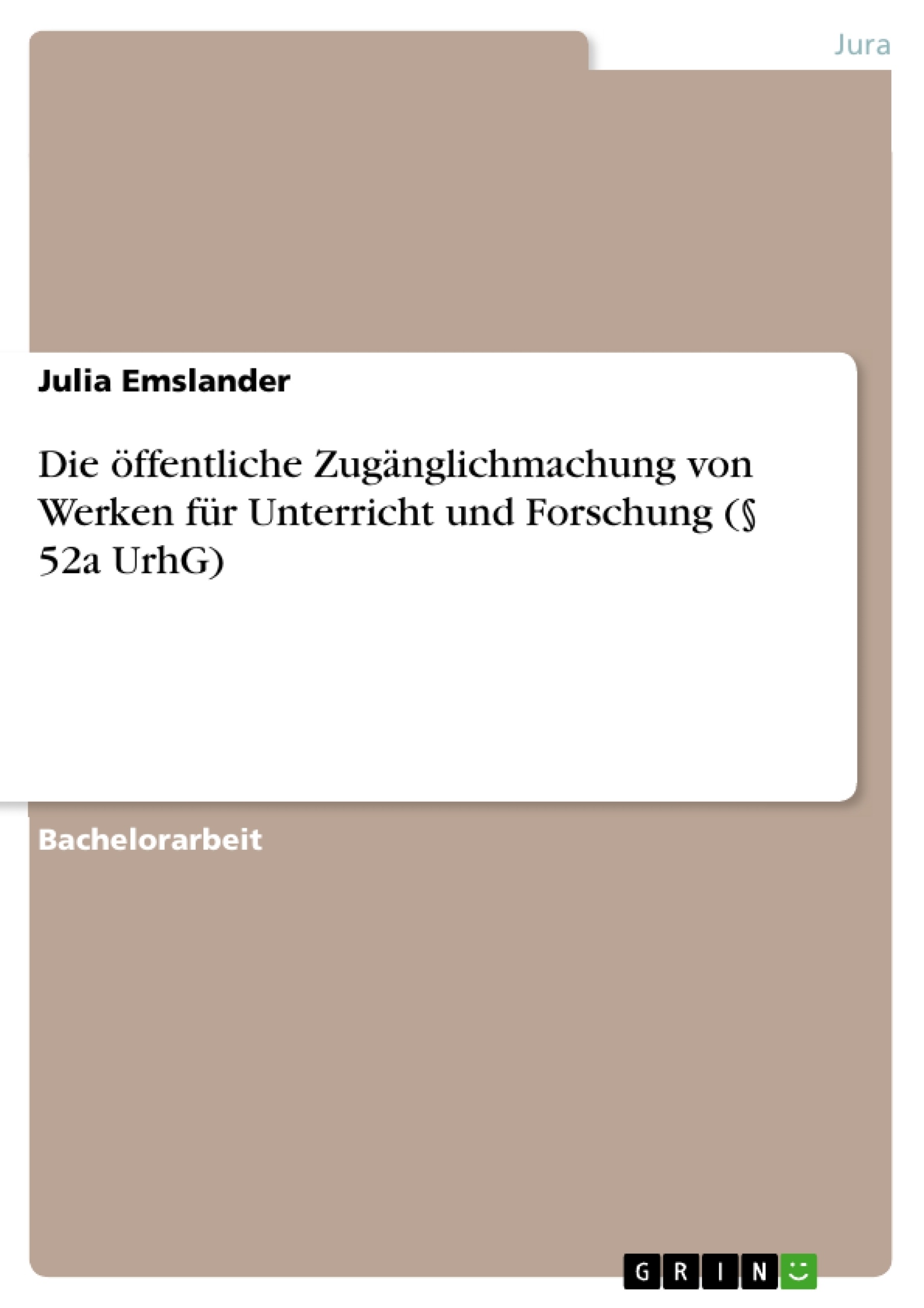Betrachtet man die rasante und flächendeckende Durchdringung der Digitalisierung in Gesellschaft und Wirtschaft der letzten Jahre, kann man von einer regelrechten digitalen Revolution sprechen. Moderne Kommunikations- und Informationstechnologien eröffnen neue Möglichkeiten – vor allem auch im Bereich der Bildung und Forschung. Diese Entwicklung stellt auch heute noch eine große Schwierigkeit für das Urheberrecht dar. Die neuen digitalen Technologien ermöglichen einen schnelleren und einfacheren Eingriff in die Rechte der Urheber. Beispielsweise ist es möglich, urheberrechtlich geschützte Werke in kürzester Zeit und nahezu ohne Kosten bei gleichbleibender Qualität in einer hohen Anzahl verfügbar zu machen. Daher war und ist es vonnöten, das Urheberrecht auch für den Bereich der Forschung und Bildung ständig anzugleichen, um in der digitalen Welt den Urheberschutz garantieren zu können.
Mit Blick auf die zunehmende Verwendung moderner Kommunikations- und Informationstechnologien im Kontext von Bildung und Forschung spielen vor allem die Einführung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung gem. § 19a UrhG, wie auch die Einführung des § 52a UrhG, welcher zugleich das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung wieder einschränkt, eine große Rolle. Der Gesetzgeber verfolgte hierbei das Ziel, die Verwendung von digitalen Kommunikationsformen in Unterricht und Forschung zu fördern und somit die Wettbewerbsfähigkeit des Bildungs- und Wissenschaftsstandorts Deutschland zu stärken, ohne dabei zu sehr in die Rechte der Urheber einzugreifen.
Während das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gem. § 19a UrhG mit viel Zuspruch angenommen wurde, führte die Einführung der „Bildungs- und Forschungsschranke“ des § 52a UrhG zu erheblichen und kontrovers diskutierten Auseinandersetzungen, und das teilweise bis heute.
Nicht zuletzt lag das an der Verwendung einer Schar von unbestimmten Rechtsbegriffen im Normtext des § 52a UrhG. Diese Arbeit beschäftigt sich eingehend und detailliert mit den einzelnen Tatbestandsmerkmalen der Norm und schafft dadurch eine klarere Sicht über den Umfang und die Reichweite des § 52aUrhG. Außerdem gibt sie einen Überblick über die einzelnen Phasen der Entstehungsgeschichte der Vorschrift, wobei hier auch auf einige Standpunkte von Vertretern der verschiedenen Interessen eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Historie des § 52a UrhG
- I. Gesetzesentwurf der Bundesregierung
- II. Stellungnahme des Bundesrates
- III. Gegenäußerung der Bundesregierung
- IV. Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses
- V. Inkrafttreten des Gesetzes
- VI. Frist des § 137k UrhG
- C. Tatbestandsmerkmale des § 52a UrhG
- I. Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung, § 52a Abs. 1 UrhG
- 1. Öffentliche Zugänglichmachung
- a) Öffentlichkeitsbegriff in § 15 Abs. 3 UrhG
- b) Öffentlichkeitsbegriff in § 52a UrhG
- c) Akt der Zugänglichmachung
- 2. Zulässige Nutzungsgegenstände
- a) Kleine Teile eines Werkes
- b) Teile eines Werkes
- c) Werke geringen Umfangs
- d) Einzelne Beiträge aus Zeitungen und Zeitschriften
- 3. Privilegierte Zwecke
- a) Veranschaulichung im Unterricht, § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG
- b) Eigene wissenschaftliche Forschung, § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG
- 4. Bestimmt abgegrenzter Personenkreis
- a) Unterricht, § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG
- b) Forschung, § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG
- 5. Gebotenheit zum jeweiligen Zweck
- a) Gebotenheit
- b) Entfall der Gebotenheit
- 6. Bereichsausnahmen, § 52a Abs. 2 UrhG
- II. Rechtfertigung zu nicht kommerziellen Zwecken
- 1. Für den Unterricht an Schulen bestimmte Werke, § 52a Abs. 2 Satz 1 UrhG
- 2. Filmwerke, § 52a Abs. 2 Satz 2 UrhG
- III. Erforderliche Vervielfältigung, § 52a Abs. 3 UrhG
- 1. Technisch erforderliche Vervielfältigung
- 2. Vervielfältigung im Vorfeld
- 3. Vervielfältigung im Anschluss
- 4. Vorratsvervielfältigung
- IV. Angemessene Vergütung, § 52a Abs. 4 UrhG
- 1. Umfang der Vergütungspflicht
- 2. Angemessene Vergütungshöhe
- 3. Verwertungsgesellschaftspflicht
- D. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit von Julia Koller befasst sich mit der öffentlichen Zugänglichmachung von Werken für Unterricht und Forschung im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes (§ 52a UrhG). Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung des § 52a UrhG und untersucht die Tatbestandsmerkmale der Vorschrift im Detail. Dabei stehen die Zulässigkeit der Nutzung, die rechtlichen Grenzen und die Vergütungspflicht im Vordergrund.
- Die historische Entwicklung des § 52a UrhG
- Die Tatbestandsmerkmale des § 52a UrhG
- Die Zulässigkeit der Nutzung von Werken für Unterricht und Forschung
- Die rechtlichen Grenzen der Nutzung
- Die Vergütungspflicht im Rahmen von § 52a UrhG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt das Thema und die Forschungsfrage vor und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Kapitel B beleuchtet die Historie des § 52a UrhG und verfolgt die Entwicklung der gesetzlichen Regelung von der Gesetzesinitiative bis zur endgültigen Fassung. Kapitel C widmet sich den Tatbestandsmerkmalen des § 52a UrhG und analysiert die Voraussetzungen für die öffentliche Zugänglichmachung von Werken für Unterricht und Forschung. Dabei werden insbesondere die Begriffe der öffentlichen Zugänglichmachung, die zulässigen Nutzungsgegenstände und die privilegierten Zwecke sowie die Gebotenheit und die Vergütungspflicht im Detail beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen des Urheberrechts, insbesondere die öffentliche Zugänglichmachung von Werken für Unterricht und Forschung gemäß § 52a UrhG. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind daher: Urheberrecht, öffentliche Zugänglichmachung, Unterricht, Forschung, § 52a UrhG, Tatbestandsmerkmale, Zulässigkeit der Nutzung, rechtliche Grenzen, Vergütungspflicht.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der § 52a UrhG?
Der § 52a UrhG regelt die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken für Zwecke des Unterrichts und der Forschung unter bestimmten Voraussetzungen.
Was bedeutet „öffentliche Zugänglichmachung“?
Es bedeutet, ein Werk so verfügbar zu machen, dass Mitglieder der Öffentlichkeit (z.B. Kursteilnehmer oder Forschergruppen) von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl darauf zugreifen können.
Welche Werke dürfen nach § 52a UrhG genutzt werden?
Zulässig sind kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften.
Besteht eine Vergütungspflicht für die Nutzung?
Ja, für die öffentliche Zugänglichmachung nach § 52a UrhG ist eine angemessene Vergütung zu zahlen, die in der Regel über Verwertungsgesellschaften abgewickelt wird.
Warum ist die Vorschrift umstritten?
Die Vorschrift verwendet viele unbestimmte Rechtsbegriffe, was zu Unsicherheiten über den Umfang und die Reichweite der erlaubten Nutzung führt.
- Arbeit zitieren
- Julia Emslander (Autor:in), 2016, Die öffentliche Zugänglichmachung von Werken für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352119