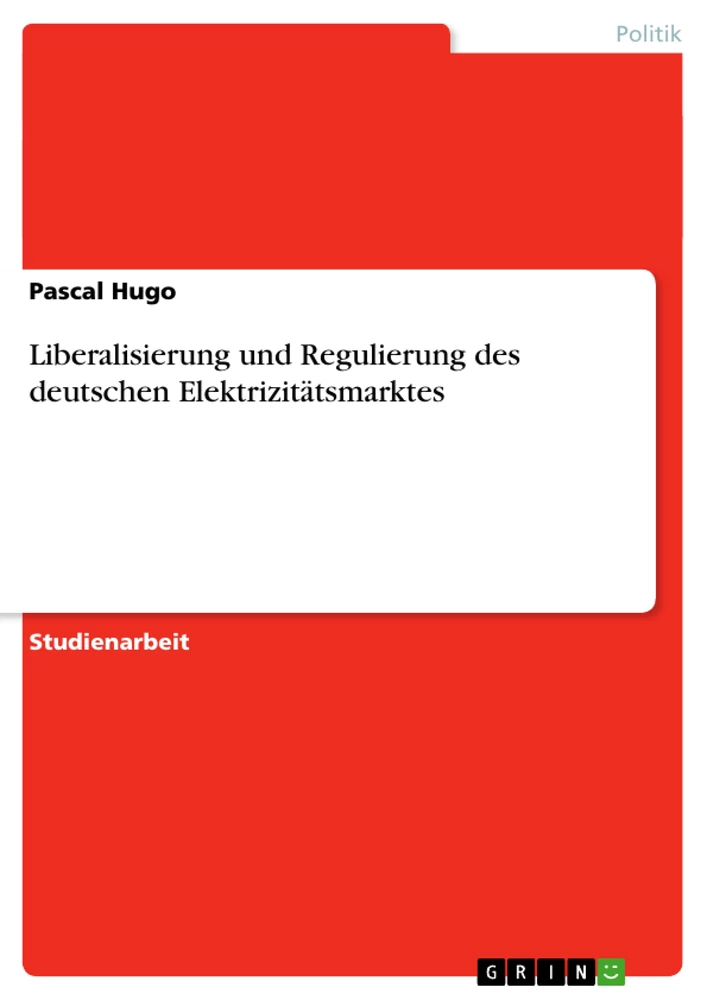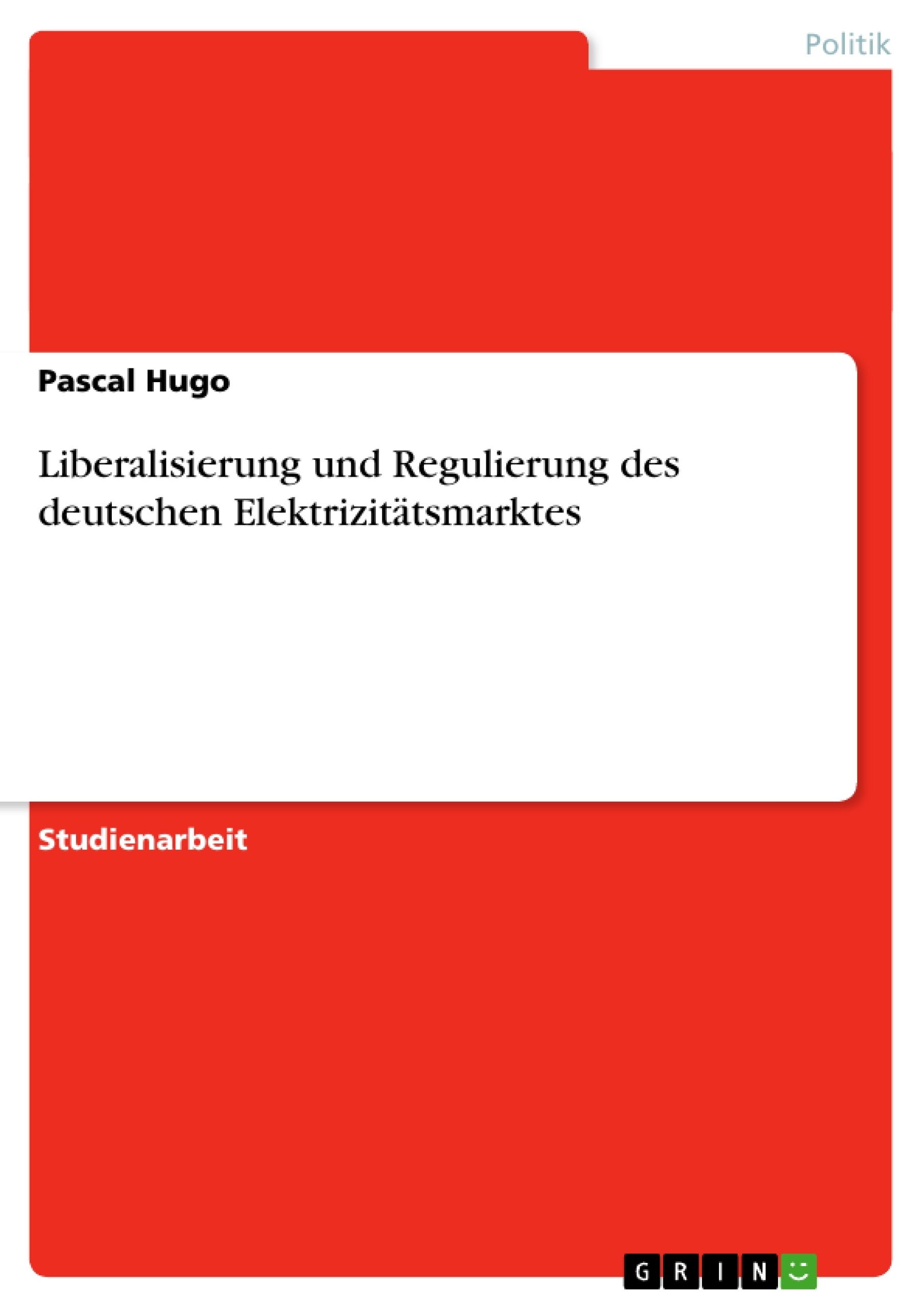Energie im Allgemeinen und Elektrizität im Besonderen und deren Erzeugung, Übertragung und Verteilung stellt eine Schlüsselindustrie dar. Denn sowohl die industrielle Produktion, als auch der gewerbliche Handel und die privaten Haushalte, ja das gesamte gesellschaftliche Leben in den modernen Industriegesellschaften ist auf eine sichere und günstige Stromversorgung angewiesen. Jahrzehntelang wurde die Stromversorgung deshalb auch unter dem Gesichtspunkt der „nationalen Sicherheit“ behandelt. Seit den 1970er Jahren und verstärkt seit den 1980er Jahren wurde die Elektrizitätsversorgung zunehmend als ein Sektor betrachtet, der zwar seine Besonderheiten hat, der jedoch unter bestimmten Voraussetzungen durchaus „wettbewerbsfähig“ ist. Eine Liberalisierung des Elektrizitätssektors stellt aber aufgrund der Besonderheiten und aufgrund des besonderen Stellenwertes der Elektrizitätsversorgung für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung auch eine besondere Herausforderung dar.
Der Autor liefert auf vergleichsweise knappen Raum eine detaillierte Deskription über die Hintergründe der Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes und geht dabei sowohl auf die politischen Zielsetzungen als auch auf sektorale Besonderheiten eines wirtschaftlich und technisch komplexen sowie organisatorisch hochgradig verflochtenen Wirtschaftszweiges ein. Mit akteurtheoretischen Annahmen wie der Principal-Agent-Theorie und dem Gefangenendilemma erläutert der Autor, warum die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes, gemessen an den politischen Zielsetzungen, an der Umsetzung scheiterte und die Energiekonzerne ihre Gebietsmonopole auch nach der Marktliberalisierung erfolgreich verteidigen konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Liberalisierung und Regulierung des deutschen Elektrizitätsmarktes
- Einleitung
- Regulierungs- und Steuerungsmöglichkeiten des modernen Staates
- Besonderheiten des Stromsektors
- Die Struktur des deutschen Stromsektors vor der Liberalisierung
- bilaterale Steuerungsmuster: Verflechtungen
- multilaterale Steuerungsmuster: Verbände
- sektorale Selbststeuerung und die Rolle des Staates
- Die Liberalisierung des deutschen Strommarktes
- Die Ziele der EU-Kommission
- Die Richtlinie 96/92/EG
- Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht: Die Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
- Das Regulierungsmodell des liberalisierten deutschen Stromsektors: verhandelter Netzzugang und Verbändevereinbarungen
- juristischer Exkurs: zum Charakter von Verbändevereinbarungen
- Die Entwicklung des deutschen Elektrizitätsmarktes
- strukturelle Veränderungen
- Entwicklung der Strompreise für Endabnehmer
- Entwicklung der Netznutzungsentgelte
- Zwischenbilanz
- Konsequenzen
- Die Richtlinie 2003/54/EG
- Regulierungsstrategien
- Schluss
- Analyse der Regulierungs- und Steuerungsmöglichkeiten des modernen Staates
- Untersuchung der Besonderheiten der Elektrizitätswirtschaft
- Darstellung der Struktur des deutschen Stromsektors vor der Liberalisierung
- Beurteilung der Ziele und Auswirkungen der EU-Liberalisierungsrichtlinien
- Bewertung des deutschen Regulierungsmodells und der Entwicklung des Elektrizitätsmarktes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Liberalisierung des deutschen Elektrizitätsmarktes und die Regulierungsstrategien, die zur Sicherstellung des Wettbewerbs eingesetzt werden. Die zentrale Frage dabei ist, ob die mit der Liberalisierung verfolgten Ziele erreicht wurden und ob die Regulierungsstrategien ein funktionierendes, liberales Wettbewerbsregime etablieren konnten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Elektrizitätsversorgung für die moderne Gesellschaft dar und führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein. Anschließend werden die Regulierungs- und Steuerungsmöglichkeiten des modernen Staates dargestellt, wobei die Entwicklung vom Interventionsstaat zum neoliberalen Staat beleuchtet wird. Das dritte Kapitel behandelt die Besonderheiten des Stromsektors und die Struktur des deutschen Stromsektors vor der Liberalisierung, inklusive der Analyse von bilateralen und multilateralen Steuerungsmustern sowie der traditionellen Selbststeuerung. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Liberalisierung des Stromsektors, beginnend mit den Zielen der EU-Kommission, der Darstellung der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie und der Umsetzung in nationales Recht. Anschließend wird das deutsche Regulierungsmodell des verhandelten Netzzugangs und der Verbändevereinbarungen vorgestellt, wobei ein juristischer Exkurs über den Charakter von Verbändevereinbarungen folgt. Das fünfte Kapitel analysiert die Entwicklung des deutschen Elektrizitätssektors bis heute, einschließlich der Darstellung struktureller Veränderungen, der Entwicklung der Strompreise und der Netznutzungsentgelte. Abschließend erfolgt eine Zwischenbilanz, die das bestehende System des verhandelten Netzzugangs an den ursprünglichen Zielen der Liberalisierung misst.
Schlüsselwörter
Elektrizitätsmarkt, Liberalisierung, Regulierung, Steuerungsmöglichkeiten, Staat, Wettbewerbsregime, EU-Richtlinien, Energiewirtschaftsrecht, Netzzugang, Verbändevereinbarungen, Entwicklung, Strompreise, Zwischenbilanz.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Hauptziel der Liberalisierung des deutschen Elektrizitätsmarktes?
Ziel war die Aufbrechung monopolistischer Strukturen, um durch Wettbewerb günstigere Strompreise und eine effizientere Versorgung für Endverbraucher zu erreichen.
Welche Rolle spielt die Richtlinie 96/92/EG?
Dies war die erste EU-Beschleunigungsrichtlinie, die den rechtlichen Rahmen für den Elektrizitätsbinnenmarkt schuf und die Mitgliedstaaten zur Marktöffnung verpflichtete.
Warum scheiterte die Umsetzung der Liberalisierung teilweise?
Der Autor erklärt dies mit akteurtheoretischen Ansätzen wie dem Gefangenendilemma: Energiekonzerne konnten ihre Gebietsmonopole durch strategisches Verhalten und Kontrolle über die Netze erfolgreich verteidigen.
Was versteht man unter „verhandeltem Netzzugang“?
Es handelt sich um ein Regulierungsmodell, bei dem die Bedingungen für die Nutzung der Stromnetze zwischen den Beteiligten (oft über Verbändevereinbarungen) ausgehandelt wurden, statt staatlich festgesetzt zu werden.
Wie haben sich die Strompreise nach der Liberalisierung entwickelt?
Die Arbeit analysiert, dass die erhofften Preissenkungen für Endabnehmer oft ausblieben, da Netznutzungsentgelte und die Marktmacht der großen Konzerne stabil blieben.
- Arbeit zitieren
- Pascal Hugo (Autor:in), 2004, Liberalisierung und Regulierung des deutschen Elektrizitätsmarktes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35229