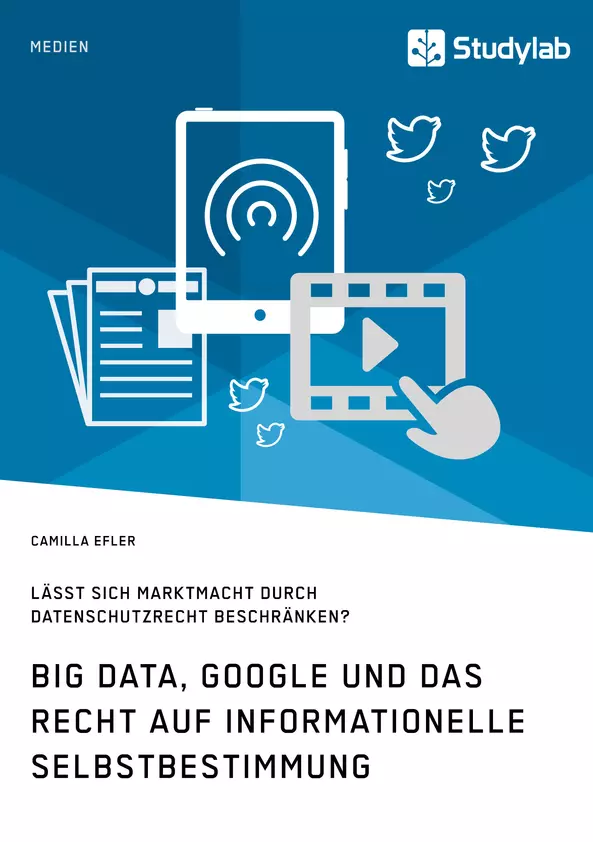Selten hat die Marktmacht eines Unternehmens zu solch umfangreichen rechtlichen Diskussionen geführt, wie es im Zusammenhang mit der Google Inc. der Fall ist. Dieses Spannungsverhältnis zwischen freiheitlichen Grundrechten, wirtschaftlichen Vorteilen und rechts- sowie gesellschaftspolitischen Entwicklungen ist Ausgangspunkt für die Fragestellung der Arbeit: Inwieweit kann Datenschutz einen Beitrag zum marktwirtschaftlichen Problem mit der Google Inc. leisten? Es wird untersucht, ob die Marktmacht des US-amerikanischen IT-Unternehmens Google Inc. in Deutschland beschränkt werden kann, indem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Kern des marktwirtschaftlichen Problems qualifiziert wird.
Das Buch basiert auf der Hypothese, dass die Marktmacht Googles entscheidend auf dem Umgang mit personenbezogenen Daten basiert. Dabei rückt das wirtschaftliche Problem mit Digitalisierung und Weiterentwicklung der Informationstechnologien in Form von Big Data in den Mittelpunkt.
Die derzeitige Debatte um eine europäische Datenschutzgrundverordnung wird zum Anlass genommen, um herauszuarbeiten, ob sich in den Entwürfen mögliche Ansätze zur Beschränkung der Marktmacht befinden. In einem persönlichen Fazit verweist die Autorin auf den Handlungsbedarf in Bezug auf die Veränderungen und Entwicklungen im Umgang mit persönlichen Informationen und mit Privatheit.
Aus dem Inhalt:
- Big Data;
- Datenschutz;
- Privatheit;
- Digitalisierung;
- Marktmacht
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemstellung und Relevanz des Themas
- II. Hypothese und Ziel der Arbeit
- B. Google, ein Big-Data-Unternehmen
- I. Big Data und die Digitalisierung der Welt
- II. Datenkrake Google
- III. Big Data und gesellschaftlicher Wandel
- C. Informationelle Selbstbestimmung versus Marktmacht
- I. Änderung des Umfangs des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung
- II. Personenbezogene Daten im wettbewerbsrechtlichen Kontext
- III. Verbraucherschutz und Datenschutzrecht
- IV. Datenschutz und Änderungen im europäischen Recht
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht, ob die Marktmacht von Google durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt werden kann. Die Arbeit analysiert die Problematik, die sich aus dem Zusammenspiel von Big-Data-Technologie, Digitalisierung und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ergibt. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit Datenschutz als Mittel zur Regulierung der Marktmacht von Google dienen kann.
- Big-Data-Technologie und ihre Auswirkungen
- Die Marktmacht von Google im digitalen Zeitalter
- Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Schutzmechanismus
- Datenschutzrechtliche Regelungen und ihre Wirksamkeit
- Wettbewerbsrechtliche Aspekte im Kontext von Daten
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Problemstellung und Relevanz der Arbeit, die sich mit der Frage befasst, ob die Marktmacht von Google durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung begrenzt werden kann. Es wird die Hypothese und das Ziel der Arbeit dargelegt, die darin besteht, die Wechselwirkungen zwischen Big Data, Google und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu untersuchen und die Möglichkeiten zur Einschränkung der Marktmacht zu analysieren. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit.
B. Google, ein Big-Data-Unternehmen: Dieses Kapitel beleuchtet Google als ein bedeutendes Big-Data-Unternehmen. Es erklärt den Begriff "Big Data" im Kontext der Digitalisierung und beschreibt Googles Rolle als Datenkrake. Weiterhin werden die gesellschaftlichen Auswirkungen der Big-Data-Technologie und der Einfluss von Google auf den gesellschaftlichen Wandel untersucht. Der Abschnitt verbindet technologische Entwicklungen mit ihren sozioökonomischen Konsequenzen und etabliert Google als zentralen Akteur in diesem Kontext.
C. Informationelle Selbstbestimmung versus Marktmacht: In diesem zentralen Kapitel wird das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der Marktmacht von Google untersucht. Es analysiert den Umfang des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und mögliche Änderungen dieses Rechts. Es werden wettbewerbsrechtliche Aspekte im Umgang mit personenbezogenen Daten beleuchtet sowie der Verbraucherschutz und Datenschutzrecht im Kontext von Google's Datenpraktiken. Das Kapitel untersucht auch geplante Änderungen im europäischen Datenschutzrecht, die Auswirkungen auf Google’s Datenverarbeitung und deren Regulierung haben könnten.
Schlüsselwörter
Big Data, Google, Informationelle Selbstbestimmung, Datenschutzrecht, Marktmacht, Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz, Europäische Datenschutzgrundverordnung, Digitalisierung, Datenkrake.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Google, Informationelle Selbstbestimmung und Marktmacht
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht, ob die Marktmacht von Google durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt werden kann. Sie analysiert die Problematik des Zusammenspiels von Big-Data-Technologie, Digitalisierung und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, mit dem Fokus auf Datenschutz als Mittel zur Regulierung von Googles Marktmacht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Hypothese, Zielsetzung), Google als Big-Data-Unternehmen (Big Data, Digitalisierung, gesellschaftlicher Wandel), Informationelle Selbstbestimmung versus Marktmacht (Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz, europäisches Datenschutzrecht) und Fazit.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit Datenschutz als Instrument zur Einschränkung der Marktmacht von Google im Kontext des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung dienen kann.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Big-Data-Technologie und deren Auswirkungen, die Marktmacht von Google, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Schutzmechanismus, datenschutzrechtliche Regelungen und deren Wirksamkeit sowie wettbewerbsrechtliche Aspekte im Umgang mit Daten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, die Hypothese und die Ziele der Arbeit definiert. Das zweite Kapitel beleuchtet Google als Big-Data-Unternehmen und dessen Einfluss auf die Gesellschaft. Das dritte Kapitel analysiert das Spannungsfeld zwischen informationeller Selbstbestimmung und Marktmacht, inklusive Datenschutzrecht und Wettbewerbsrecht. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Big Data, Google, Informationelle Selbstbestimmung, Datenschutzrecht, Marktmacht, Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz, Europäische Datenschutzgrundverordnung, Digitalisierung, Datenkrake.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet? (Kann nicht aus dem gegebenen HTML extrahiert werden)
Diese Information ist nicht in der bereitgestellten HTML-Datei enthalten.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die bereitgestellte HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der Einleitung, des Kapitels über Google als Big-Data-Unternehmen und des Kapitels über Informationelle Selbstbestimmung versus Marktmacht.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet? (Kann nicht aus dem gegebenen HTML extrahiert werden)
Diese Information ist nicht in der bereitgestellten HTML-Datei enthalten.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, insbesondere für Leser, die sich für die Themen Big Data, Datenschutz, Wettbewerbsrecht und die Marktmacht von Google interessieren.
- Arbeit zitieren
- Camilla Efler (Autor:in), 2015, Big Data, Google und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352322