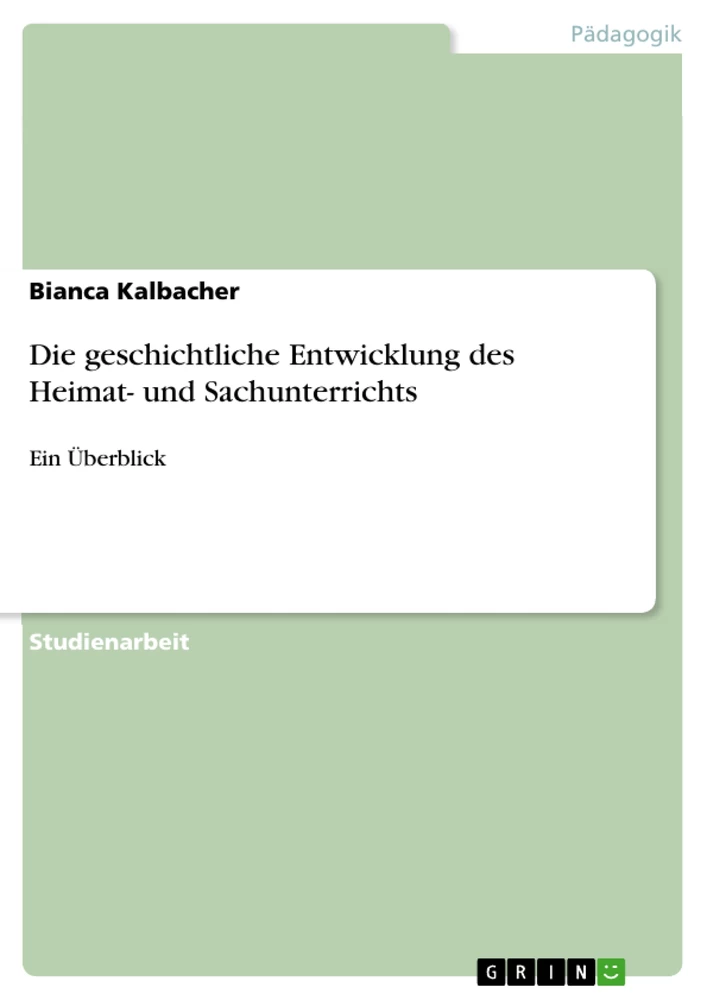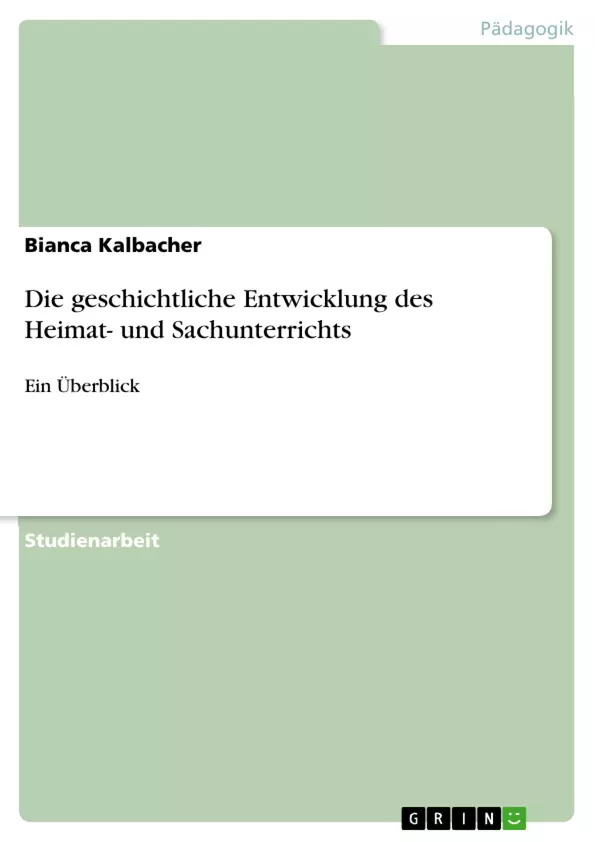Der Sachunterricht ist eines der jüngsten Fächer der Grundschule. Durch den Sachunterricht sollen die Schüler erste Kontakte mit der Lebensumwelt und Zusammenhänge in der Natur, der Technik, Biologie, Geschichte und sonstigen Natur- und Sozialwissenschaftlichen Fächern erschließen und erfahren.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklung des Sachunterrichts mit Hilfe geschichtlicher Hintergründe auf zu zeigen. Da der Sachunterricht in seiner Entwicklung mehrere Konzeptionen und Ansätze durchlaufen hat, setzt die Arbeit ihren Schwerpunkt darin, diese Zusammenhänge zwischen der Geschichte und dem Sachunterricht zu strukturieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Gang der Untersuchung
- Der Realienunterricht (ca. 1700-1900)
- Die Heimatkunde (ca. 1816-1966)
- Heimatkunde vor dem zweiten Weltkrieg
- Ideologisierte Heimatkunde in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945)
- Heimatkunde der Nachkriegszeit in der BRD
- Heimatkunde der Nachkriegszeit in der DDR
- Der wissenschaftsorientierte Sachunterricht (1969-1971)
- Der offene und integrative Sachunterricht der 70er Jahre
- Science 5/13 ein Vorreiter des offenen Unterrichts
- Mehrperspektivität im integrativen Sachunterricht
- Entwicklungstendenz des Sachunterrichts ab 1979
- Der exemplarisch-genetisch-sokratische Sachunterricht
- Rahmenbedingungen der Entwicklung des Sachunterrichts
- Die politische Praxis des Sachunterrichts
- Die schulische Praxis des Sachunterrichts
- Die wissenschaftliche Praxis des Sachunterrichts
- Kritische Betrachtung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Heimat- und Sachunterrichts" verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Sachunterrichts anhand historischer Hintergründe aufzuzeigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Strukturierung der Zusammenhänge zwischen der Geschichte und dem Sachunterricht, der verschiedene Konzeptionen und Ansätze durchlaufen hat. Die Arbeit soll verdeutlichen, wie sich die verschiedenen Konzeptionen auf den Unterricht ausgewirkt haben.
- Die Entwicklung des Sachunterrichts im Kontext historischer und gesellschaftlicher Veränderungen
- Die Einflussfaktoren auf die Konzeptionen und Schwerpunkte des Sachunterrichts
- Die Auswirkungen der verschiedenen Konzeptionen auf die Lernleistung der Schüler
- Die Bedeutung der Anschauung und des handlungsorientierten Lernens im Sachunterricht
- Die Rolle des Sachunterrichts im Hinblick auf die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Werten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Gang der Untersuchung erläutert. Anschließend werden die verschiedenen Grundformen des Sachunterrichts vorgestellt, beginnend mit dem Realienunterricht (ca. 1700-1900). Im Kapitel über die Heimatkunde (ca. 1816-1966) werden die verschiedenen Phasen der Heimatkunde beleuchtet, einschließlich der ideologisierten Heimatkunde in der Zeit des Nationalsozialismus und der Heimatkunde in der Nachkriegszeit in der BRD und DDR. Es folgt ein Kapitel über den wissenschaftsorientierten Sachunterricht (1969-1971) und ein weiteres über den offenen und integrativen Sachunterricht der 70er Jahre. Das Kapitel über die Entwicklungstendenz des Sachunterrichts ab 1979 behandelt den exemplarisch-genetisch-sokratischen Sachunterricht und die Rahmenbedingungen der Entwicklung des Sachunterrichts, einschließlich der politischen, schulischen und wissenschaftlichen Praxis. Die Arbeit endet mit einer kritischen Betrachtung und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Sachunterricht, Heimatkunde, Realienunterricht, Anschauungsunterricht, Wissenschaftsorientierung, Offener Unterricht, Integrativer Unterricht, Exemplarisch-genetisch-sokratischer Unterricht, Rahmenbedingungen, Politische Praxis, Schulische Praxis, Wissenschaftliche Praxis, Lernleistung, Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Seit wann gibt es den Realienunterricht?
Der Realienunterricht als Vorläufer des heutigen Sachunterrichts entwickelte sich im Zeitraum von ca. 1700 bis 1900.
Wie veränderte sich die Heimatkunde während des Nationalsozialismus?
Zwischen 1933 und 1945 wurde die Heimatkunde stark ideologisiert und für die Zwecke des NS-Regimes instrumentalisiert.
Was war das Ziel des wissenschaftsorientierten Sachunterrichts um 1970?
Ziel war es, Schülern wissenschaftliche Denkweisen und Zusammenhänge in Natur und Technik näherzubringen.
Was versteht man unter dem integrativen Sachunterricht der 70er Jahre?
Es handelt sich um einen mehrperspektivischen Ansatz, der verschiedene Natur- und Sozialwissenschaften im Unterricht vereint.
Welche Bedeutung hat das handlungsorientierte Lernen in diesem Fach?
Anschauung und eigenes Handeln sind zentral, damit Schüler ihre Lebensumwelt aktiv erschließen können.
- Arbeit zitieren
- Bianca Kalbacher (Autor:in), 2014, Die geschichtliche Entwicklung des Heimat- und Sachunterrichts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352472