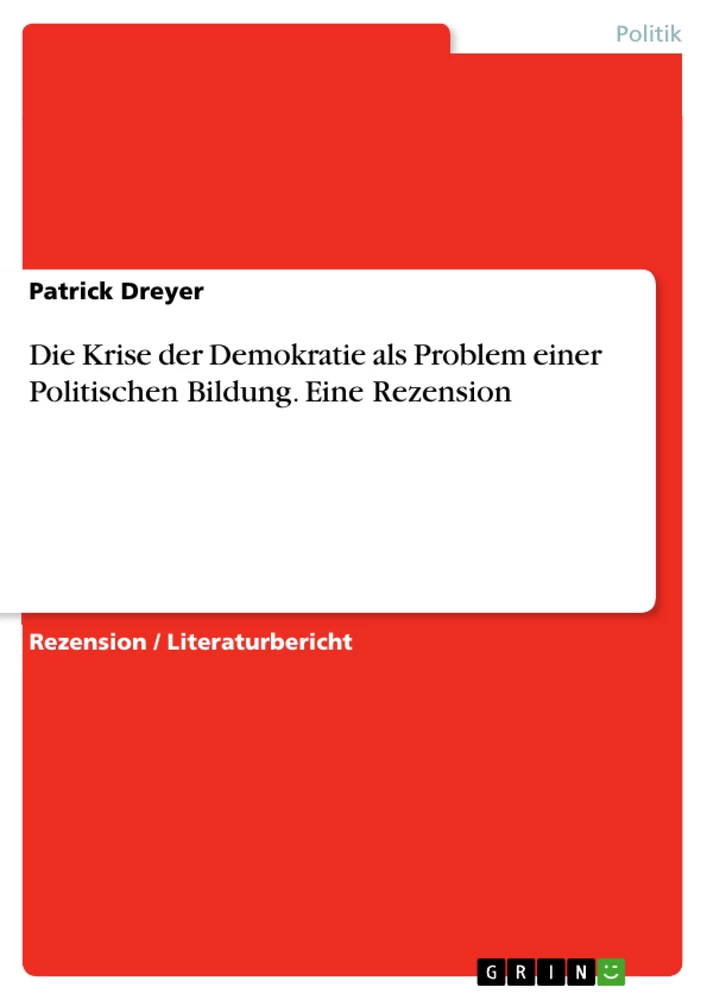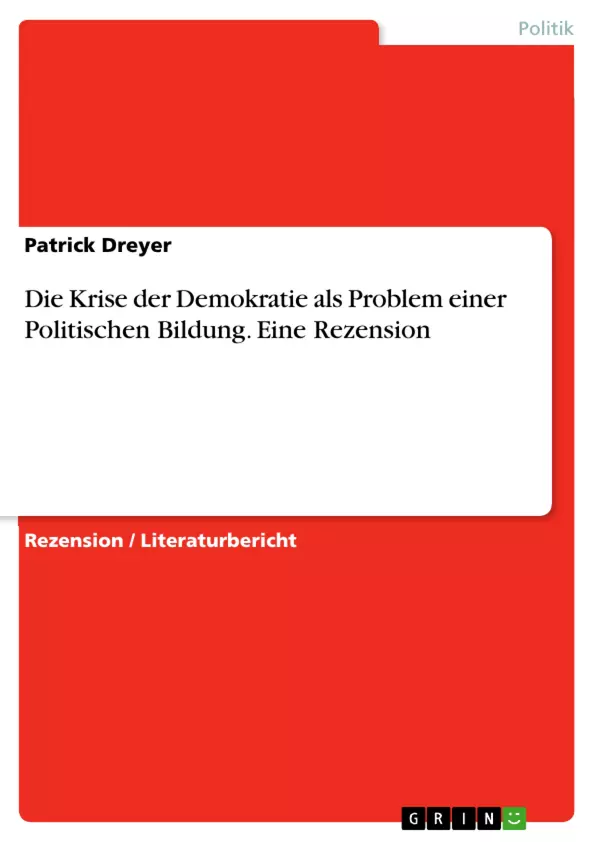Eine Rezension über David Salomons „Die Krise der Demokratie als Problem einer Politischen Bildung“.
Es wird kurz der Inhalt des Textes zusammengefasst, um diesen dann zu rezensieren und ein Fazit zu geben.
Aus dem Inhalt:
- Aufbau;
- Ausgangspunkt und Fragestellung
Eine Rezension über:
David Salomon: Die Krise der Demokratie als Problem einer Politischen Bildung In: Jahrbuch für Pädagogik 2013: Krisendiskurse. Hg. v.: David Salomon u. Edgar Weiß. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 2014, S. 69 - 90.
Aufbau: Der Beitrag von David Salomon über die Krise der Demokratie als Problem der Politischen Bildung, umfasst drei Teile. Einleitend stellt Salomon kurz den Konflikt zwischen Demokratie und Kapitalismus dar, anhand von zahlreichen Überlegungen, die sich sowohl der Politik, als auch der Ökonomie widmen. Im zweiten Teil des Beitrags, befasst er sich mit demokratietheoretischen Krisendiskursen, die er daraufhin in Bezug zur Politikdidaktik setzt.
Ausgangspunkt und Fragestellung.
Einleitend geht Salomon in dem Kapitel „Demokratie und Kapitalismus“ kurz auf den gegenwärtigen Stand des demokratietheoretischen Diskurses über die Ambivalenz von Demokratie und Kapitalismus ein. Dabei bezieht er sich auf diverse Überlegungen, welche gemäß der aktuellen Diskussionen über postdemokratische Verhältnisse, tendenziell die Konstruktion einer sozialen Demokratie fordern. Trotz etwaiger Konkurrenz zwischen ökonomischen und demokratietheoretischen Vorstellungen, betont er die Notwendigkeit eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen den demokratischen Gleichheitsgedanken individueller Subjekte und dem ökonomischen Leitwert der bestmöglichen Zufriedenstellung von Wirtschaftssubjekten, bei maximaler Effizienz (69). Denn insbesondere der Aspekt der Rechtsgleichheit unter der Prämisse des Schutzes von Eigentum, benötigt laut Salomon eine permanente kritische Auseinandersetzung der philosophischen Definitionen von Freiheit und Gleichheit, insbesondere in Hinsicht auf supranationale Strukturen (70). Weiterführend beschreibt er, dass Konzeptionen einer sozialen Demokratie wiederum diese Spannung nicht vorsehen und die politische Sphäre klar bestimmend über die ökonomische stellen. Mit Bezug auf Jürgen Habermas etabliert Salomon die Prozesshaftigkeit der Demokratie in diesem Text und macht deutlich, wie wichtig diese Eigenschaft aus didaktischer Sicht und hinsichtlich der politischen Bildung ist. Denn ein zentraler Punkt der politischen Bildung sei es, das „Interesse an der Gestaltung der Welt“ an die Heranwachsenden zu vermitteln (71). Anhand der diversen Verweise auf Überlegungen im politikwissenschaftlichen Kontext, gelingt es Salomon mit diesem einleitenden Kapitel, pragmatisch die demokratietheoretische Krisendiskussion, insbesondere mit dem Verweis auf Demokratie und Kapitalismus, darzustellen. Besonders treffend ist diese Einleitung im Hinblick auf den Übergang zwischen demokratietheoretischen Diskursen und der Herausforderung diese in eine bildungstheoretische Beziehung zu setzen.
Das zweite Kapitel fasst drei, gegenwärtig am Häufigsten diskutierte Krisen der Demokratietheorie, zusammen. Salomon beginnt mit der Diagnose einer „Postnationalen Konstellation“ (71) und erläutert zunächst den Stellenwert einer kosmopolitischen Perspektive auf demokratische Gesellschaften. Diese wurden laut Salomon bisher nur auf nationalstaatlicher Ebene analysiert, was jedoch der zeitgenössischen Konstellation und den Beziehungen der Staaten, bedingt durch die Globalisierung, nicht mehr gerecht wird. Um den supranationalen Herausforderungen entgegen zu steuern, sei es wichtig „rechtliche Formen zu entwickeln, die demokratische Teilhabe auch in einer „Weltgesellschaft“ verbürgen“ (72). Weiter geht er darauf ein, dass für die Etablierung weltbürgerlicher Rechtsverhältnisse oder einer internationalen sozialen Demokratie, Streit bzw. Auseinandersetzungen, ebenso wichtig für ein demokratisches Denken seien.
Daran anschließend geht Salomon auf die zweite wesentliche Krise, die er „Die Krise der Demokratie als Bestandteil einer „postpolitischen Konstellation““ (72) benennt ein. In diesem Abschnitt macht Salomon vornehmlich auf die Polysemie des Begriffs Demokratie aufmerksam und verweist auf die unterschiedlichen Interpretationen, die zum Teil strikte Gegensätze darstellen. Der Terminus Demokratie kann als eine Konzeption des öffentlichen Rechts, also eine Verfassung interpretiert werden, jedoch auch die Praktiken zur Verwaltung, in Bezug auf die Regierung, meinen. Auch Eigenschaften der Demokratie werden ambivalent dargestellt, wie zum Beispiel das Verhältnis zwischen Dynamik und Statik eines demokratisch politischen Systems. Wie bereits im ersten Abschnitt zeigt Salomon mit seinen Ausführungen deutlich, dass Demokratie den kritischen und diskursfreudigen Charakter nicht verlieren darf, denn nur so kann diese funktionieren. Dabei nimmt er abermals Habermas Überlegungen auf, welcher von einer „Neutralisierung des Politischen“ (73) spricht, wenn die Freund-Feind Relation davon bedroht ist nivelliert zu werden.
Mit diesem Argument leitet er treffend zur postdemokratischen Konstellation über, welche den dritten und letzten Punkt in seinen Ausführungen über die demokratietheoretischen Krisendiskurse darstellt. Zunächst geht Salomon in diesem Abschnitt auf den, von Colin Crouch etablierten Begriff der Postdemokratie ein und erweitert diese Überlegungen anhand von Ingolfur Blühdorns Ausführungen der simulativen Demokratie. Im Wesentlichen greift Salomon den postdemokratischen Gedanken auf, um darauf hinzuweisen, dass das politische Subjekt immer weniger Einfluss auf die Trennung von kapitalistischer Ökonomie und demokratischer Politik nehmen kann. Anhand von empirischen Analysen wird deutlich, dass Wahlbeteiligung tendenziell sinkt, aber der Drang nach direkter Demokratie, zum Beispiel durch Volksentscheide, steigt. Salomon weist in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hin, dass „demokratiepolitische Resignation“ (74) keineswegs der richtige Weg zur Lösung des Disputs sei, sondern es eine soziale Bewegung benötige, die das Potential inkludiert Partizipationsmöglichkeiten zu nutzen. Jene Mobilisierung gilt es mit einer demokratischen Grundeinstellung in die politische Bildung zu übersetzen.
Im Kapitel „Postedemokratie und (Politische) Bildung“, nimmt er den oben genannten Grundgedanken auf und weist zunächst darauf hin, dass die Fachdidaktik bis Dato zu wenig wissenschaftlich fundierte Konzeptionen hervor gebracht hat, die dem aktuellen demokratischen Gemeinwesen gerecht werden. Aus bildungspolitischer Perspektive, sei Bildung aktuell eher ein Gut, dass es zu messen und fördern gilt, um am internationalen Wettbewerb auch zukünftig teilhaben zu können. Der Begriff des sogenannten Humankapitals fasst die ökonomische Denkweise passend zusammen und zeigt den Fokus auf die Mess- und Vergleichbarkeit im Zuge von Diagnosen über Bildungsprozesse. Motiviert durch den PISA Schock, wurden viele Strukturen im Bildungswesen grundlegend geändert, wie zum Beispiel im Bereich der Hochschulen im Rahmen des Bologna Prozesses. Dadurch macht Salomon deutlich, wie selbst das ganzheitliche Ideal Humbolds innerhalb der Universitäten unter dem Effizienzzwang auf dem Arbeitsmarkt gelitten hat. Alarmierend dabei ist auch, dass die Freiheit des Bürgers im Zuge dessen, tendenziell abnimmt, die Abhängigkeit vom Markt steigt und dieser die Aufgabenstellung der Fachdidaktik diktiert.
Es benötige eine Zurückbesinnung auf demokratische Grundideen im Bereich der politischen Bildung und ein „dezidiert emanzipatorischer Ansatz“, in Zeiten einer postdemokratischen Konstellation. Dies führt er folgend ausführlich aus, in dem er folgende Aspekte genauer darstellt, um eine grobe Herangehensweise an die Problematik zu bieten.
Zunächst macht er darauf aufmerksam, dass viele etwaige Probleme der zeitgenössischen Gegebenheiten, in gewisser Form nicht neu sind. Dementsprechend schlägt Salomon einen intensiven Blick auf die Lehren der Vergangenheit vor und macht deutlich, dass im Diskurs über Demokratie und Bildung immer wieder Fragen gestellt werden müssen, die den Anspruch klassischer demokratischer Werte gerecht werden. Weiter beschreibt Salomon einen zwanghaften Diskurs über Politik außerhalb von politischen Institutionen, denn politische Bildung meint mehr als nur ein Fach in der Schule. Vielmehr ist politische Bildung eine notwendige Voraussetzung, um Schlüsselfunktionen einer demokratischen Gesellschaft zu verstehen bzw. diese mit gestalten zu können, aber auch um in einer Gesellschaft mit verschiedenen politischen Institutionen sozialisiert zu werden. Letztlich führt Salomon an, dass es eine gleichberechtige Aufteilung zwischen politischen und ökonomischen Inhalten innerhalb des Politikunterrichts geben sollte, da aktuell der ökonomische Teil des Unterrichtsinhalts überwiegt. Kapitalismus und Demokratie lassen sich zwangsläufig nicht vereinbaren, jedoch benötigt es eine adäquate Aufklärung in beiden Bereichen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in David Salomons Aufsatz "Die Krise der Demokratie als Problem einer Politischen Bildung"?
David Salomons Aufsatz untersucht die Krise der Demokratie im Kontext der politischen Bildung. Er analysiert den Konflikt zwischen Demokratie und Kapitalismus, diskutiert demokratietheoretische Krisendiskurse und setzt diese in Bezug zur Politikdidaktik.
Was sind die Hauptthemen des Aufsatzes?
Die Hauptthemen sind das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus, postnationale und postpolitische Konstellationen, die Krise der Demokratie in einer postdemokratischen Gesellschaft und die Rolle der politischen Bildung in diesem Kontext.
Was ist Salomons Ausgangspunkt für die Analyse?
Salomon geht von der Ambivalenz zwischen Demokratie und Kapitalismus aus und betont die Notwendigkeit eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen demokratischen Gleichheitsgedanken und ökonomischen Leitwerten. Er bezieht sich auf aktuelle Diskussionen über postdemokratische Verhältnisse und die Forderung nach einer sozialen Demokratie.
Welche demokratietheoretischen Krisen werden diskutiert?
Salomon diskutiert die Krise der Demokratie im Zusammenhang mit einer "postnationalen Konstellation", einer "postpolitischen Konstellation" und einer "postdemokratischen Konstellation". Er betont die Notwendigkeit, demokratische Teilhabe auch in einer "Weltgesellschaft" zu gewährleisten.
Was versteht Salomon unter "postdemokratischer Konstellation"?
Salomon bezieht sich auf den Begriff der Postdemokratie von Colin Crouch und die simulative Demokratie nach Ingolfur Blühdorn. Er argumentiert, dass das politische Subjekt immer weniger Einfluss auf die Trennung von kapitalistischer Ökonomie und demokratischer Politik nehmen kann.
Welche Rolle spielt die politische Bildung in der Auseinandersetzung mit der Krise der Demokratie?
Salomon betont die Notwendigkeit eines "dezidiert emanzipatorischen Ansatzes" in der politischen Bildung, um den Herausforderungen einer postdemokratischen Konstellation zu begegnen. Er fordert eine Rückbesinnung auf demokratische Grundideen und eine gleichberechtigte Aufteilung zwischen politischen und ökonomischen Inhalten im Politikunterricht.
Welche Kritik übt Salomon an der aktuellen Bildungspolitik?
Salomon kritisiert, dass Bildung aktuell eher als ein Gut zur Messung und Förderung im internationalen Wettbewerb betrachtet wird, was durch den Begriff des Humankapitals verdeutlicht wird. Er bemängelt, dass das ganzheitliche Ideal Humbolds unter dem Effizienzzwang auf dem Arbeitsmarkt leidet.
Welche Empfehlungen gibt Salomon für die politische Bildung?
Salomon empfiehlt einen intensiven Blick auf die Lehren der Vergangenheit, einen Diskurs über Politik außerhalb von politischen Institutionen und eine gleichberechtigte Aufteilung zwischen politischen und ökonomischen Inhalten im Politikunterricht.
- Quote paper
- Patrick Dreyer (Author), 2016, Die Krise der Demokratie als Problem einer Politischen Bildung. Eine Rezension, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352633