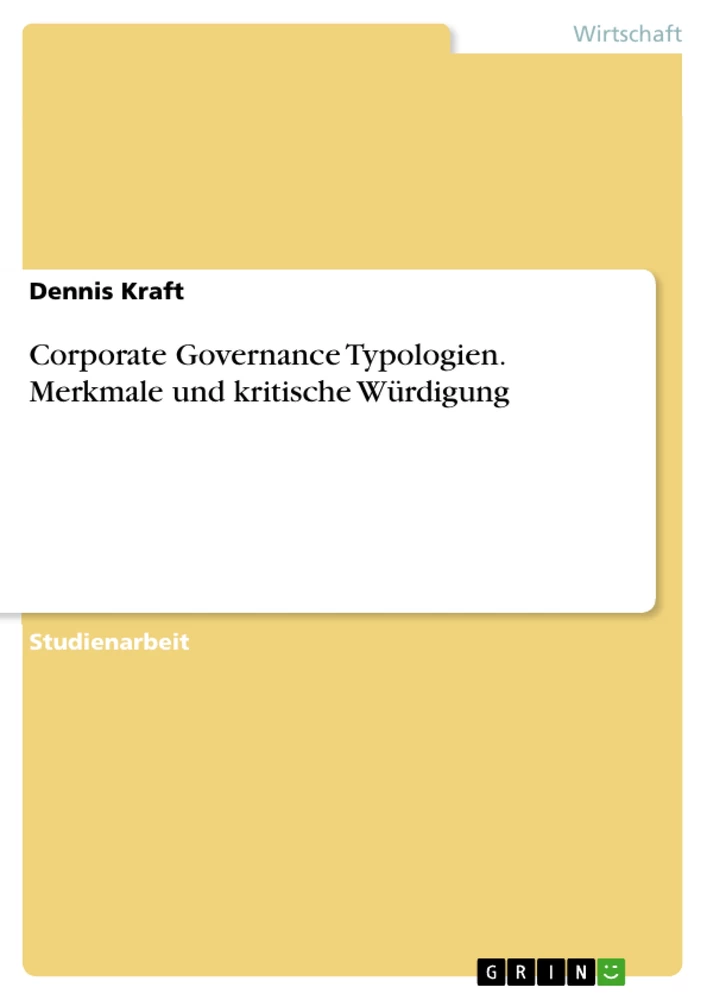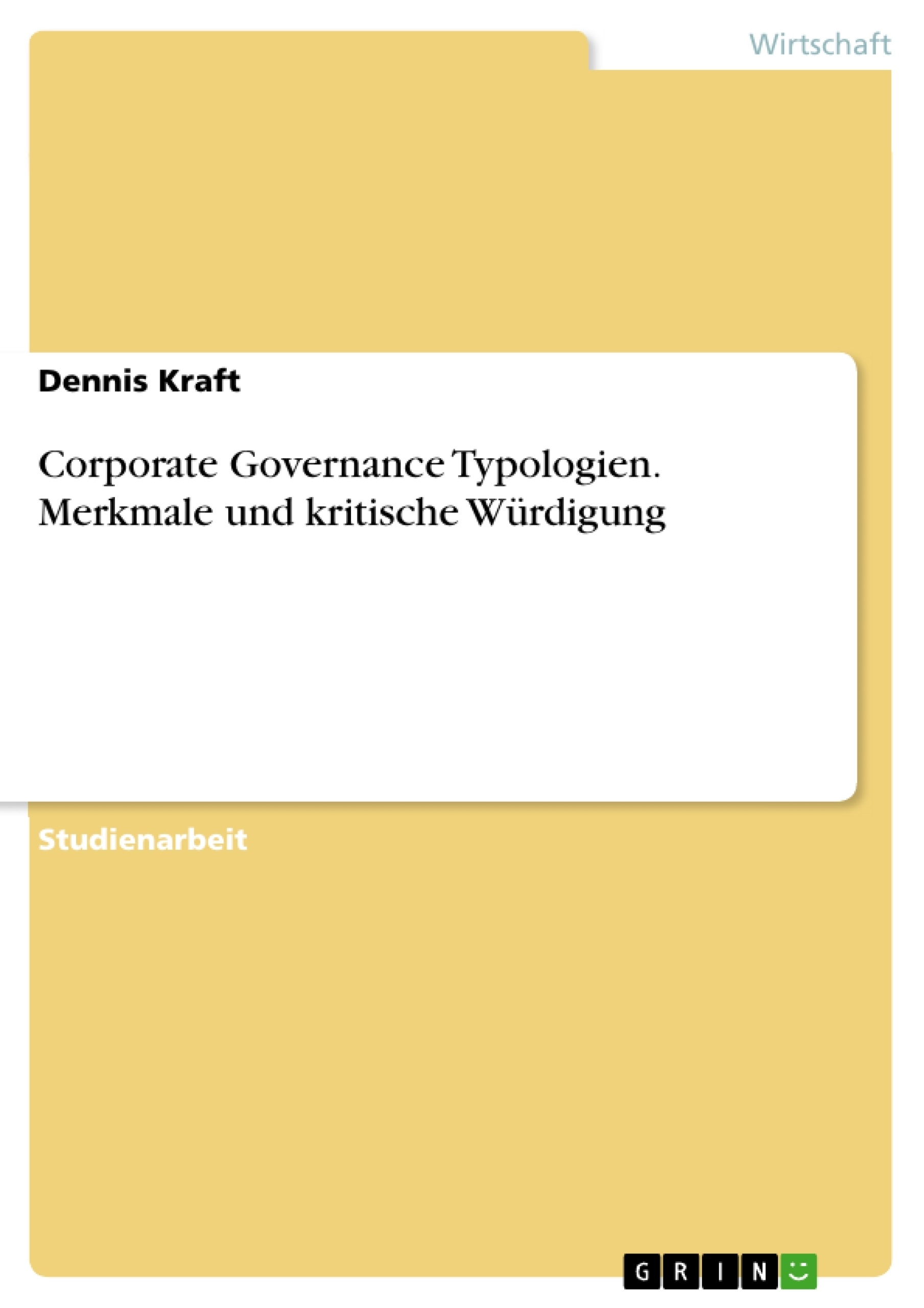Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Systematisierungsansätze von nationalstaatlichen CG-Systemen zu untersuchen. Dazu werden die wesentlichen in der betriebswirtschaftlichen Forschung und Praxis entwickelten Typologien vorgestellt. Hierbei wird insbesondere die von Weimer und Pape entwickelte Typologie untersucht sowie in kritischer Weise Stellung zu den dort aufgestellten Unterscheidungskriterien von CG-Systemen genommen.
In Kapitel 2 werden zunächst die Grundlagen zum Verständnis der Thematik gelegt. Hierzu werden insbesondere der Begriff Corporate Governance und die zentralen Aufgaben von CG erklärt. Anschließend wird kurz auf die relevanten Interessensgruppen (Stakeholder) eines Unternehmens eingegangen. In Kapitel 3 werden die wesentlichen in der Literatur zu findenden Systematisierungsansätze von CG-Systemen vorgestellt. Der Fokus liegt hier auf der von Weimer und Pape entwickelten Typologie, welche in Abschnitt 3.3 erläutert und kritisch betrachtet wird. Kapitel 4 bildet mit einer kritischen Reflexion den Abschluss dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einführung in das Thema..
- Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau dieser Arbeit
- Grundlagen
- Begriffserklärung und Aufgaben von Corporate Governance.
- Die Interessensgruppen eines Unternehmens.
- Systematisierung und Vergleich von Corporate Governance Systemen
- Interessensorientierte Ansätze.
- Fokussierung der Organisations- und Kontrollproblematik
- Varianten der Führungsorganisation .....
- Muster der Unternehmensfinanzierung.....
- Markt- versus netzwerkorientierte CG-Systeme nach Weimer / Pape.
- Erläuterung und Unterscheidungskriterien.……………………….
- Kritische Stellungnahme
- Zusammenfassung und kritische Reflexion.
- Quellenverzeichnis...
- Literaturverzeichnis .....
- Verzeichnis der Internetquellen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Systematisierung von nationalstaatlichen Corporate Governance (CG)-Systemen. Das Ziel ist es, verschiedene Ansätze zur Einteilung dieser Systeme zu untersuchen, wobei ein Fokus auf die Typologie von Weimer und Pape gelegt wird.
- Begriffserklärung und Aufgaben von CG
- Relevante Interessensgruppen von Unternehmen (Stakeholder)
- Systematisierung von CG-Systemen
- Die Typologie von Weimer und Pape
- Kritische Würdigung der Typologie von Weimer und Pape
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 legt die Grundlagen für das Verständnis von Corporate Governance. Hier wird der Begriff erläutert und die zentralen Aufgaben von CG beschrieben. Außerdem werden die wichtigsten Interessensgruppen eines Unternehmens vorgestellt.
Kapitel 3 präsentiert verschiedene Ansätze zur Systematisierung von CG-Systemen. Der Schwerpunkt liegt auf der Typologie von Weimer und Pape, die in Abschnitt 3.3 näher erläutert und kritisch betrachtet wird.
Schlüsselwörter (Keywords)
Corporate Governance, CG-Systeme, Typologie, Systematisierung, Weimer & Pape, Interessensgruppen, Stakeholder, Unternehmensführung, Kontrollmechanismen, Marktorientierung, Netzwerkorientierung, Kritik.
- Quote paper
- Dennis Kraft (Author), 2017, Corporate Governance Typologien. Merkmale und kritische Würdigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352646