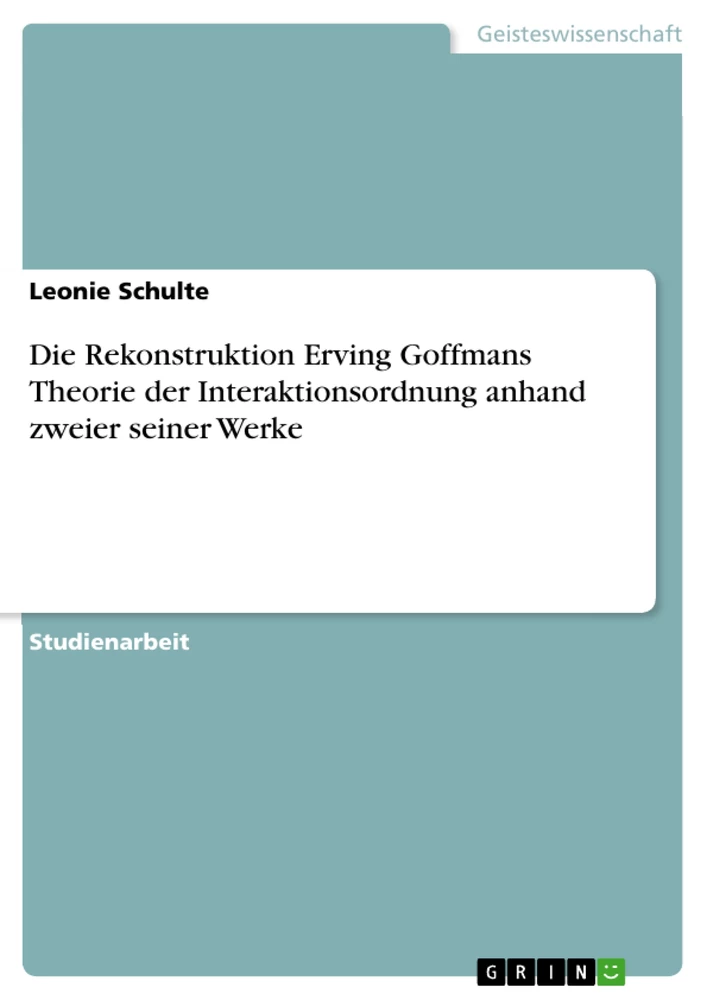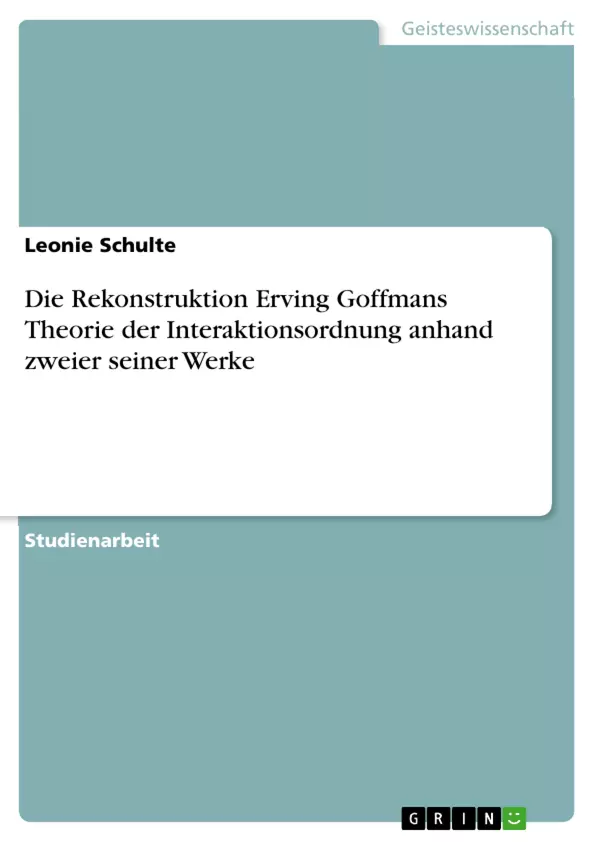Noch heute ist der Amerikaner Erving Goffman einer der bekanntesten und meist gelesenen Soziologen unserer Zeit. Schon immer galt er eher als ein Außenseiter in der Soziologie, „der sich mit den kuriosen Details des Alltags befasst“. Er war bekannt dafür, selbst die kleinsten und schwierigsten Details und Ereignisse so darzustellen, dass sie jeder nachvollziehen konnte. Da er sich in allen seinen Werk eher auf den Mikrokosmos bezog, und nicht, wie andere Soziologen, die Dinge aus der Makro-Perspektive betrachtete, wurde seine Arbeit oftmals nicht so hoch angesehen wie die seiner Kollegen.
Der Grundstein seiner Arbeiten war stets das Erforschen des Regelwerks sozialer Interaktionen. Er wollte herausfinden, wie die alltägliche Interaktion zwischen Menschen in einer so harmonischen Art und Weise funktionieren kann. Dabei gelang es ihm, bestimmte Regeln für „face to face-Situationen“ aufzustellen. Er kreierte eine Interaktionsordnung, die bei face to face-Interaktionen als Rahmen von Handlungen genutzt werden konnte. Nach Hettlage definiert Goffman diese Kommunikation als eine solche, bei der mindesten zwei Personen sowohl physisch als auch psychisch in der gleichen „sozialen Situation“ anwesend sind. Voraussetzung für diese Interaktion ist zudem, dass die anwesenden Personen so weit in Kontakt zueinander stehen, sodass sie sich gegenseitig wahrnehmen können. Ein Zusammenkommen zweier Personen kann dabei zu einem intensiven Austausch von Informationen führen, aber auch Risiken beinhalten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Wir alle spielen Theater- eine Selbstdarstellung im Alltag
- 2.1. Das Ensemble
- 2.2. Das Mehr-Ensemble-Modell
- 2.3. Die verschiedenen Rollen eines Ensembles
- 2.3.1. Der Regisseur
- 2.3.2. Der Hauptdarsteller
- 2.3.3. Die übrigen Ensemblemitglieder
- 3. Interaktionsrituale - Über Verhalten in direkter Kommunikation
- 3.1. Das Image
- 3.2. Falsches Image - kein Image
- 3.3. Selbstachtung und Rücksichtnahme
- 3.4. Techniken der Imagepflege
- 3.4.1. Der Vermeidungsprozess
- 3.4.2. Der korrektive Prozess
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit Erving Goffmans Theorie der Interaktionsordnung, einem wichtigen Konzept in der Soziologie, das die Regeln und Muster des menschlichen Verhaltens in sozialen Situationen beleuchtet. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Kernaussagen von Goffmans Theorie anhand zweier seiner Werke zu rekonstruieren und zu erläutern.
- Die Bedeutung der Selbstdarstellung im Alltag
- Die Rolle von Interaktionsritualen in der sozialen Ordnung
- Die Analyse von "face to face"-Situationen und deren Struktur
- Die Rekonstruktion von Goffmans Konzept der "Interaktionsordnung"
- Die Anwendung von Goffmans Theorien auf konkrete Beispiele aus dem Alltag
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den Soziologen Erving Goffman sowie seine Theorie der Interaktionsordnung vor. Sie erläutert die Relevanz von Goffmans Werk und beleuchtet die Bedeutung des Mikrokosmos in der Sozialen Welt.
Kapitel 2 befasst sich mit dem ersten Werk Goffmans "Wir alle spielen Theater" und analysiert die Struktur der Selbstdarstellung im Alltag. Es wird erläutert, wie Individuen in sozialen Interaktionen versuchen, ein bestimmtes Bild von sich zu präsentieren und wie dieses durch das Ensemble und Mehr-Ensemble-Modell funktioniert.
Kapitel 3 behandelt das Thema der Interaktionsrituale und zeigt, wie Verhalten in direkter Kommunikation durch Regeln und Muster strukturiert ist. Es wird erläutert, wie das Image im sozialen Miteinander gepflegt wird und welche Techniken der Imagepflege zur Anwendung kommen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Erving Goffman, Interaktionsordnung, Selbstdarstellung, "Wir alle spielen Theater", Interaktionsrituale, Image, face to face-Situationen, Mikrokosmos, Soziales Verhalten, Soziologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Erving Goffmans „Interaktionsordnung“?
Es ist ein soziologisches Konzept, das die ungeschriebenen Regeln und Muster beschreibt, nach denen Menschen in direkten „face to face“-Situationen miteinander interagieren.
Was bedeutet die Metapher „Wir alle spielen Theater“?
Goffman vergleicht das soziale Leben mit einer Theateraufführung, bei der Individuen (Darsteller) versuchen, vor anderen (Publikum) ein bestimmtes Bild von sich selbst zu präsentieren.
Was versteht Goffman unter dem Begriff „Image“ (Face)?
Das Image ist der positive soziale Wert, den eine Person für sich selbst beansprucht. In Interaktionen sind Menschen bestrebt, ihr eigenes „Gesicht“ und das der anderen zu wahren.
Welche Techniken der Imagepflege gibt es?
Goffman unterscheidet unter anderem den Vermeidungsprozess (potenziell peinliche Situationen umgehen) und den korrektiven Prozess (Wiedergutmachung nach einem Imageverlust).
Warum wird Goffman oft als Erforscher des Mikrokosmos bezeichnet?
Im Gegensatz zu Makro-Soziologen konzentrierte er sich auf die kleinsten Details des Alltags und die unmittelbare Kommunikation zwischen anwesenden Personen.
Was ist ein „Interaktionsritual“?
Es sind standardisierte Verhaltensweisen in der Kommunikation, die dazu dienen, soziale Situationen harmonisch zu gestalten und gegenseitige Anerkennung zu signalisieren.
- Arbeit zitieren
- Leonie Schulte (Autor:in), 2016, Die Rekonstruktion Erving Goffmans Theorie der Interaktionsordnung anhand zweier seiner Werke, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352708