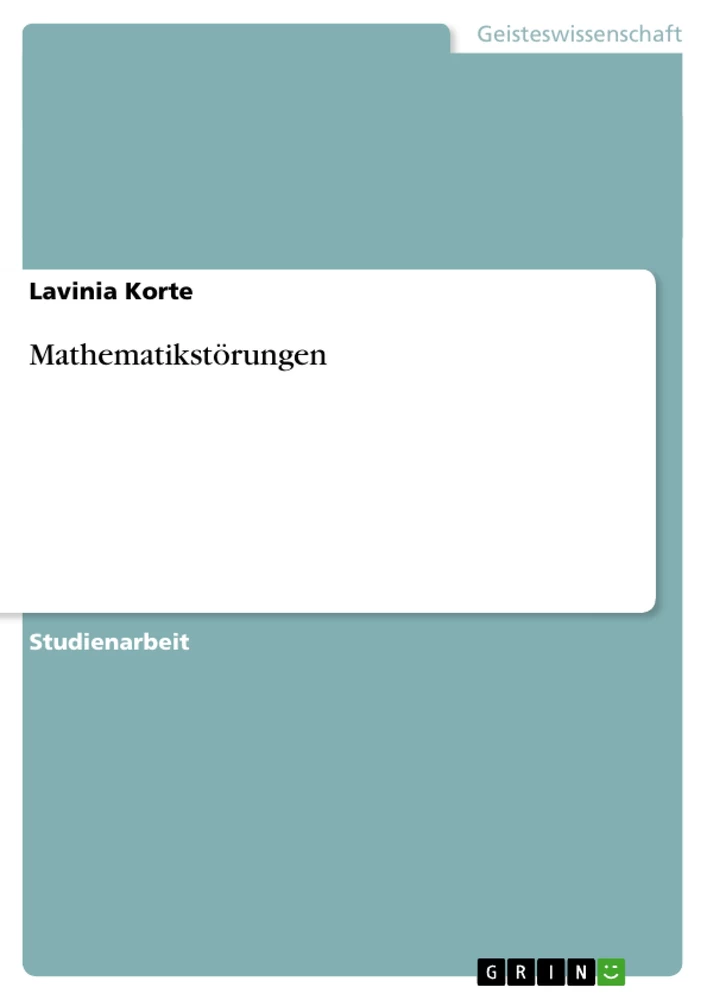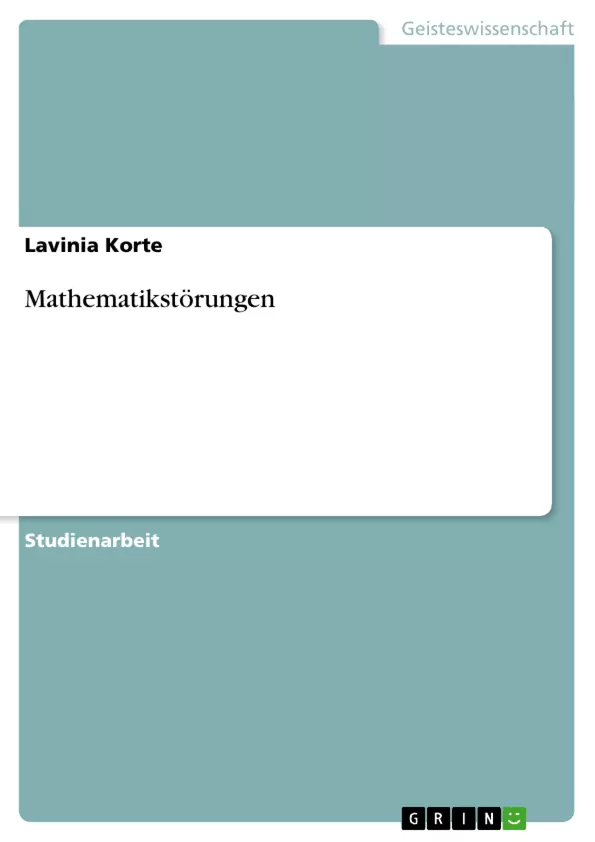Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Mathematikstörungen bei Schülerinnen und Schülern, das einen weniger erforschten und bekannten Bereich der Lernstörungen darstellt. Der Bereich der Mathematikstörungen ist weit weniger erforscht als beispielsweise der Bereich der Lese- Rechtschreibstörungen. Dies ist unter anderem auf einen bestehenden Mangel an Testverfahren zur Erkennung einer solchen Störung oder Schwäche zurückzuführen. Lorenz/ Radatz schreiben dazu in der Einleitung des von ihnen verfassten Bandes „Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht: „Dies deutet darauf hin, dass die Erfassung einer Lernstörung in Mathematik Schwierigkeiten bereitet. Sie ist in geringerem Maße isolierbar. Ein schlechter Leistungstest ermöglicht es noch nicht, einen Schüler als rechenschwach einzustufen, und Förderhinweise lassen sich aus dem Testergebnis schon gar nicht ableiten.“
Es mangelt außerdem an ausreichender Fachliteratur zum Thema, so dass es für viele Interessierte und Betroffene schwer erscheinen mag, sich ein gewisses theoretisches Wissen über diesen Themenbereich anzueignen. Die im Gegensatz zur Legasthenie eher dürftige Forschung zu diesem Bereich der Lernstörungen trägt zu der mangelnden Kenntnis des Gebietes bei. Lorenz / Radatz geben weitere Gründe für den Mangel an Forschungsergebnissen über Mathematikstörungen an: Sie geben zu bedenken, dass eine geringe Leistung im Mathematikunterricht nicht eine solch immense gesellschaftspolitische Rolle spielt; die Folgen, die bei einer solchen Störung entstehen, sind scheinbar geringer.
Das Thema der Benennung dieses Gebietes der Lernstörungen erscheint ebenso problematisch und verwirrend. Häufig ist die Rede von einer „Rechenstörung“, was sich insofern als problematisch herausstellt, als dass bei diesem Bergriff der Teilbereich der Geometrie außer Acht gelassen wird, der ja einen immensen Teil der Inhalte des Mathematikunterrichts ausmacht. Schüler, die in diesem Bereich Auffälligkeiten zeigen, zeigen oft vollkommen andere Defizite als jene, die Schwierigkeiten beim Rechnen haben, weil vollkommen andere Bereiche angesprochen werden, wie zum Beispiel das räumliche Sehen. Auf diesen Punkt soll später eingegangen werden.
Es ist also vor allem zu beachten, welche Fähigkeiten bei bestimmten mathematischen Aufgaben und Inhalten angesprochen sind, um zu erkennen, wo die individuelle Schwäche des Schülers liegt. Die individuelle Fehleranalyse ist demnach unabdingbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erscheinungsformen von Mathematikstörungen in den Phasen des mathematischen Unterrichts
- Fehler im Zusammenhang mit dem Verständnis von Sprache und Symbolik
- Störungen des abstrakten Denkens und ihre Auswirkungen
- Rechenfehler in der Automatisierungsphase
- Fehler bei erweiterten mathematischen Leistungen
- Zusammenfassung möglicher Ursachen von Mathematikstörungen
- Soziokulturelle/ familiäre Bedingungen
- Neurotisch- psychogene Bedingungen
- Impulsivität als Bedingung für Lernstörungen
- Prävention und Intervention bei Mathematikstörungen
- Die Lernausgangslage und allgemeine Prävention
- Spezielle Intervention durch Förderung visueller Fähigkeiten
- Die Förderung der Gedächtnisleistung
- Die Förderung von Konzentration und Aufmerksamkeit
- Abschließende Worte zu Mathematikstörungen und deren Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Mathematikstörungen bei Schülerinnen und Schülern, einem Bereich der Lernstörungen, der weniger erforscht ist als beispielsweise der Bereich der Lese- Rechtschreibstörungen. Die Arbeit soll die Erscheinungsformen, Ursachen und Auswirkungen von Mathematikstörungen beleuchten, sowie spezifische Präventions- und Interventionsstrategien vorstellen.
- Erscheinungsformen von Mathematikstörungen in verschiedenen Phasen des Mathematikunterrichts
- Mögliche Ursachen von Mathematikstörungen, wie soziokulturelle/familiäre Bedingungen, neurotisch-psychogene Faktoren und Impulsivität
- Bedeutung der individuellen Fehleranalyse für die Diagnose und Intervention
- Präventions- und Interventionsstrategien für Mathematikstörungen, einschließlich der Förderung visueller Fähigkeiten, der Gedächtnisleistung und von Konzentration und Aufmerksamkeit
- Herausforderungen und wichtige Aspekte der Forschung und Praxis im Bereich von Mathematikstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit beleuchtet die Problematik der Definition und Erforschung von Mathematikstörungen und stellt die Relevanz des Themas heraus. Das erste Kapitel analysiert die Erscheinungsformen von Mathematikstörungen in verschiedenen Phasen des Mathematikunterrichts, beginnend mit Schwierigkeiten im Verständnis von Sprache und Symbolik bis hin zu Fehlern bei komplexeren mathematischen Aufgaben. Das zweite Kapitel befasst sich mit möglichen Ursachen von Mathematikstörungen, darunter soziokulturelle/familiäre Bedingungen, neurotisch-psychogene Faktoren und Impulsivität. Schließlich behandelt das dritte Kapitel Präventions- und Interventionsstrategien für Mathematikstörungen, wobei die Förderung visueller Fähigkeiten, der Gedächtnisleistung sowie von Konzentration und Aufmerksamkeit im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Mathematikstörungen, Dyskalkulie, Lernstörungen, Rechenstörungen, Sprachverständnis, Symbolverständnis, abstraktes Denken, Rechenfehler, Ursachen, soziokulturelle Bedingungen, neurotisch-psychogene Bedingungen, Impulsivität, Prävention, Intervention, visuelle Fähigkeiten, Gedächtnisleistung, Konzentration, Aufmerksamkeit, Fehleranalyse, individuelle Förderung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Mathematikstörungen weniger erforscht als Legasthenie?
Dies liegt an einem Mangel an Testverfahren, weniger Fachliteratur und der Wahrnehmung, dass Rechenschwäche eine geringere gesellschaftspolitische Rolle spielt als Leseschwäche.
Was ist der Unterschied zwischen Rechenstörung und Mathematikstörung?
Der Begriff „Rechenstörung“ vernachlässigt oft die Geometrie. Eine Mathematikstörung umfasst auch Defizite im räumlichen Sehen und abstrakten Denken.
Welche Ursachen können Mathematikstörungen haben?
Mögliche Ursachen sind soziokulturelle oder familiäre Bedingungen, neurotisch-psychogene Faktoren sowie individuelle Impulsivität.
Wie wichtig ist die Fehleranalyse bei Dyskalkulie?
Die individuelle Fehleranalyse ist unabdingbar, um zu verstehen, in welcher Phase (Verständnis, Automatisierung oder Abstraktion) die spezifischen Defizite des Schülers liegen.
Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es?
Fördermaßnahmen umfassen das Training visueller Fähigkeiten, die Steigerung der Gedächtnisleistung sowie die Förderung von Konzentration und Aufmerksamkeit.
- Arbeit zitieren
- Lavinia Korte (Autor:in), 2004, Mathematikstörungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35280