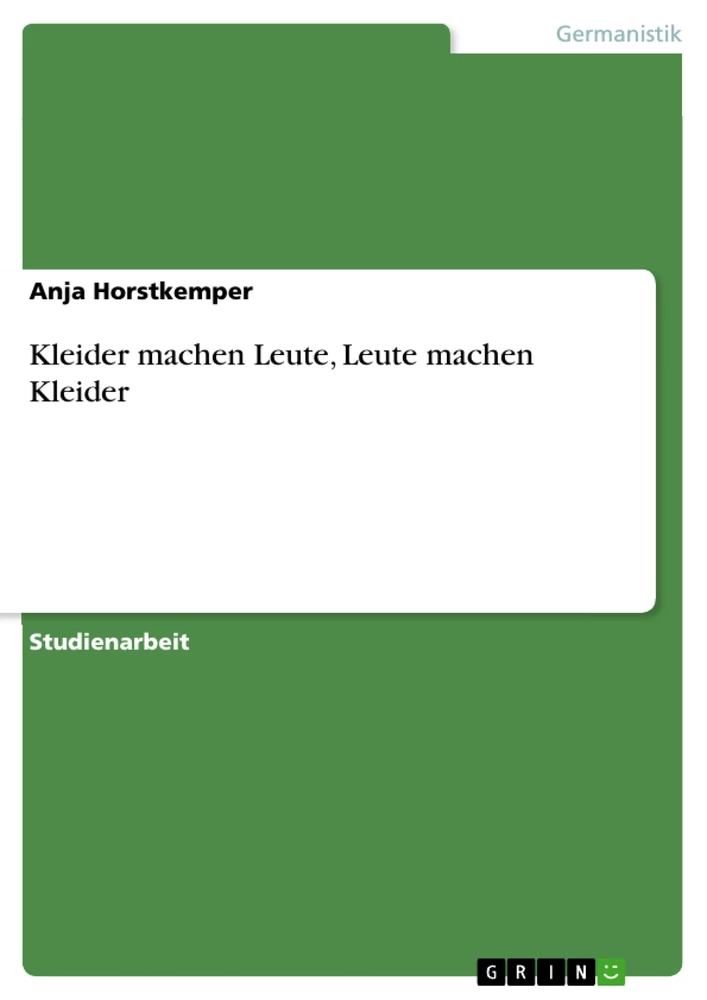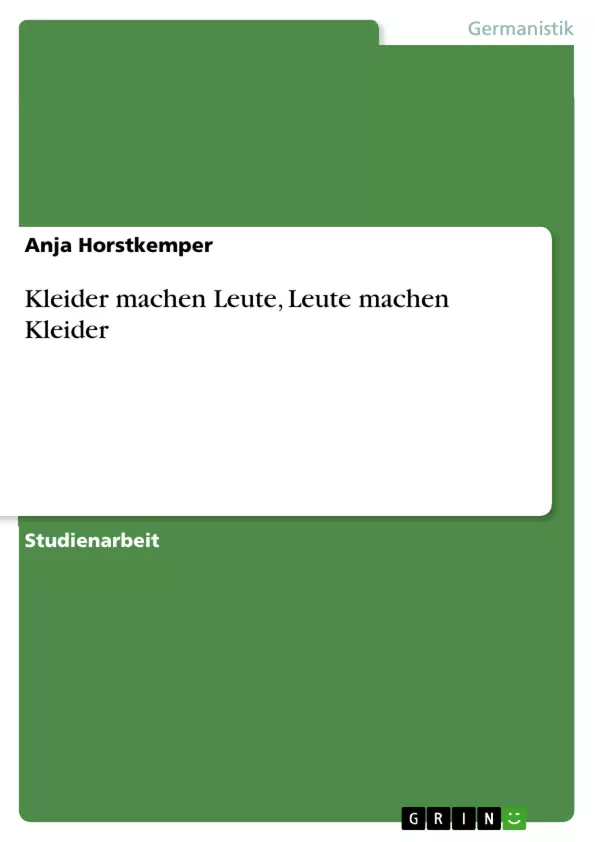Warum ausgerechnet ein Vergleich zwischen Gogol und Keller, zwischen zwei Erzählungen, die einem anfangs nicht unterschiedlicher erscheinen können? Aber um festzustellen, ob es nicht doch einige Parallelen zwischen den beiden Erzählungen gibt, soll im folgenden ein Vergleich zwischen „Kleider machen Leute und der Mantel“ angestellt werden, um die Eingangsfrage zu beantworten. Der Schwerpunkt dieses Vergleichs, soll auf den Protagonisten der Erzählungen liegen, und einerseits Charakterzüge, sowie ihren Bezug zu Kleidung und ihr äußerliches Erscheinungsbild darstellen. Dazu wird zunächst, um einen groben Überblick über die beiden Texte zu geben, jeweils eine Inhaltsangabe gegeben. Im folgenden werden dann die beiden Protagonisten Akakij Akakijewitsch Baschmatschkin und Wenzel Strapinski im Verlauf der jeweiligen Erzählung dargestellt. Dazu ist anzumerken, dass die Darstellung so gewählt wurde, weil beide Protagonisten mehreren Einschnitte in ihrem Leben ausgesetzt sind und somit auch einige Entwicklungsstufen durchlaufen. Anschließend wird ein zusammenfassendes Resumée der Hauptgemeinsamkeiten der Protagonisten und einiger Unterschiede gezogen, um auf die Eingangsfrage (Gibt es Gemeinsam-keiten?) zu antworten. Da in beiden Erzählungen, wie in den Titeln schon erwähnt Kleidung eine große Rolle spielt, wird explizit im vierten Teil der Hausarbeit auf ein Kleidungsstück eingegangen: Auf den Mantel. Der Vergleich zwischen Akakijewitschs und Strapinskis Mantel in Ausgangs- und in der Endsituation der Erzählungen soll zeigen, welche Probleme schöne Kleidung bringen kann, wenn man sie zum Lebensinhalt macht. Hierzu eignet sich das Mantelmotiv besonders gut, da eine Mantel nicht nur als Kleidungsstück, sondern auch als „Deckmantel“ benutzt werden kann. Abschließend, sollen die Ergebnisse noch einmal kurz aufgeführt werden, so wie einige Überlegungen, ob unter anderen Umständen die beiden Erzählungen anders ausgegangen wären. Als gedanklichen Anstoß ist noch ein Verweis auf einen Exkurs in die Sozialwissenschaft eingefügt, der teilweise erklärt, warum Mode und Kleidung eine so bedeutende Rolle für Menschen spielen kann. Die Einschränkung wird gemacht, weil es sich um eine sehr umstrittene und viel kritisierte Theorie handelt, die nicht eindeutig belegt oder widerlegt worden ist und bis heute brisant ist.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. „KLEIDER MACHEN LEUTE“ UND „DER MANTEL“
- 2.1 „KLEIDER MACHEN LEUTE“ – DER INHALT
- 2.2 „DER MANTEL“ – DER INHALT
- 3. DIE PROTAGONISTEN
- 3.1 DIE DARSTELLUNG VON AKAKIJ AKAKIJEWITSCH BASCHMATSCHKIN
- 3.2 DIE DARSTELLUNG VON WENZEL STRAPINSKI
- 3.3 ZWISCHENRESUMÉE
- 4. „DER MANTEL“ UND „KLEIDER MACHEN LEUTE“ IM VERGLEICH: DAS MANTELMOTIV
- 5. ABSCHLIEBENDE BETRACHTUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht Gottfried Kellers „Kleider machen Leute“ und Nikolai Gogols „Der Mantel“, um Parallelen zwischen den scheinbar unterschiedlichen Erzählungen aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf den Protagonisten, ihren Charakterzügen, ihrem Verhältnis zur Kleidung und ihrem äußeren Erscheinungsbild. Die Analyse betrachtet die Entwicklung der Protagonisten und die Rolle der Kleidung, insbesondere des Mantels, als zentrales Motiv.
- Der Einfluss von Kleidung und äußerem Erscheinungsbild auf die soziale Wahrnehmung
- Charakterentwicklung und Lebensumstände der Protagonisten
- Die Rolle des Mantels als symbolisches Element
- Vergleich der Erzählstrukturen und -techniken
- Soziale und gesellschaftliche Aspekte in beiden Erzählungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert die Zielsetzung des Vergleichs zwischen Kellers „Kleider machen Leute“ und Gogols „Der Mantel“. Sie begründet die Wahl dieser beiden scheinbar gegensätzlichen Erzählungen und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Der Schwerpunkt wird auf die Protagonisten gelegt, ihre Charaktere und ihr Verhältnis zu Kleidung, insbesondere das Mantelmotiv, werden detailliert untersucht. Es wird eine Inhaltsangabe beider Erzählungen gegeben, um einen Überblick zu schaffen und den weiteren Vergleich vorzubereiten. Die Einleitung deutet bereits die Bedeutung sozialwissenschaftlicher Aspekte an.
2. „Kleider machen Leute“ und „Der Mantel“: Dieses Kapitel liefert kurze Inhaltsangaben beider Erzählungen, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen „Kleider machen Leute“ und „Der Mantel“ aufzuzeigen, bevor in den folgenden Kapiteln eine detailliertere Analyse erfolgt. Es wird bereits angedeutet, dass das Motiv des Mantels in beiden Erzählungen eine zentrale Rolle spielt, welches in späteren Kapiteln im Detail beleuchtet wird.
2.1 „Kleider machen Leute“ – Der Inhalt: Diese Zusammenfassung beschreibt die Geschichte von Wenzel Strapinski, einem Schneider, der durch Zufall und seine gepflegte Erscheinung für einen Grafen gehalten wird. Er genießt die Vorteile dieser falschen Identität, verliebt sich in Nettchen und lebt für eine Zeit in Wohlstand. Die Täuschung wird jedoch aufgedeckt, woraufhin er flieht. Nettchens Loyalität rettet ihn, und sie beginnen ein neues Leben. Die Zusammenfassung hebt die Bedeutung von Zufall, Täuschung und der letztendlich positiven Auflösung der Geschichte hervor. Die Rolle der Kleidung als Mittel der Täuschung und des sozialen Aufstiegs wird hervorgehoben.
2.2 „Der Mantel“ - Der Inhalt: Die Zusammenfassung fasst die Geschichte von Akakij Akakijewitsch Baschmatschkin zusammen, einem armen und zurückgezogenen Beamten, dessen Leben von der Anschaffung eines neuen Mantels bestimmt wird. Seine Armut und sein unscheinbares Aussehen führen zu Ausgrenzung und Spott. Die Beschaffung und der Verlust des Mantels stellen einen Wendepunkt in seinem Leben dar, wobei die Zusammenfassung auf die Tragik seiner Situation und den symbolischen Charakter des Mantels hinweist. Die Isolation und die soziale Ungerechtigkeit, denen Baschmatschkin ausgesetzt ist, werden als zentrale Themen herausgestellt.
Häufig gestellte Fragen zu "Kleider machen Leute" und "Der Mantel"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht Gottfried Kellers "Kleider machen Leute" und Nikolai Gogols "Der Mantel". Der Fokus liegt auf den Protagonisten, ihren Charakteren, ihrem Verhältnis zur Kleidung und ihrem äußeren Erscheinungsbild. Die Analyse untersucht die Entwicklung der Protagonisten und die Rolle der Kleidung, insbesondere des Mantels, als zentrales Motiv.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss von Kleidung und äußerem Erscheinungsbild auf die soziale Wahrnehmung, die Charakterentwicklung und Lebensumstände der Protagonisten, die Rolle des Mantels als symbolisches Element, einen Vergleich der Erzählstrukturen und -techniken sowie soziale und gesellschaftliche Aspekte in beiden Erzählungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Inhaltsangaben beider Erzählungen, ein Kapitel zur Darstellung der Protagonisten (Baschmatschkin und Strapinski), ein Kapitel zum Vergleich beider Erzählungen mit Fokus auf das Mantelmotiv und abschließende Betrachtungen.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung erläutert die Zielsetzung des Vergleichs, begründet die Wahl der beiden Erzählungen und skizziert den methodischen Ansatz. Sie gibt einen kurzen Überblick über den Inhalt beider Erzählungen und deutet die Bedeutung sozialwissenschaftlicher Aspekte an.
Wie werden die Inhaltsangaben der Erzählungen präsentiert?
Kapitel 2 liefert kurze Inhaltsangaben von "Kleider machen Leute" und "Der Mantel", um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, bevor in den folgenden Kapiteln eine detailliertere Analyse erfolgt. Die Bedeutung des Mantelmotivs wird bereits angedeutet.
Wie werden die Protagonisten dargestellt?
Kapitel 3 analysiert die Darstellung von Akakij Akakijewitsch Baschmatschkin ("Der Mantel") und Wenzel Strapinski ("Kleider machen Leute"). Es wird ein Zwischenresümee eingefügt.
Welche Rolle spielt der Mantel?
Das Mantelmotiv wird als zentrales Element in beiden Erzählungen betrachtet. Es wird analysiert, wie der Mantel die soziale Wahrnehmung, die Charakterentwicklung und die Handlung beeinflusst. Kapitel 4 vergleicht explizit das Mantelmotiv in beiden Erzählungen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die abschließenden Betrachtungen fassen die Ergebnisse des Vergleichs zusammen und ziehen Schlussfolgerungen zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den beiden Erzählungen im Hinblick auf die behandelten Themen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Kleider machen Leute, Der Mantel, Gottfried Keller, Nikolai Gogol, Protagonist, Mantelmotiv, soziale Wahrnehmung, Charakterentwicklung, soziale Ungerechtigkeit, Erzähltechnik, Symbol.
- Citar trabajo
- Anja Horstkemper (Autor), 2001, Kleider machen Leute, Leute machen Kleider, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3529