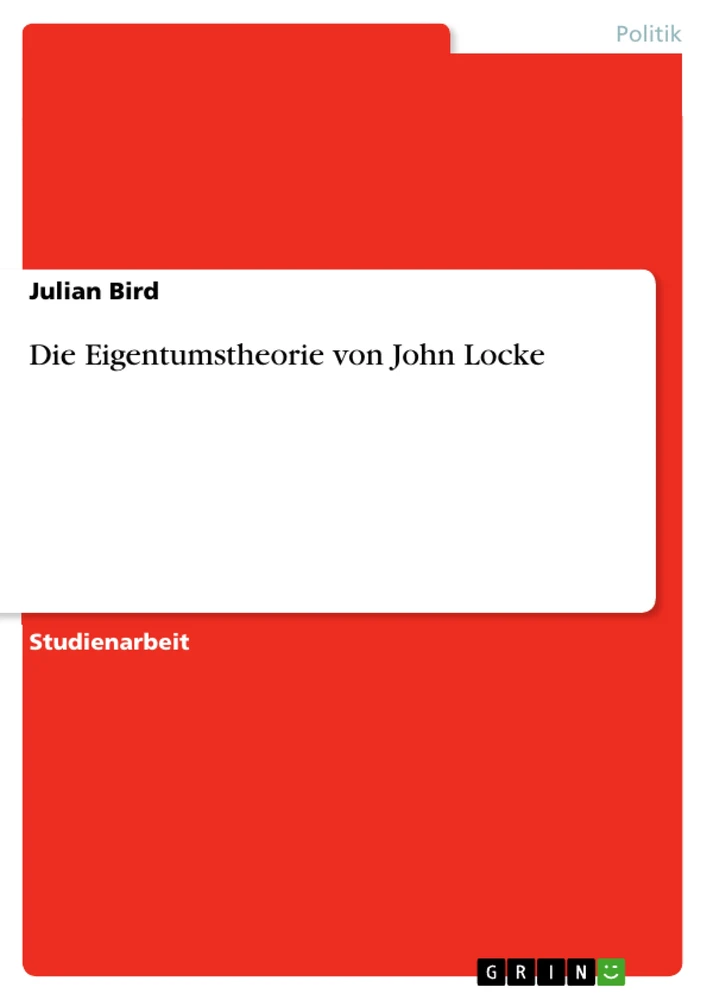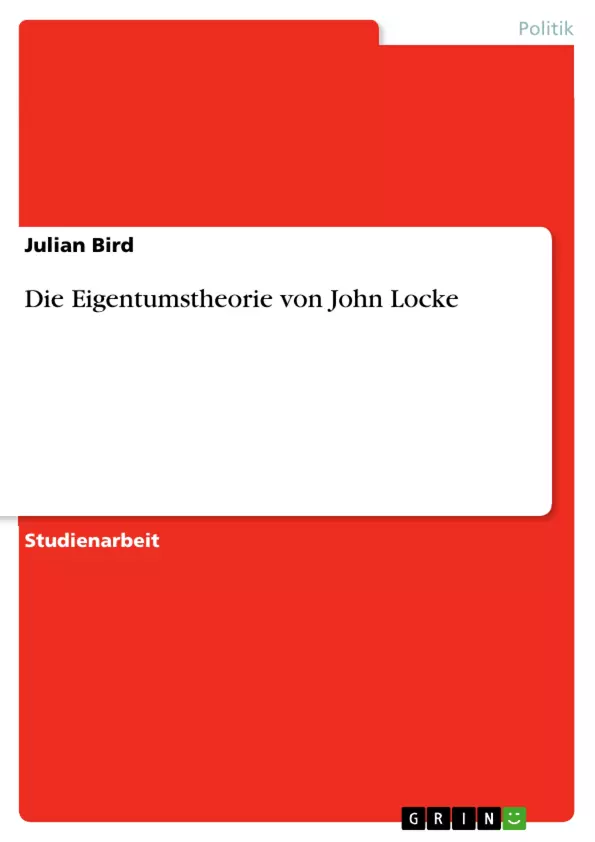Ziel vorliegender Arbeit ist es, einige ausgewählte Elemente der Lockschen Eigentumstheorie zu analysieren, um die Frage beantworten zu können, ob sie inhaltlich und argumentativ konsistent ist.
John Locke (1632-1704) gilt in vielerlei Hinsicht als Vordenker des (modernen) Liberalismus, als einer der Mitbegründer der liberalen politischen Theorie, der das moderne politische Denken entscheidend geprägt hat und es noch heute maßgeblich prägt: Seine Theorie gehört zweifelsohne zu den Klassikern des politischen Denkens. Das Eigentumsrecht Lockes fußt auf dem state of nature, dem Naturzustand, den zuvor viele politischen Denker aufgriffen, um den vorkontraktualistischen Status zu beschreiben. Aufbauend auf diesem Zustand, in dem das Eigentum zur materialen Rechts-Trias (Leben, Freiheit, Eigentum) gehört, entwickelte Locke seine eigene Eigentumstheorie, die ein maßgeblicher Bestandteil seiner idealen Staatstheorie ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Leitfrage
- Lockes Eigentumstheorie im Kontext
- Die Eigentumstheorie
- Privateigentum als Naturrecht
- Das Verhältnis von Arbeit und Eigentum
- Die Anhäufung von Eigentum
- Die Rolle der Religion
- Eigentum im Staat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert ausgewählte Aspekte der Eigentumstheorie von John Locke und untersucht deren inhaltliche und argumentative Konsistenz. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob Lockes Theorie als revolutionär betrachtet werden kann, da er das Eigentumsrecht als durch persönliche Leistung erworben definiert, im Gegensatz zu dem bis dahin vorherrschenden Konzept der Okkupation und des Vertrages.
- Das Konzept des Naturzustands und seine Rolle in der Entwicklung der Eigentumstheorie
- Die Bedeutung von Arbeit und Leistung für den Erwerb von Eigentum
- Die Frage der Anhäufung und Begrenzung von Eigentum
- Der Einfluss von Religion auf Lockes Eigentumstheorie
- Die Verbindung zwischen Eigentum und staatlicher Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Lockes Bedeutung als Vordenker des Liberalismus und seine Eigentumstheorie als zentralen Bestandteil seines politischen Denkens dar. Kapitel 2 untersucht Lockes Theorie im historischen Kontext, unter Berücksichtigung der „Glorious Revolution“ und der gesellschaftlichen Veränderungen im England des 17. Jahrhunderts. Kapitel 3 analysiert die Kernpunkte der Lockschen Eigentumstheorie. Es wird die Rolle von Arbeit und Leistung, die Anhäufung von Eigentum, der Einfluss der Religion und die Beziehung zwischen Eigentum und Staat erörtert.
Schlüsselwörter
John Locke, Eigentumstheorie, Naturrecht, Arbeit, Leistung, Anhäufung, Religion, Staat, Glorious Revolution, Liberalismus, Politische Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von John Lockes Eigentumstheorie?
Locke begründet Privateigentum als Naturrecht, das durch die Vermischung von persönlicher Arbeit mit den Gaben der Natur entsteht.
Wie definiert Locke den Naturzustand?
Der Naturzustand ist ein vorkontraktualistischer Status, in dem Menschen bereits über Rechte wie Leben, Freiheit und Eigentum verfügen.
Gibt es bei Locke Grenzen für die Anhäufung von Eigentum?
Ursprünglich gilt die Schranke, dass nichts verderben darf. Durch die Einführung des Geldes wird diese Begrenzung jedoch faktisch aufgehoben.
Warum gilt Locke als Vordenker des Liberalismus?
Weil er individuelle Rechte und das Eigentum ins Zentrum seiner Staatstheorie stellt und die Aufgabe des Staates primär im Schutz dieser Rechte sieht.
Welchen Einfluss hat die Religion auf seine Theorie?
Locke argumentiert, dass Gott die Welt den Menschen gemeinsam gegeben hat, sie aber durch Vernunft und Arbeit in Privateigentum überführt werden darf.
- Quote paper
- Julian Bird (Author), 2016, Die Eigentumstheorie von John Locke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353001