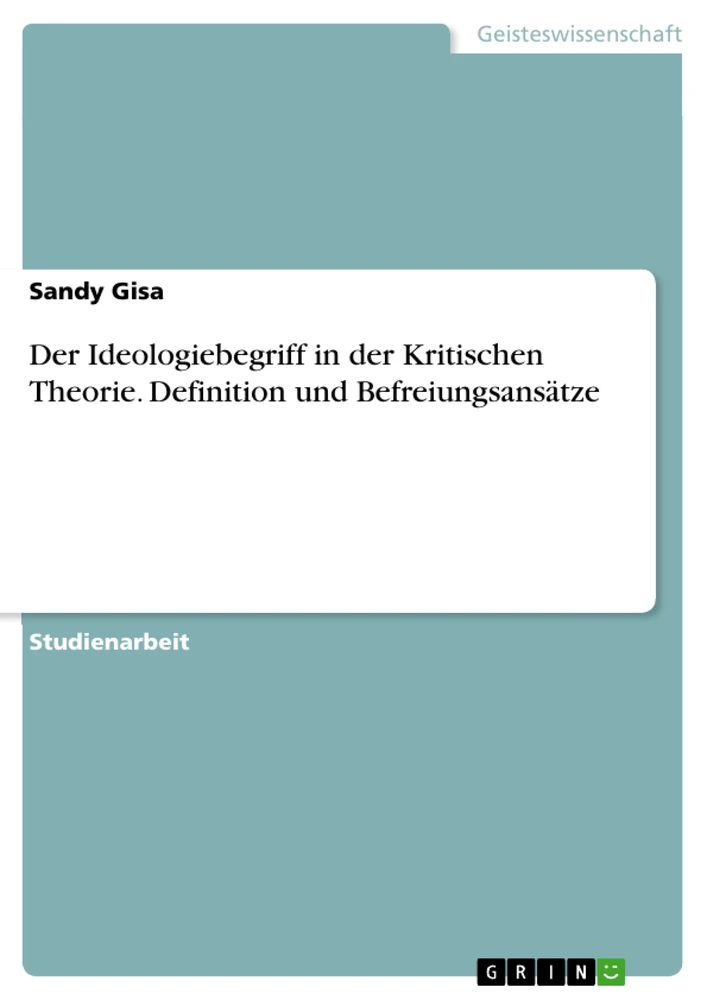Die Arbeit teilt sich in drei übergeordnete Kapitel. Zunächst wird der Fragestellung nachgegangen, was nach Theodor W. Adorno unter Ideologie zu verstehen ist. Im nächsten Schritt veranschaulicht ein Praxisbeispiel die gesellschaftliche Funktionsweise von Ideologien. Nach den detaillierten Erörterungen zum Ideologiebegriff im Verständnis der Kritischen Theorie, wird schließlich der Versuch angestellt, Möglichkeiten zur teilweisen Befreiung von Ideologie zu sammeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Ideologie?
- Anfänge bei Marx
- Ideologie nach Adorno
- Fazit
- Kulturindustrie als Makroideologie
- Fernsehen in der Kulturindustrie
- Fazit
- Ideologiefreiheit
- Befreiungsansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Ideologie und ihrer Auswirkungen auf das menschliche Bewusstsein. Ziel ist es, das Verständnis von Ideologie nach Adorno zu erarbeiten und zu untersuchen, ob und wie eine Freiheit von Ideologie möglich ist.
- Der Begriff der Ideologie in der Kritischen Theorie
- Die Funktionsweise von Ideologie im gesellschaftlichen Kontext
- Die Rolle der Kulturindustrie in der Verbreitung von Ideologie
- Möglichkeiten zur Befreiung von Ideologie
- Der Zusammenhang zwischen Ideologie und Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit dar, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Freiheit von Ideologie möglich ist. Sie skizziert den theoretischen Ansatz der Arbeit, der auf der Kritischen Theorie und insbesondere auf den Ausführungen von Theodor W. Adorno basiert.
Was ist Ideologie?
Dieses Kapitel beleuchtet das Verständnis von Ideologie im Sinne der Kritischen Theorie, insbesondere nach Theodor W. Adorno. Dabei werden die Anfänge des Ideologiebegriffs bei Karl Marx betrachtet und Adornos Weiterentwicklung des Konzepts erörtert. Die zentrale Frage dieses Kapitels ist, was Ideologie nach Adorno bedeutet und welche Ansätze zur Beantwortung der Frage nach Freiheit von Ideologie existieren.
Kulturindustrie als Makroideologie
Dieses Kapitel beleuchtet die Funktionsweise von Ideologie im gesellschaftlichen Kontext, wobei der Fokus auf der Kulturindustrie liegt. Es wird untersucht, wie die Kulturindustrie als Makroideologie dient und welche Auswirkungen sie auf das menschliche Bewusstsein hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Ideologiekritik, der Kritischen Theorie, der Kulturindustrie und der Möglichkeiten zur Befreiung von Ideologie. Wichtige Begriffe sind: Ideologie, falsche Bewusstsein, Herrschaft, Kulturindustrie, Befreiung, Frankfurter Schule, Theodor W. Adorno, Karl Marx.
- Citation du texte
- Sandy Gisa (Auteur), 2017, Der Ideologiebegriff in der Kritischen Theorie. Definition und Befreiungsansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353145