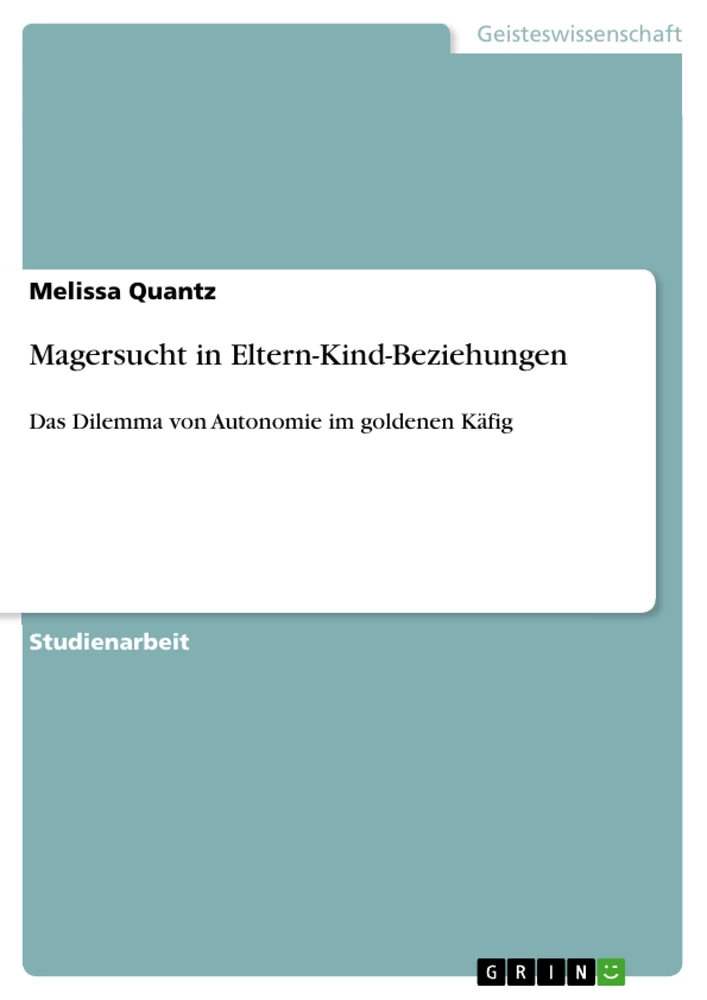Im Folgenden soll erörtert werden, inwiefern der familiäre Kontext zu der Erstmanifestation von Magersucht bei jungen Frauen beiträgt. Sozialpsychologische, kulturelle Einflussfaktoren oder die Rolle des Vaters sollen dabei nicht beleuchtet werden, sondern die Beziehungen innerhalb der Familie, besonders die Mutter-Tochter-Beziehung, mit dem Fokus auf entwicklungsgerechte Autonomiebestrebungen der Töchter.
Eine Diät zu halten ist in unserer westlichen Gesellschaft nichts Ungewöhnliches. Verfolgt man die Angebote der Kaufhäuser, ist der eigene Wirtschaftszweig rund um Fitness, Schönheit und Schlankheit wohl unübersehbar. Doch die Diät ist keine neumodische Erscheinung. Heute scheint die Reduzierung der eigenen Nahrungsaufnahme jedoch außer Kontrolle zu geraten. Wer schön sein will, müsse leiden, heißt es. Diskussionen über magersüchtige Modells haben den Blick auf die gefährlichen Schlankheitsideale gelenkt. Gerade junge Mädchen versuchen sich während der Pubertät das erste Mal an einer Diät – schnell wird der effizienteste Weg erkannt: weniger essen. Hungern. Am Ende steht nicht selten die Magersucht. Völlig außer Acht gelassen wird jedoch, dass das Motiv junger Mädchen nicht Schönheit sein muss, denn Magersucht ist so viel mehr als der bloße Wunsch, schlank zu sein. Dabei geht es eben nicht um Schlanksein, sondern um die Kontrolle des eigenen Körpers und des Essens. Es geht um Stärke, Autonomie und Unabhängigkeit.
Jährlich sterben etwa 33-100 Menschen in Deutschland aufgrund von Essstörungen – 90% davon sind weiblich! Bei Erstmanifestation von Anorexia Nervosa befinden sich Mädchen mit durchschnittlich 14-18 Jahren noch in ihrem Elternhaus – wie ist die Entstehung dieser lebensbedrohlichen Störung in diesem jungen Alter möglich? Wie kann ein solcher Wahn nach Schlankheit und Perfektionismus entstehen? Warum hungern junge Mädchen sich zu Tode? Das Störungsbild muss in ihren besonderen Wirkungsmechanismen verstanden und die Motive junger Mädchen erkannt werden, bevor angemessene Hilfe geleistet werden kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Diagnostik von Anorexia Nervosa
- Verbreitung und Häufigkeit
- Die Familie
- Die soziale Beziehung: Die Eltern-Kind-Beziehung
- Die Mutter-Tochter-Beziehung
- Dilemmata in der Mutter-Tochter-Beziehung
- Erziehungsstile
- Zwei-Faktoren-Modell
- Drei-Faktoren-Modell
- Die Perfekte Familie: Wenn Illusion zur Realität werden soll
- Fazit: Warum Separation und Individuation nötig ist
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des familiären Kontexts auf die Erstmanifestation von Magersucht bei jungen Frauen. Der Fokus liegt dabei auf der Mutter-Tochter-Beziehung und den entwicklungsgerechten Autonomiebestrebungen der Töchter. Die Arbeit untersucht, inwiefern die familiäre Dynamik, insbesondere die Mutter-Tochter-Beziehung, zu den Ursachen von Magersucht beitragen kann.
- Diagnostik und Verbreitung von Anorexia Nervosa
- Die Rolle der Familie in der Entstehung von Magersucht
- Die Mutter-Tochter-Beziehung und ihre Herausforderungen
- Entwicklungsgerechte Autonomiebestrebungen von Töchtern
- Erziehungsstile und ihre Auswirkungen auf die Entstehung von Essstörungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Magersucht in der heutigen Gesellschaft dar und betont die Bedeutung des familiären Kontexts für die Entstehung dieser lebensbedrohlichen Störung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Mutter-Tochter-Beziehung und die entwicklungsgerechten Autonomiebestrebungen der Töchter.
- Diagnostik von Anorexia Nervosa: Dieses Kapitel beleuchtet die Kriterien für die Diagnose von Anorexia Nervosa gemäß ICD-10 und DSM-IV. Es behandelt auch die Verbreitung und Häufigkeit der Störung, wobei der Geschlechtsaspekt besonders hervorgehoben wird. Die Risikogruppe der Erstmanifestation von Magersucht wird als Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren identifiziert.
- Die Familie: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Familie in der Entstehung von Magersucht. Es konzentriert sich auf die soziale Beziehung zwischen Eltern und Kind, insbesondere die Mutter-Tochter-Beziehung, und beleuchtet die Herausforderungen, die sich in dieser Beziehung ergeben können.
- Erziehungsstile: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Erziehungsstile und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern. Es fokussiert auf das Zwei-Faktoren-Modell und das Drei-Faktoren-Modell und analysiert, wie bestimmte Erziehungsstile das Risiko für die Entwicklung von Essstörungen erhöhen können.
- Die Perfekte Familie: Wenn Illusion zur Realität werden soll: Dieses Kapitel erörtert die Idealvorstellungen von einer perfekten Familie und die Auswirkungen, die diese auf die Entstehung von Magersucht haben können. Es beleuchtet die Dynamik innerhalb der Familie und die Rolle von Erwartungen und Druck auf die Entwicklung von Essstörungen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind Anorexia Nervosa, Magersucht, Familie, Mutter-Tochter-Beziehung, Autonomie, Individuation, Erziehungsstile, Perfektionismus, Druck, Erwartungen, und Selbstbild. Die Arbeit untersucht die Bedeutung dieser Faktoren für die Entstehung von Magersucht und die Herausforderungen, die sich in der Mutter-Tochter-Beziehung im Zusammenhang mit den Autonomiebestrebungen der Töchter ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Familie die Entstehung von Magersucht?
Der familiäre Kontext, insbesondere gestörte Autonomiebestrebungen und die Dynamik in der Mutter-Tochter-Beziehung, spielen eine zentrale Rolle bei der Erstmanifestation von Anorexie.
Was ist das eigentliche Motiv hinter der Magersucht?
Oft geht es nicht nur um Schlankheit, sondern um den Wunsch nach Kontrolle über den eigenen Körper, Stärke, Autonomie und Unabhängigkeit von den Eltern.
Warum ist die Mutter-Tochter-Beziehung so wichtig?
Die Arbeit untersucht Dilemmata in dieser Beziehung, wobei die Magersucht als fehlgeschlagener Versuch der Separation und Individuation der Tochter gesehen werden kann.
Welchen Einfluss haben Erziehungsstile auf Essstörungen?
Bestimmte Erziehungsstile (analysiert über Zwei- oder Drei-Faktoren-Modelle) können übermäßigen Perfektionismus und Druck fördern, was die Entstehung von Magersucht begünstigt.
In welchem Alter tritt Magersucht am häufigsten auf?
Die Erstmanifestation liegt im Durchschnitt bei jungen Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren, während sie sich noch im Elternhaus befinden.
- Quote paper
- Melissa Quantz (Author), 2014, Magersucht in Eltern-Kind-Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353324