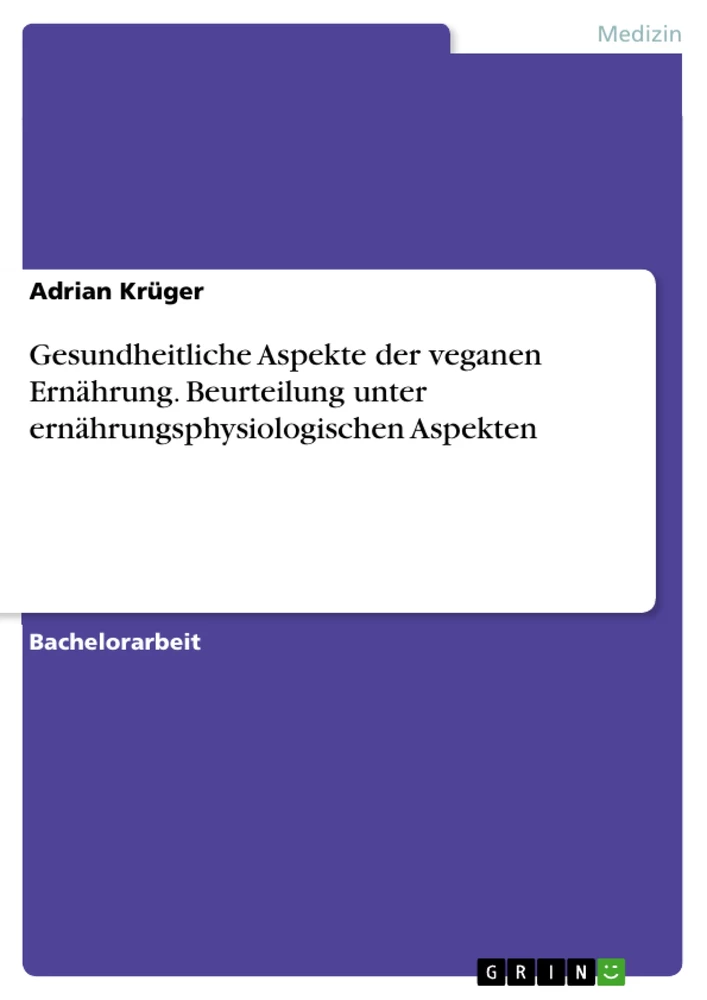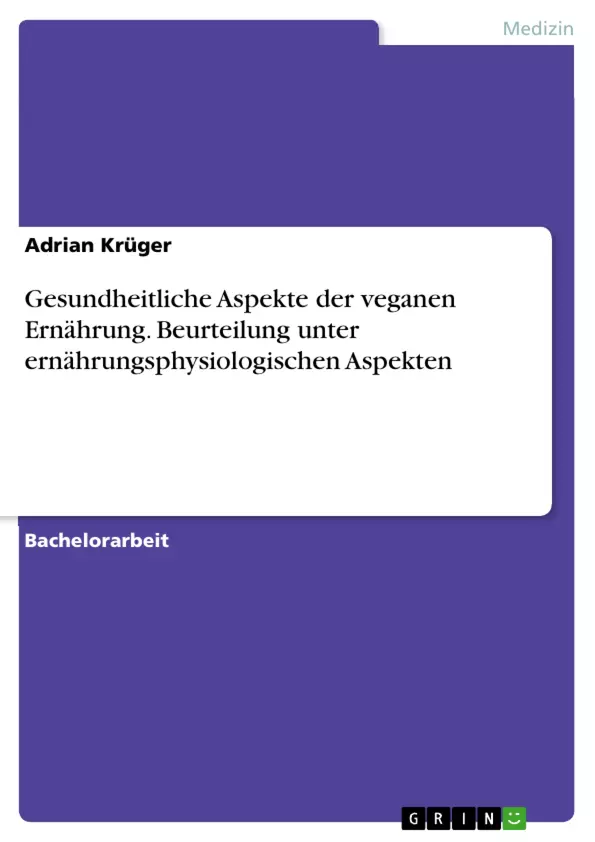Vegetarische und vegane Ernährung liegt derzeit im Trend wie nie zuvor. Spitzenköche kochen vegetarisch und vegan und Verlage bringen entsprechende Kochbücher heraus. Das Sortiment der veganen Produkte in Supermärkten wird stetig vielfältiger und nahezu jede Mensa und Kantine bieten täglich passende Gerichte.
Nicht zuletzt haben Lebensmittelskandale der letzten Jahre, wie Gammelfleisch, Pferdefleisch in Lasagnen oder resistente Keime auf Hähnchenschenkeln zu diesem Trend beigetragen.
Der Konsument ist immer besser informiert über Missstände in zum Beispiel der Massentierhaltung und die Lebensmittelindustrie muss reagieren. Traditions-Wurst-Unternehmen wie "Rügenwalder" haben mittlerweile vegetarische Mortadella und ähnliche Produkte auf den Markt gebracht. Diese Produkte verkaufen sich teils besser als das tierische Pendant. Große Einzelhandelsketten wie EDEKA experimentieren in dutzenden Märkten mit einer "vegetarischen Fleischtheke" (unterstützt von Veganz), an der der Kunde vegetarische Sojaschnitzel und ähnliches bekommt. 2011 gründete Jan Bredack, ehemaliger Manager bei Daimler-Benz, die vegane Supermarktkette Veganz, welche von Berlin bis Wien in einigen europäischen Großstädten zu finden ist.
In der folgenden Arbeit soll unter ernährungsphysiologischen Aspekten beleuchtet werden, inwieweit der Veganismus den Nährstoffbedarf decken kann, eventuell sogar eine Supplementierung einzelner Nährstoffe notwendig ist und welche gesundheitlichen Vor- oder Nachteile eine vegane Ernährung bringen kann. Es wird erst allgemein geklärt, wie eine Kostform wissenschaftlich bewertet wird, ein präventives Potential dieser Kostform aufgezeigt und dann welche Nährstoffe und Punkte kritisch sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition des Veganismus
- 2.1 Bio-Veganismus
- 2.2 Fruganismus
- 2.3 Vegane Rohkost
- 3. Motive für den Veganismus
- 3.1 Umweltschutz
- 3.2 Verteilungsgerechtigkeit/Welternährungsproblematik
- 3.3 Tierethik
- 3.4 Potentielle gesundheitliche Nachteile einiger tierischer Produkte
- 3.5 Weitere Motive für den Veganismus
- 4. Ernährungsphysiologische Bewertung einer Ernährungsform
- 4.1 Methodik
- 4.2 Hauptnährstoffe
- 4.3 Vitamine
- 4.4 Mineralstoffe
- 4.5 Ballaststoffe
- 5. Gesundheitliche Beurteilung einer veganen Kostform
- 5.1 Präventives Potential veganer Ernährung
- 5.2 Potentiell kritische Nährstoffe bei einer veganen Ernährung
- 5.2.1 Protein
- 5.2.2 Eisen
- 5.2.3 Kalzium
- 5.2.4 Vitamin B12
- 5.2.5 Vitamin D
- 5.2.6 Essentielle Fettsäuren
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die vegane Ernährung unter ernährungsphysiologischen Aspekten. Ziel ist es, zu beleuchten, inwieweit der Veganismus den menschlichen Nährstoffbedarf decken kann, ob eine Supplementierung notwendig ist und welche gesundheitlichen Vor- oder Nachteile eine vegane Ernährung mit sich bringt. Die Arbeit bewertet wissenschaftliche Methoden zur Beurteilung von Ernährungsweisen.
- Ernährungsphysiologische Bewertung veganer Ernährung
- Deckung des Nährstoffbedarfs bei veganer Ernährung
- Potentiell kritische Nährstoffe bei veganer Ernährung
- Gesundheitliche Vor- und Nachteile veganer Ernährung
- Präventives Potential veganer Ernährung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den aktuellen Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung, unterstützt durch zunehmende Bewusstseinsbildung bezüglich Lebensmittelskandale und Missstände in der Massentierhaltung. Sie führt in das Thema ein und benennt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die ernährungsphysiologische Bewertung des Veganismus hinsichtlich Nährstoffdeckung und gesundheitlicher Auswirkungen.
2. Definition des Veganismus: Dieses Kapitel definiert den Veganismus und differenziert zwischen verschiedenen Ausprägungen wie Bio-Veganismus, Fruganismus und veganer Rohkost. Es legt die Grundlage für das Verständnis der untersuchten Ernährungsform und ihrer verschiedenen Facetten. Die verschiedenen Ausprägungen des Veganismus werden definiert und abgegrenzt.
3. Motive für den Veganismus: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Beweggründe für die Wahl einer veganen Lebensweise. Es werden ethische (Tierethik), ökologische (Umweltschutz) und soziale (Verteilungsgerechtigkeit, Welternährungsproblematik) Aspekte diskutiert, sowie potentielle gesundheitliche Nachteile tierischer Produkte als Motiv genannt. Zusätzlich werden weitere Motive beleuchtet, um das breite Spektrum der Motivation für eine vegane Ernährung zu verdeutlichen.
4. Ernährungsphysiologische Bewertung einer Ernährungsform: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der ernährungsphysiologischen Bewertung von Ernährungsweisen. Es erläutert die Betrachtung der Hauptnährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, um ein umfassendes Bild der Nährstoffversorgung zu ermöglichen. Die wissenschaftliche Herangehensweise an die Analyse der Ernährungsform wird detailliert dargestellt.
5. Gesundheitliche Beurteilung einer veganen Kostform: Dieses Kapitel bewertet die gesundheitlichen Aspekte einer veganen Ernährung. Es analysiert das präventive Potential und untersucht kritische Nährstoffe wie Protein, Eisen, Kalzium, Vitamin B12, Vitamin D und essentielle Fettsäuren, wobei die potenziellen Defizite und deren Folgen beleuchtet werden. Es findet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen der Ernährungsweise statt.
Schlüsselwörter
Vegane Ernährung, Ernährungsphysiologie, Nährstoffbedarf, Nährstoffdefizite, Gesundheitsaspekte, Prävention, Protein, Eisen, Kalzium, Vitamin B12, Vitamin D, essentielle Fettsäuren, Umweltschutz, Tierethik, Verteilungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Ernährungsphysiologische Bewertung des Veganismus
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die vegane Ernährung aus ernährungsphysiologischer Sicht. Sie beleuchtet, ob der Veganismus den menschlichen Nährstoffbedarf decken kann, ob Supplementierung notwendig ist und welche gesundheitlichen Vor- oder Nachteile eine vegane Ernährung mit sich bringt. Die Arbeit bewertet auch wissenschaftliche Methoden zur Beurteilung von Ernährungsweisen.
Welche Aspekte des Veganismus werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte des Veganismus, darunter die Definition und Abgrenzung verschiedener Formen des Veganismus (Bio-Veganismus, Fruganismus, vegane Rohkost), die Motive für die Wahl einer veganen Lebensweise (ethische, ökologische, soziale Aspekte und gesundheitliche Überlegungen), die ernährungsphysiologische Bewertung (Hauptnährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe) und die gesundheitliche Beurteilung (präventives Potential, potentiell kritische Nährstoffe wie Protein, Eisen, Kalzium, Vitamin B12, Vitamin D und essentielle Fettsäuren).
Welche Methodik wird zur ernährungsphysiologischen Bewertung angewendet?
Die Arbeit beschreibt die Methodik der ernährungsphysiologischen Bewertung von Ernährungsweisen detailliert. Es wird erläutert, wie Hauptnährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe betrachtet werden, um ein umfassendes Bild der Nährstoffversorgung zu ermöglichen. Die wissenschaftliche Herangehensweise an die Analyse der Ernährungsform wird detailliert dargestellt.
Welche potentiell kritischen Nährstoffe werden bei veganer Ernährung betrachtet?
Die Arbeit untersucht potentiell kritische Nährstoffe bei veganer Ernährung, darunter Protein, Eisen, Kalzium, Vitamin B12, Vitamin D und essentielle Fettsäuren. Es werden die potenziellen Defizite und deren Folgen beleuchtet.
Welche gesundheitlichen Vor- und Nachteile einer veganen Ernährung werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert das präventive Potential veganer Ernährung und untersucht detailliert die Vor- und Nachteile dieser Ernährungsweise im Hinblick auf die Nährstoffversorgung und die gesundheitlichen Auswirkungen.
Welche Motive für den Veganismus werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit diskutiert ethische (Tierethik), ökologische (Umweltschutz) und soziale (Verteilungsgerechtigkeit, Welternährungsproblematik) Motive für den Veganismus. Zusätzlich werden potentielle gesundheitliche Nachteile tierischer Produkte und weitere Motive beleuchtet.
Welche verschiedenen Formen des Veganismus werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Bio-Veganismus, Fruganismus und veganer Rohkost und definiert und grenzt diese verschiedenen Ausprägungen des Veganismus voneinander ab.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vegane Ernährung, Ernährungsphysiologie, Nährstoffbedarf, Nährstoffdefizite, Gesundheitsaspekte, Prävention, Protein, Eisen, Kalzium, Vitamin B12, Vitamin D, essentielle Fettsäuren, Umweltschutz, Tierethik, Verteilungsgerechtigkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition des Veganismus, ein Kapitel zu den Motiven für den Veganismus, ein Kapitel zur ernährungsphysiologischen Bewertung von Ernährungsweisen, ein Kapitel zur gesundheitlichen Beurteilung veganer Ernährung und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen sind ebenfalls enthalten.
- Arbeit zitieren
- Adrian Krüger (Autor:in), 2015, Gesundheitliche Aspekte der veganen Ernährung. Beurteilung unter ernährungsphysiologischen Aspekten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353330