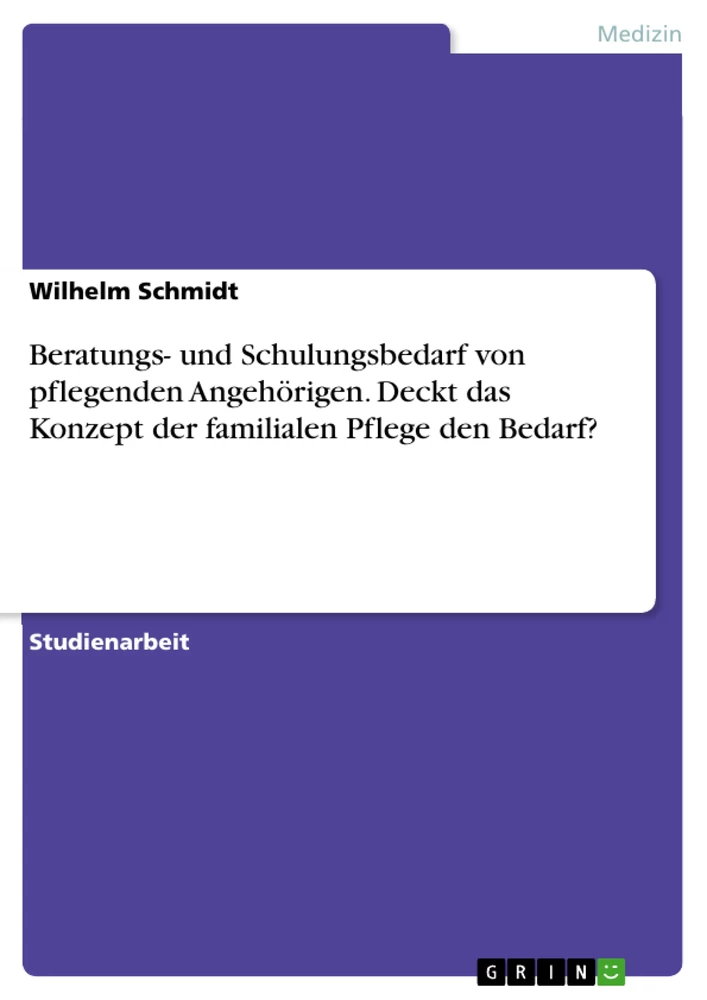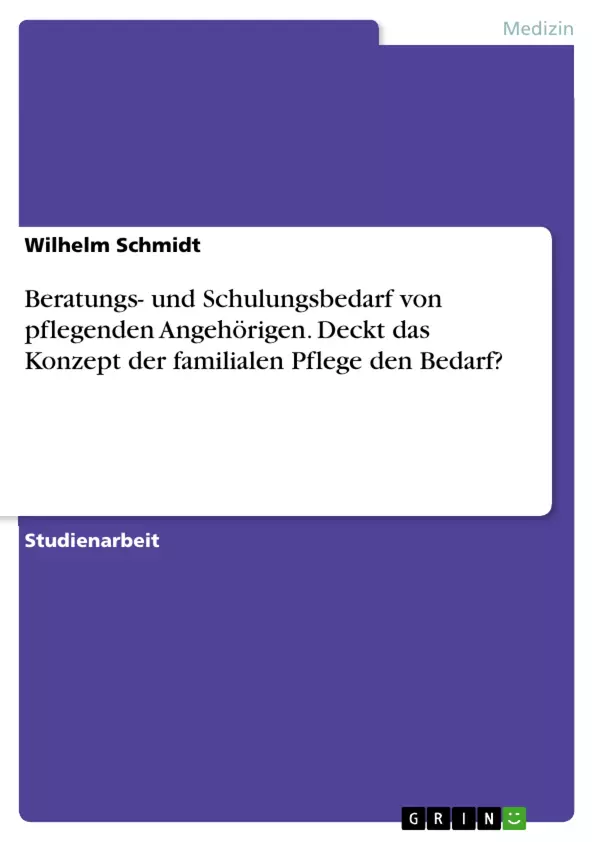Das Konzept der „familialen Pflege“ richtet sich an pflegende Angehörige und pflegende Familien und soll, ausgehend vom Krankenhaus, die reibungslose Überleitung in die häusliche Umgebung ermöglichen. Ausgebildete Pflegetrainer stehen den Angehörigen in diesem Prozess bis zu sechs Wochen nach dem Aufenthalt informierend, beratend und schulend zur Seite.
Angehörige von Pflegebedürftigen, die die häusliche Versorgung sicherstellen, sind hohen Belastungssituationen ausgesetzt. Viele sind dadurch begründet, dass ihnen Wissen oder Fähigkeiten im Umgang mit dem Pflegebedürftigen, dem Gesundheitswesen oder der eigenen Belastungssituation fehlen. Diese Arbeit soll ermitteln, ob das Konzept der „familialen Pflege“ den Anforderungen der Zielgruppe pflegender Angehöriger gerecht wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemhintergrund
- 2.1. Wandel der Familie
- 2.2. Wandel der Altersstrukturen
- 2.3. Unternehmen Krankenhaus
- 3. Zielgruppe „pflegende Angehörige“
- 3.1. Merkmale der Zielgruppe
- 3.2. Motiv zur Übernahme der Pflegetätigkeit
- 3.3. Belastungssituationen der pflegenden Angehörigen
- 3.4. Bedürfnisse pflegender Angehöriger
- 4. Konzept der familialen Pflege
- 4.1. Grundannahmen und Interventionsziele
- 4.2. Erstgespräche
- 4.3. Familiengespräche
- 4.4. Pflegetrainings
- 4.5. Initialpflegekurse
- 4.6. Qualitätschecks
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob das Konzept der Familialen Pflege den Bedürfnissen pflegender Angehöriger gerecht wird. Sie analysiert die Herausforderungen der häuslichen Pflege im Kontext des demografischen Wandels und veränderter Familienstrukturen. Die Studie beleuchtet die Überleitung pflegebedürftiger Patienten aus dem Krankenhaus in die häusliche Umgebung.
- Herausforderungen der häuslichen Pflege
- Bedürfnisse pflegender Angehöriger
- Eignung des Konzepts der Familialen Pflege
- Einfluss des demografischen Wandels
- Veränderung der Familienstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Konzept der Familialen Pflege vor, welches pflegende Angehörige nach einem Krankenhausaufenthalt unterstützt. Es beschreibt den Ansatz, Angehörigen durch ausgebildete Pflegetrainer bis zu sechs Wochen nach der Entlassung beratend und schulend zur Seite zu stehen und zielt darauf ab, die reibungslose Überleitung in die häusliche Pflege zu ermöglichen. Die Arbeit untersucht die Eignung dieses Konzepts anhand der Bedürfnisse der Zielgruppe.
2. Problemhintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die Faktoren, die die Überleitung pflegebedürftiger Patienten aus dem Krankenhaus beeinflussen. Es betrachtet den Wandel der Familienstrukturen, den demografischen Wandel und die Veränderungen innerhalb des Krankenhauswesens als entscheidende Einflussfaktoren auf die häusliche Pflege. Die zunehmende Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen in Verbindung mit veränderten Familienstrukturen und den Herausforderungen der Krankenhausentlassung werden hier detailliert dargestellt und in ihrem Einfluss auf die familiäre Pflegesituation analysiert.
3. Zielgruppe „pflegende Angehörige“: Dieser Abschnitt definiert die Zielgruppe „pflegende Angehörige“ und beschreibt deren charakteristische Merkmale, Motive zur Übernahme der Pflegetätigkeit sowie die damit verbundenen Belastungen und Bedürfnisse. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, die pflegenden Angehörigen voneinander unterscheiden, wie z.B. Alter, familiäre Situation und finanzielle Möglichkeiten. Die Analyse der Motive und Belastungen liefert wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung geeigneter Unterstützungsprogramme.
4. Konzept der familialen Pflege: Das Kapitel beschreibt detailliert das Konzept der Familialen Pflege, beginnend mit den Grundannahmen und Interventionszielen. Es erläutert die einzelnen Angebote wie Erstgespräche, Familiengespräche, Pflegetrainings und Initialpflegekurse, und bewertet deren Übereinstimmung mit den Bedürfnissen pflegender Angehöriger. Die Kapitel unterstreichen den Ansatz einer ganzheitlichen Betreuung, welche die individuellen Bedürfnisse der Angehörigen berücksichtigt. Qualitätschecks dienen der laufenden Evaluation und Optimierung des Konzepts.
Schlüsselwörter
Familiale Pflege, pflegende Angehörige, Krankenhausentlassung, demografischer Wandel, Familienstrukturen, Belastung, Bedürfnisse, Unterstützung, Beratung, Schulung, Pflegetraining, Qualitätsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Familialen Pflege
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Konzepts der Familialen Pflege für die Bedürfnisse pflegender Angehöriger. Sie analysiert die Herausforderungen der häuslichen Pflege im Kontext des demografischen Wandels und veränderter Familienstrukturen, mit besonderem Fokus auf die Überleitung pflegebedürftiger Patienten aus dem Krankenhaus in die häusliche Umgebung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte: den Wandel der Familienstrukturen und Altersstrukturen, die Herausforderungen im Krankenhauswesen, die Merkmale, Motive und Belastungen pflegender Angehöriger, deren Bedürfnisse und die Gestaltung geeigneter Unterstützungsprogramme. Das Konzept der Familialen Pflege wird detailliert beschrieben, inklusive Erstgespräche, Familiengespräche, Pflegetrainings und Initialpflegekurse. Die Eignung des Konzepts im Hinblick auf die Bedürfnisse pflegender Angehöriger wird untersucht.
Welche Zielgruppe steht im Mittelpunkt der Studie?
Die Hauptzielgruppe sind pflegende Angehörige. Die Arbeit analysiert deren charakteristische Merkmale, Motive zur Übernahme der Pflegetätigkeit, sowie die damit verbundenen Belastungen und Bedürfnisse. Verschiedene Aspekte wie Alter, familiäre Situation und finanzielle Möglichkeiten werden berücksichtigt.
Wie wird das Konzept der Familialen Pflege beschrieben?
Das Konzept der Familialen Pflege wird umfassend dargestellt, beginnend mit den Grundannahmen und Interventionszielen. Es werden die einzelnen Bausteine wie Erstgespräche, Familiengespräche, Pflegetrainings und Initialpflegekurse detailliert erläutert. Die Kapitel betonen den Ansatz einer ganzheitlichen Betreuung, die die individuellen Bedürfnisse der Angehörigen berücksichtigt, und die Bedeutung von Qualitätschecks zur laufenden Evaluation und Optimierung.
Welche Herausforderungen der häuslichen Pflege werden angesprochen?
Die Arbeit adressiert die Herausforderungen der häuslichen Pflege im Kontext des demografischen Wandels und veränderter Familienstrukturen. Die zunehmende Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen in Verbindung mit veränderten Familienstrukturen und den Herausforderungen der Krankenhausentlassung werden detailliert dargestellt und in ihrem Einfluss auf die familiäre Pflegesituation analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Familiale Pflege, pflegende Angehörige, Krankenhausentlassung, demografischer Wandel, Familienstrukturen, Belastung, Bedürfnisse, Unterstützung, Beratung, Schulung, Pflegetraining, Qualitätsentwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Problemhintergrund (Wandel der Familie, Wandel der Altersstrukturen, Unternehmen Krankenhaus), Zielgruppe „pflegende Angehörige“ (Merkmale, Motive, Belastungssituationen, Bedürfnisse), Konzept der familialen Pflege (Grundannahmen, Erstgespräche, Familiengespräche, Pflegetrainings, Initialpflegekurse, Qualitätschecks), Fazit und Literaturverzeichnis.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Der HTML-Auszug enthält kein explizites Fazit. Die Schlussfolgerung müsste aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.)
- Citation du texte
- Wilhelm Schmidt (Auteur), 2015, Beratungs- und Schulungsbedarf von pflegenden Angehörigen. Deckt das Konzept der familialen Pflege den Bedarf?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353392